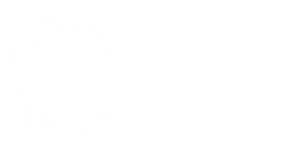Update Schmerzmedizin: Aktuelle Empfehlungen und neue Therapieoptionen
Am Ende dieser Fortbildung...
- die pathophysiologischen Mechanismen tumorassoziierter Schmerzen,
- das leitliniengerechte Vorgehen bei der chemotherapieinduzierten Polyneuropathie (CIPN),
- geeignete pharmakologische und interventionelle Strategien bei therapierefraktären Tumor- und Nichttumorschmerzen,
- Prinzipien der modernen multimodalen Schmerztherapie und deren Bedeutung für die Lebensqualität und den Funktionserhalt.
Tumorassoziierte Schmerzen: Von Hypersensitivierung zur Chronifizierung
Tumorbedingte Schmerzen werden öffentlich oft mit dem Endstadium maligner Erkrankungen assoziiert, was den aktuellen onkologischen Realitäten nicht mehr entspricht. Durch steigende Heilungsraten – von rund 50 % vor vier Jahrzehnten auf 70 bis 75 % heute – wächst die Zahl chronisch schmerzbelasteter Langzeitüberlebender. Dennoch bleibt die Schmerzversorgung unzureichend: Etwa die Hälfte der Betroffenen erhält keine adäquate Schmerztherapie. Strukturelle Defizite, wie das Fehlen einer spezifischen ICD-Codierung für Tumorschmerz, erschweren epidemiologische Analysen; die bevorstehende ICD-Revision könnte dies beheben und eine präzisere Bedarfsplanung ermöglichen. Persistierende Schmerzen nach kurativer Therapie betreffen 20 bis 40 % der Überlebenden. Sie gehen häufig mit neuropathischen Merkmalen einher wie Allodynie, Hyperalgesie, brennenden Sensationen, die attackenartig auftreten können, und anderen Missempfindungen. Morphologische Korrelate sind nicht immer nachweisbar. Die Lebensqualität der Betroffenen ist häufig stark beeinträchtigt. Pathophysiologisch dominieren Hypersensitivierungsmechanismen durch chronische Entzündungen, neuropathische Läsionen und zentrale Veränderungen. Bestimmte genetische Varianten, die proinflammatorische Mediatoren (z. B. Interleukine) betreffen, modulieren die Schmerzempfindlichkeit. Dieses Phänomen tritt bei manchen Tumoren stärker auf, dazu gehören das kleinzellige Bronchial- und Pankreaskarzinom. Therapiebedingte Faktoren wie chemotherapieinduzierte Neuropathien, radiogene Schäden oder chirurgische Nervenläsionen tragen zur Chronifizierung bei, ergänzt durch nicht tumorspezifische Sensitivierungsmechanismen. Tumorassoziierte Schmerzen resultieren also aus einem komplexen nozizeptiven, neuropathischen und inflammatorischen Zusammenspiel. Ihre Behandlung erfordert eine interdisziplinäre, individualisierte Strategie, die gleichermaßen patho-physiologische und psychosoziale Aspekte berücksichtigt.
Noziplastischer Schmerz und Chronifizierung bei tumorassoziierten Schmerzen
Noziplastischer Schmerz beschreibt Schmerzen durch veränderte Nozizeption ohne nachweisbare Gewebeschädigung. Der Schmerz hat meist einen brennenden, kribbelnden oder einschießenden Charakter, ähnlich wie bei neuropathischen Beschwerden, jedoch ohne nachweisbare strukturelle Läsionen. Dieser Mechanismus liegt häufig bei Langzeitüberlebenden nach kurativer Tumortherapie vor. Bei den Betroffenen finden sich häufig Dauerschmerz, multilokale Schmerzverteilung, inadäquate Medikamenteneinnahme, häufiger Therapeutenwechsel und psychische Komorbiditäten, was der Chronifizierung Vorschub leistet. Chronische tumorassoziierte Schmerzen erfordern eine multimodale Schmerztherapie. Diese integriert pharmakologische, physiotherapeutische und psychotherapeutische Ansätze für rehabilitationsfähige Patienten mit persistierenden Schmerzen. Eine stadiengerechte Versorgung – unterteilt in akute, chronisch persistierende und palliativmedizinische Phasen – zielt auf die Lebensqualität, Funktionsfähigkeit und soziale Reintegration ab. Die frühzeitige Erkennung tumorassoziierter Schmerzen, sowohl bei kurativ als auch palliativ behandelten Patienten, ist entscheidend. Es empfiehlt sich, Schmerzen früh offen anzusprechen. Kommunikationsbarrieren und die Neigung, Schmerzen zu bagatellisieren, führen oft zu Verkennung und unzureichender Behandlung.
Pathophysiologie neuropathischer Schmerzen
Neuropathische Schmerzen resultieren aus komplexen Veränderungen im peripheren und zentralen Nervensystem, die die Erregbarkeit schmerzleitender Bahnen steigern und inhibitorische Mechanismen schwächen. Periphere Sensibilisierung entsteht durch Schädigung nozizeptiver Neuronen, die eine veränderte Expression von Ionenkanälen und Rezeptoren bewirkt. Dies führt zu ektoper Spontanaktivität und erniedrigter Reizschwelle, wodurch pathologische Entladungen unabhängig von Reizen auftreten. Eine zentrale Sensibilisierung folgt durch Überaktivierung von Hinterhorn-Neuronen im Rückenmark, verstärkt durch N-Methyl-D- Aspartat-(NMDA-)Rezeptoren, bei gleichzeitiger Degeneration inhibitorischer Interneurone, was die Schmerzsignalweiterleitung verstärkt. Die resultierende plastische Reorganisation, bekannt als „Schmerzgedächtnis”, manifestiert sich in persistierenden Schmerzen, Hyperalgesie und Allodynie, auch ohne fortbestehende Gewebeschädigung. Das endogene Schmerzhemmungssystem, vermittelt durch serotonerge und noradrenerge Bahnen, ist bei chronischen Schmerzen abgeschwächt. Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (englisch „serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors”, SNRI; z. B. Duloxetin) können dies durch Erhöhung der Neurotransmitterkonzentration im synaptischen Spalt teilweise kompensieren.
Chemotherapieinduzierte Polyneuropathie und neuropathischer Tumorschmerz: Diagnostik und therapeutische Implikationen
Neuropathische Schmerzen stellen eine häufige und klinisch relevante Komplikation onkologischer Therapien dar. Etwa 5 % aller palliativen Tumorpatienten benötigen interventionelle schmerztherapeutische Verfahren, darunter Nervenblockaden oder intrathekale Katheteranlagen. Diese sollten bei unzureichender Wirksamkeit medikamentöser Maßnahmen frühzeitig in Betracht gezogen werden, um eine adäquate Schmerzkontrolle zu gewährleisten. Ein typisches Beispiel für neuropathische Tumorschmerzen ist die chemotherapieinduzierte Polyneuropathie (CIPN), die insbesondere bei der Behandlung mit Taxanen, Vinca-Alkaloiden oder platinhaltigen Zytostatika auftritt. Klinisch manifestiert sich die CIPN initial mit Sensibilitätsstörungen, Parästhesien und Taubheitsgefühlen an Händen und Füßen, später häufig mit brennenden Schmerzen, Dysästhesien oder Anaesthesia dolorosa. Charakteristisch ist die kumulative Natur dieser Nebenwirkung: Mit jeder weiteren Chemotherapie kann eine bestehende Neuropathie progredient verstärkt werden. Trotz der Häufigkeit bleibt die CIPN oft unterdiagnostiziert und untertherapiert. Studien zeigen, dass >50 % der mit Taxanen oder Oxaliplatin behandelten Patienten neuropathische Symptome entwickeln. Die Lebensqualität der Betroffenen ist häufig erheblich eingeschränkt, insbesondere bei Langzeitüberlebenden. Therapeutisch steht eine frühzeitige Co-Therapie im Vordergrund. Pharmakologisch bewährt haben sich Antikonvulsiva wie Pregabalin und Gabapentin sowie trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin. Pregabalin zeigt in der Praxis den Vorteil eines rascheren Wirkeintrittes und einer zusätzlichen schlafinduzierenden Wirkung, was insbesondere bei tumorassoziierten Schlafstörungen von Bedeutung ist. Bei Niereninsuffizienz ist jedoch eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich. Die individuelle Dosierung sollte patientenzentriert erfolgen, um die Therapieakzeptanz und das subjektive Kontrollgefühl zu fördern. Neben der systemischen Therapie kommen auch topische und supportive Maßnahmen zum Einsatz. Bei lokalisierten neuropathischen Schmerzen können Capsaicin-Pflaster eine deutliche Linderung bewirken. Kühlungsmaßnahmen während und nach der Chemotherapie (z. B. Lutschen von Eis oder Eintauchen der Hände in kühle Lösungen) können die Inzidenz und Schwere der Neuropathie reduzieren. Ergänzend zeigen neuere Studien, dass eine Supplementierung mit Glutamin sensorische Missempfindungen und Taubheitsgefühle signifikant verbessern kann. Neben der chemotherapieinduzierten Neuropathie sind auch strahleninduzierte Nervenschädigungen ausführlich in der Literatur beschrieben. Diese können sich als Radiatio-bedingte Plexopathie oder in seltenen Fällen als Polyneuropathie manifestieren. Pathophysiologisch handelt es sich um direkte Schädigungen des Nervengewebes, die sich klinisch nicht von anderen peripheren Neuropathien unterscheiden. Typische Symptome sind brennende Schmerzen, Dysästhesien und Hypästhesien, die im betroffenen Dermatom- oder Innervationsgebiet auftreten.
Diagnostik neuropathischer Schmerzen
Zur klinischen Erfassung neuropathischer Schmerzanteile stehen validierte Instrumente zur Verfügung, insbesondere der PainDETECT-Fragebogen, der in über 20 Sprachen validiert ist und durch gezielte Fragen zu Schmerzcharakteristika wie Brennen, Kribbeln oder einschießenden Schmerzen eine hohe Sensitivität für neuropathische Schmerzkomponenten aufweist. In der klinischen Untersuchung sind einfache Hilfsmittel ausreichend, um neuropathische Mechanismen zu erkennen: Reflexhammer zur Überprüfung abgeschwächter Reflexe, Stimmgabel zur Beurteilung der Vibrationsempfindung, Pinprick-Test und Monofilament zur Erfassung von Hyperalgesie oder Allodynie, Kälte- und Wärmetests, beispielsweise mit alkoholgetränkten Applikatoren, zur Detektion von Dysästhesien. Diese Kombination aus pathophysiologischem Verständnis, strukturiertem Screening und gezielter einfacher klinischer Untersuchung bildet die Grundlage für eine differenzierte, patientengerechte Diagnostik und Therapie neuropathischer Schmerzsyndrome.
Pharmakologische und interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen
Trizyklische Antidepressiva
Trizyklische Antidepressiva, insbesondere Amitriptylin, zählen zu den etablierten pharmakologischen Optionen in der Behandlung neuropathischer Schmerzen, insbesondere wenn begleitende Schlafstörungen vorliegen. Aufgrund ihres sedierenden Effektes können sie eine doppelte therapeutische Funktion erfüllen. Gleichzeitig ist auf potenzielle kardiale Nebenwirkungen zu achten. Amitriptylin kann Arrhythmien oder Leitungsstörungen begünstigen, weshalb vor Therapiebeginn sowie im Verlauf grundsätzlich ein Elektrokardiogramm durchgeführt werden sollte. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt insbesondere für ältere oder kardiovaskulär vorbelastete Patienten.
Interventionelle Verfahren bei therapierefraktären Schmerzen
Bei unzureichender Wirksamkeit konventioneller Analgetika oder bei intolerablen Nebenwirkungen sollte frühzeitig die Indikation für interventionelle Verfahren geprüft werden. Hierzu zählen insbesondere spinale Katheter- und Pumpensysteme zur intrathekalen Opioidapplikation. Der Einsatz solcher Systeme sollte nicht ausschließlich zeitabhängig, sondern individuell nach Therapieresponse, Schmerzintensität und funktioneller Beeinträchtigung erfolgen. Eine Morphinpumpe kann eine deutliche Schmerzreduktion bei gleichzeitig geringeren systemischen Nebenwirkungen als die orale Gabe ermöglichen, da das Analgetikum direkt an den Wirkort appliziert wird. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Anästhesiologie, Neurochirurgie, Onkologie und Palliativmedizin, ist dabei essenziell. Frühzeitige Teambesprechungen und strukturierte Entscheidungsprozesse tragen dazu bei, die Indikation nicht zu spät zu stellen und die Therapiepotenziale optimal zu nutzen.
Bedeutung interdisziplinärer Versorgung
Die Versorgung neuropathischer Schmerzsyndrome erfordert einen kontinuierlichen Austausch innerhalb des Behandlungsteams. Besonders in der Palliativmedizin und Schmerztherapie ist die Sensibilisierung des gesamten Teams für moderne Therapieoptionen entscheidend. Die klinische Erfahrung zeigt, dass invasive Verfahren häufig zu spät in Betracht gezogen werden. Daher sollte bei persistierendem Schmerz trotz adäquater medikamentöser Therapie frühzeitig eine Vorstellung in einem spezialisierten Zentrum erfolgen, um geeignete Interventionen zu prüfen und rechtzeitig einzuleiten.
Herpes Zoster und postzosterische Neuralgie: Pathophysiologie, Therapie und Prävention
Pathophysiologie und klinische Manifestation
Beim Herpes Zoster liegt eine endogene Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus vor, das nach einer Primärinfektion (Windpocken) lebenslang in den Spinalganglien persistiert. Kausale Risikofaktoren für die Reaktivierung sind vor allem Stress, Immunsuppression, chronische Erkrankungen oder fortgeschrittenes Alter. Die Erkrankung manifestiert sich als schmerzhafter, meist einseitiger, dermatombezogenes Exanthem mit Blasenbildung. Der Hautausschlag kann in Einzelfällen auch fehlen. Am häufigsten ist der thorakolumbale Bereich betroffen, seltener treten zervikale oder kraniale Lokalisationen auf. Eine ophthalmische Beteiligung stellt eine Notfallsituation dar, da ein Zoster ophthalmicus unbehandelt zur Erblindung führen kann. Eine augenärztliche Mitbehandlung ist von Anfang an dringend erforderlich.
Akute Therapieziele und antivirale Behandlung
Die primären Therapieziele beim akuten Zoster bestehen in der Begrenzung der Virusreplikation, der Reduktion akuter Schmerzen und der Prävention einer postzosterischen Neuralgie, also bleibender Schmerzen im betroffenen Gebiet. Die antivirale Therapie sollte möglichst innerhalb von 72 Stunden nach Auftreten der Hautläsionen begonnen werden. Standardpräparate sind Aciclovir, Valaciclovir und Famciclovir. Bei älteren oder schluckgestörten Patienten kann Brivudin eine Alternative darstellen, das jedoch bei immunsupprimierten Patienten kontraindiziert ist. Bei schwerem Verlauf oder eingeschränkter oraler Einnahmefähigkeit kann Aciclovir auch intravenös appliziert werden.
Postzosterische Neuralgie: Chronifizierung und Symptomatik
Etwa 20 bis 50 % der Patienten >60 Jahren entwickeln eine postzosterische Neuralgie, meist wenn die akute Infektion nicht ausreichend oder zu spät behandelt wird. Charakteristisch sind brennende Dauerschmerzen, einschießende Schmerzattacken und ausgeprägte Allodynien. Häufig treten Schlafstörungen, depressive Symptome und Appetitlosigkeit auf. Residuale Parästhesien, Dysästhesien, Juckreiz und Narbenbildungen sind nicht selten.
Pharmakologische Therapie der postzosterischen Neuralgie
Die Behandlung der postzosterischen Neuralgie erfolgt multimodal. Zunächst kommen Co-Analgetika wie trizyklische Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Nortriptylin) oder SNRI (z. B. Duloxetin) zum Einsatz. Antikonvulsiva wie Gabapentin oder Pregabalin sind etablierte Alternativen. Bei unzureichender Wirkung kann eine Kombination mit Opioiden erwogen werden, wobei insbesondere Buprenorphin aufgrund geringerer zentralnervöser Nebenwirkungen und niedriger Sturzgefahr im Alter von Vorteil ist.
Topische Therapieansätze
Topische Behandlungsformen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Lidocain-Pflaster und hochdosierte Capsaicin-Pflaster (8 %) wirken über eine Natrium- bzw. TRPV1-Kanalblockade und können auch bei initialer Wirkungslosigkeit nach wiederholter Anwendung erfolgreich sein. Bei multimorbiden und älteren Patienten sind topische Optionen aufgrund ihres günstigen Nebenwirkungsprofils besonders geeignet. Auch 20%ige Ambroxol-Cremes zeigen in kleineren Studien analgetische Effekte bei neuropathischen Schmerzen, werden jedoch häufig gegenwärtig nicht von den Krankenkassen erstattet.
Interventionelle Verfahren
In ausgewählten Fällen, insbesondere bei schwersten, therapieresistenten Schmerzen, kann eine Blockade des Ganglion cervicale superius erwogen werden. Dabei wird unter Verwendung spezieller Nadelsysteme Buprenorphin injiziert, da Lokalanästhetika aufgrund der Nähe zur Medulla oblongata kontraindiziert sind.
Prävention und Impfempfehlungen
Die aktive Immunisierung mit dem Herpes-Zoster-Subunit-Totimpfstoff ist seit 2018 verfügbar und wird von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Sie ist in zwei Dosen im Abstand von zwei bis sechs Monaten zu verabreichen und auch bei Patienten mit vorangegangener Zoster-Infektion sinnvoll, da sie die Immunantwort verstärkt. Die Impfung wird allgemein ab dem 50. Lebensjahr sowie für immunsupprimierte Personen empfohlen.
Schmerztherapie bei Wirbelsäulenerkrankungen: Pathophysiologie, Pharmakotherapie und Sicherheitsaspekte
Pathophysiologie der lumbalen Spinalkanalstenose
Eine lumbale Spinalkanalstenose ist ein häufiges Mixed-Pain-Syndrom im höheren Lebensalter, verursacht durch strukturelle Veränderungen wie ossäre Hyperplasie, Facettengelenkarthrose oder Bandscheibendegeneration. Diese führen zur Spinalkanalverengung und Kompression neuraler Strukturen. Initial überwiegen nozizeptive Schmerzen durch mechanische und entzündliche Prozesse, im Verlauf treten neuropathische Anteile durch Nervenschädigung hinzu, was den Wirkverlust klassischer Analgetika wie Ibuprofen erklärt.
Pharmakologische Therapie
Die Behandlung richtet sich nach dem Schmerzmechanismus. Nozizeptive Schmerzen folgen dem Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation (WHO), während neuropathische Schmerzen Co-Analgetika wie trizyklische Antidepressiva, SNRI oder Antikonvulsiva (Gabapentin, Pregabalin) erfordern. Bei komplexen Fällen sind retardierte Opioide, bevorzugt Buprenorphin wegen seines günstigen Sicherheitsprofils im Alter, indiziert. Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR): NSAR sind bei entzündungsbedingten Schmerzen effektiv, aber durch kardiovaskuläre, renale und gastrointestinale Risiken eingeschränkt. Selektive COX-2-Hemmer (z. B. Celecoxib) und nicht selektive NSAR (z. B. Ibuprofen) zeigen vergleichbare kardiovaskuläre Komplikationsraten, insbesondere bei älteren oder vorbelasteten Patienten. Alternativen: Bei einem hohen Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) unter NSAR sind Metamizol oder Paracetamol geeignet. Paracetamol wirkt zentralanalgetisch, Metamizol zentralanalgetisch und peripher spasmolytisch, erfordert jedoch eine langsame Infusion wegen hypotensiver Effekte. Die seltene, aber schwere UAW der Agranulozytose bei Metamizol erfordert eine vorherige Patientenaufklärung über Symptome wie Fieber oder Halsschmerzen. Wenn diese auftreten, ist eine sofortige Blutbildkontrolle angezeigt. Pauschale regelmäßige Blutbildkontrollen sind jedoch meist nicht sinnvoll, da Agranulozytose insgesamt selten ist und nicht schleichend, sondern plötzlich auftritt. Kombinationen mit myelotoxischen Medikamenten (z. B. Methotrexat) sollten vermieden werden, um hämatologische Komplikationen zu minimieren. Langzeitanwendung von Opioiden bei chronischen nicht tumorbedingten Schmerzen (LONTS): LONTS bei chronischen Rückenschmerzen ist nur unter strenger Indikationsstellung einzusetzen; sie ist kontraindiziert bei somatoformen Schmerzen, primären Kopfschmerzen oder Opioidabhängigkeit. Retardierte Präparate wie Buprenorphin werden bevorzugt, eine regelmäßige Re-Evaluation ist obligat.
Opioidnebenwirkungen und Management
Die häufigste Komplikation bei der Langzeitanwendung von Opioiden ist die opioidinduzierte Obstipation (englisch „opioid-induced constipation”, OIC), die durch Aktivierung intestinaler µ-Opioidrezeptoren resultiert. Im Gegensatz zu zentralen Effekten bleibt eine Toleranzentwicklung leider meist aus. Andere häufige UAW sind vor allem Übelkeit, Schläfrigkeit, Schwindel, Pruritus und Erbrechen. Risikofaktoren für OIC und andere UAW umfassen insbesondere Alter, weibliches Geschlecht, Immobilität und Begleiterkrankungen. Die proaktive ärztliche Anamnese nach gastrointestinalen Symptomen ist essenziell, da Patienten diese aus Scham oft nicht spontan berichten. Obstipation ist dabei nur ein Teilaspekt eines breiteren Symptomenkomplexes der opioidinduzierten Darmdysfunktion. Neben Stuhlverhalt umfasst die OIC oftmals Inappetenz, Anorexie, einen gastro-ösophagealen Reflux, Übelkeit, Brechreiz, eine frühzeitige Sättigung, Völlegefühl, abdominale Schmerzen, Spasmen, Koliken, eine paradoxe Diarrhö, Blähungen und Hämorrhoidenblutungen. Die Diagnostik der OIC orientiert sich an den ROM-Kriterien. Eine multimodale Therapie, einschließlich ballaststoffreicher Ernährung, ausreichender Flüssigkeitszufuhr, Bewegung, Laxanzien (z. B. Macrogol) und peripher wirkender µ-Opioidrezeptorantagonisten (PAMORA, z. B. Naldemedin oder Naloxegol) oder Prokinetika wie Prucaloprid.
Minimalinvasive Verfahren
Minimalinvasive Techniken wie Facettenblockade, epidurale Injektionen oder „spinal cord stimulation” ermöglichen eine Opioiddosisreduktion. Bei therapierefraktären Schmerzen kann eine intrathekale Schmerzpumpe erwogen werden.
Multimodale Schmerztherapie
Die multimodale Schmerztherapie (MMST) kombiniert medizinische, physiotherapeutische und psychotherapeutische Ansätze zur funktionellen Wiederherstellung. Studien belegen eine hohe Effektivität: 87 % der Patienten mit chronischem Rückenschmerz kehren in den Arbeitsprozess zurück, >90 % der für Operationen geplanten Patienten konnten konservativ behandelt werden. Trotz hoher Wirksamkeit besteht in ländlichen Regionen eine Unterversorgung hinsichtlich MMST.
Fallbericht: Reduktion opioidinduzierter Nebenwirkungen durch adjuvante Cannabinoidtherapie bei postpoliomyelitischem Schmerz
Chronische neuropathische Schmerzen, wie sie etwa nach einer Poliomyelitis auftreten können, erfordern oft eine multimodale Therapie. Opioide bilden häufig die Basis, können jedoch bei älteren Patienten zu Kumulation und schweren UAW führen. Der folgende Fallbericht beschreibt die erfolgreiche Integration von Cannabinoiden als Add-on-Therapie zur Dosisreduktion von Opioiden.
Patient und Anamnese
Ein 63-jähriger Patient stellte sich mit chronischen Schmerzen beider Beine vor, verursacht durch ein Post-Polio-Syndrom nach Poliomyelitis im Kindesalter. Klinisch zeigten sich eine Fußheberschwäche sowie eine Muskelatrophie Chronifizierungsgrad 2. Komorbide Erkrankungen umfassten eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) mit erfolgter Stentimplantation in der Arteria iliaca externa rechts sowie rezidivierende depressive Episoden. Der Patient war unter hausärztlicher Betreuung mit folgender Medikation suffizient eingestellt: Metamizol 1 g viermal täglich, Morphinsulfat-Retard (MST) 40 mg morgens und abends sowie unretardiertes Morphinsulfat (MST) bei Bedarf (ca. 20 mg pro Woche). Die mittlere Schmerzintensität betrug 3/10 auf der numerischen Ratingskala (NRS). Der Patient war hochgradig therapieadhärent, hatte seit Jahren auf das Autofahren verzichtet und wies anfangs eine gute Alltagsaktivität auf.
Klinischer Verlauf und Diagnostik
Drei Monate nach Therapiebeginn entwickelte der Patient zunehmende Tagesmüdigkeit, Ein- und Durchschlafstörung, kognitive Beeinträchtigungen, Appetitverlust und eine Gewichtsabnahme von 15 kg. Aufgrund dieser Symptome wurde er in die schmerztherapeutische Ambulanz überwiesen. Eine umfassende Abklärung, einschließlich Tumor-Screening mit Gastro- und Koloskopie, ergab keine organischen Ursachen. Die Symptome wurden als opioidinduzierte Nebenwirkungen interpretiert, bedingt durch Kumulation des Morphins bei reduzierter Clearance im Alter.
Therapieanpassung
Die Opioiddosis wurde auf MST-Retard 10 mg morgens und abends reduziert. Ergänzend wurde eine Cannabinoidtherapie mit Dronabinol 2,5 mg pro Tag initiiert, dazu wurde Metamizol 500 mg viermal täglich verabreicht. Der Bedarf an unretardiertem MST entfiel vollständig.
Outcome und Follow-up
Unter der angepassten Therapie verbesserte sich der Nachtschlaf, der Appetit kehrte zurück, und es kam zu einer Gewichtszunahme von 5 kg. Die kognitiven Beeinträchtigungen waren rückläufig, und der Patient erlangte eine hohe Alltagsfunktion zurück. Er organisierte eigenständig einen Umzug in eine altersgerechte Wohnung und berichtete von einer signifikanten Steigerung der Lebensqualität.
Diskussion
Dieser Fall illustriert die Rolle von Cannabinoiden als Add-on in der Schmerztherapie: Sie ermöglichen eine Reduktion opioidassoziierter Nebenwirkungen, ohne einen ausreichenden analgetischen Effekt zu verlieren. Eine Monotherapie mit Cannabinoiden ist nicht indiziert; der Einsatz sollte kritisch und individualisiert erfolgen, um Übertherapien zu vermeiden.
Fazit
- Tumorassoziierte Schmerzen sind multifaktoriell und erfordern eine differenzierte, pathophysiologisch orientierte Therapie.
- Eine frühzeitige Erkennung und eine konsequente multimodale Behandlung verhindern Chronifizierung und Funktionsverlust.
- Neuropathische Komponenten, insbesondere bei chemotherapieinduzierter Polyneuropathie (CIPN), müssen gezielt adressiert werden
- Antikonvulsiva und trizyklische Antidepressiva bilden die Basis der medikamentösen Therapie bei CIPN.
- Topische Verfahren und supportive Maßnahmen können die Wirksamkeit erhöhen und Nebenwirkungen reduzieren.
- Bei therapierefraktären Fällen sind interventionelle Verfahren frühzeitig zu erwägen.
- Herpes Zoster und die postzosterische Neuralgie erfordern eine rasche antivirale Therapie und eine multimodale Schmerzbehandlung zur Prävention chronischer Verläufe.
- Die opioidinduzierte Obstipation (OIC) bleibt eine häufige und ernste Komplikation einer langfristigen Opioidtherapie.
Bildnachweis
Peter Heckmeier – Adobe Stock
Referenten
Prof. Dr. med. Stefan Wirz Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, Interdisziplinäre Intensivmedizin, Schmerzmedizin/Palliativmedizin – Zentrum für Schmerzmedizin Lehrbefugter an der Universitätsklinik Bonn Cura Krankenhaus eine Betriebsstätte der GFO Kliniken Bonn Schülgenstr. 15 53604 Bad Honnef Prof. Dr. med. Uwe Junker Arzt für Anästhesie, Spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin SAPV Remscheid GmbH Hammesberger Straße 5 42855 RemscheidInteressenkonflikte
Prof. Wirz: Vortrags- und Beratertätigkeiten in den vergangenen fünf Jahren: AstraZeneca, Dr. Kade, Grünenthal, Indivior, KYOWA KIRIN GmbH, Mundipharma, Pfizer, TEVA. Prof. Junker: Keine COI bezogen auf das Webinar laut PPTXSponsoring
ohne
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt