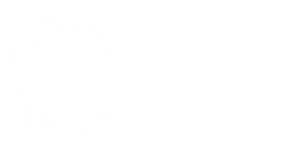Kardiale ATTR-Amyloidose: eine Erkrankung im Wandel
Am Ende der Fortbildung kennen Sie …
- pathophysiologische Grundlagen und Klinik der kardialen Transthyretin-Amyloidose,
- das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf eine kardiale Amyloidose,
- neue Therapieoptionen bei der kardialen Amyloidose,
- innovative Biomarker im Therapiemonitoring der kardialen Amyloidose.
Einleitung
Die Amyloidose ist eine seltene, aber potenziell schwerwiegende Systemerkrankung, bei der fehlgefaltete Proteine, sogenannte Amyloide, in Form unlöslicher Fibrillen extrazellulär im Gewebe abgelagert werden. Diese Ablagerungen beeinträchtigen die normale Organfunktion und können zu Multiorganversagen führen. Bislang sind >30 unterschiedliche amyloidogene Proteine beschrieben, die je nach biochemischer Struktur und Aggregationstendenz zu variablen Organmanifestationen führen können. Die klinische Erstmanifestation hängt wesentlich vom primär betroffenen Organsystem ab und bestimmt häufig die initiale Zuweisung in der medizinischen Versorgung. Die Ätiologie der kardialen Amyloidose ist überwiegend durch zwei Subtypen geprägt: In >98 % der Fälle handelt es sich entweder um eine Leichtketten-Amyloidose (AL) oder eine Transthyretin-Amyloidose (ATTR). Die AL-Amyloidose ist eine Plasmazellerkrankung, die typischerweise mit einem multiplen Myelom oder einer monoklonalen Gammopathie assoziiert ist. Pathogenetisch liegt eine Überproduktion fehlgefalteter Immunglobulin-Leichtketten vor, deren Nachweis diagnostisch essenziell ist. Demgegenüber steht die ATTR-Amyloidose, bei der Transthyretin (TTR) das Ausgangsprotein darstellt. Diese Form betrifft bevorzugt das Herz. Die kardiale Amyloidose bleibt trotz wachsender Evidenz eine häufig übersehene und unterdiagnostizierte Erkrankung. Epidemiologische Daten aus Deutschland zeigen, dass die Prävalenz der ATTR-Amyloidose insbesondere bei den >80-Jährigen zunimmt. Bei der ATTR-Amyloidose besteht eine konformationsbedingte Instabilität des physiologisch vorkommenden TTR-Tetramers, die entweder aufgrund genetischer Mutationen (hereditäre ATTR [ATTRv]) auftritt oder als Wildtyp-ATTR (ATTRwt) zunehmend mit dem Alter vorkommen kann. Die Dissoziation der Tetramere in Monomere fördert die Aggregation zu Amyloidfibrillen, die sich extrazellulär im Myokard ablagern und erhebliche strukturelle sowie funktionelle Veränderungen hervorrufen. Die unbehandelte ATTR-Amyloidose hat eine sehr ungünstige Prognose: Beobachtungsdaten legen eine Überlebensrate von lediglich 20 % nach 6,5 Jahren nahe.
Kardiale Manifestationen
Insbesondere im Frühstadium stellt die ATTR-Amyloidose eine diagnostische Herausforderung dar. Ein differenziertes Verständnis der diagnostischen Marker, der echokardiografischen „Red Flags” und der pathophysiologischen Mechanismen ist essenziell, um die kardiale Amyloidose frühzeitig zu identifizieren und adäquat zu behandeln. Im klinischen Alltag werden Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose häufig im Kontext einer Dyspnoe und erhaltener linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF) identifiziert. Für die kardiale ATTR-Amyloidose ist ein deutlich erhöhtes N-terminales pro Brain Natriuretisches Peptid (NT-proBNP) charakteristisch, meist >2000 pg/ml, wobei auch niedrigere Werte eine Amyloidose nicht ausschließen. Ein wichtiger Hinweis für eine ATTR-Amyloidose ist die Diskrepanz zwischen dem überproportional erhöhten NT-proBNP und der anfangs häufig noch erhaltenen linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF). Ein weiteres diagnostisches Warnzeichen kann im Ruhe-Elektrokardiogramm (EKG) vorzufinden sein: Bei etwa einem Drittel der Patienten mit kardialer Amyloidose liegt eine Niedervoltage-Konstellation vor, was bei gleichzeitig vorhandener linksventrikulärer Hypertrophie als Hinweis auf eine infiltrative Genese gewertet werden sollte. Im Gegensatz zu hypertensiv bedingter Myokardhypertrophie, bei der eine Zunahme der QRS-Amplituden zu erwarten wäre, sprechen verminderte elektrische Potenziale (z. B. ein niedriger Sokolow-Lyon-Index) trotz verdickter Ventrikelwände gegen eine rein hypertensive Genese. Pathophysiologisch werden hierfür verschiedene Mechanismen diskutiert, unter anderem eine dämpfende Wirkung eines eventuell vorhandenen Perikardergusses sowie die Expansion des extrazellulären Raumes durch Amyloidablagerungen, die die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigen. In Einzelfällen kann bei ausgeprägter Kachexie eine paradoxe Zunahme der QRS-Amplituden beobachtet werden. Darüber hinaus besteht eine relevante Assoziation zwischen der kardialen Amyloidose und der Aortenklappenstenose (AS). Histopathologische Untersuchungen zeigten, dass Amyloidablagerungen auch im valvulären Gewebe der Aorten- und Mitralklappe vorkommen und möglicherweise eine Verkalkung auslösen. Studien an Patienten, die sich einer Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) unterzogen haben, zeigen, dass etwa einer von acht Betroffenen eine zusätzliche ATTR-Amyloidose aufweist. Bei Patienten mit AS und begleitender ATTR-Amyloidose ist die TAVI-Prozedur trotz der Grunderkrankung sicher durchführbar und mit einer deutlichen prognostischen Verbesserung assoziiert. Die „number needed to treat” (NNT) zur Verhinderung eines Todesfalles liegt Schätzungen zufolge bei lediglich 3 (das heißt, drei Patienten müssen behandelt werden, um einen Todesfall zu verhindern). Eine indizierte TAVI sollte diesen Patienten also keinesfalls vorenthalten werden. Es ist allerdings wichtig, dass anschließend auch eine Evaluation hinsichtlich einer spezifischen Amyloidose-Therapie erfolgt. Nicht zuletzt sind auch Herzrhythmusstörungen, insbesondere Vorhofflimmern, als häufiges klinisches Korrelat der ATTR-Amyloidose zu beachten. In vielen Fällen erfolgt die Behandlung zunächst symptomorientiert mit Antikoagulation, Kardioversion oder Pulmonalvenenisolation, ohne dass die zugrunde liegende infiltrative Kardiomyopathie erkannt wird. Ein weiterer häufiger Befund im Rahmen der ATTR-Amyloidose ist der Perikarderguss, dessen Ausprägung im Krankheitsverlauf zunehmen kann. Wiederholte echokardiografische Untersuchungen zeigen teils eine progrediente Zunahme des Ergussvolumens über mehrere Jahre. Therapeutische Maßnahmen wie Perikardpunktion oder eine antiinflammatorische Behandlung (z. B. mit Colchicin oder nicht steroidalen Antirheumatika) sind bei einem durch Amyloidose bedingten Erguss in der Regel nicht wirksam. Ein ausgedehnter Perikarderguss gilt als Ausdruck einer fortgeschrittenen Erkrankung und ist prognostisch sehr ungünstig.
Extrakardiale Manifestationen als diagnostische Hinweise
Im Rahmen der klinischen Untersuchung sollte neben typischen Hinweisen auf eine Herzinsuffizienz, wie Dyspnoe und Ödeme, zusätzlich auf extrakardiale Hinweise wie Operationsnarben nach Karpaltunnelsyndrom geachtet werden. Muskuloskelettale Manifestationen der Amyloidose können Jahre vor einer kardialen Symptomatik auftreten. Dies gilt v. a. für die ATTR-Amyloidose. Besonders relevant ist hierbei das Karpaltunnelsyndrom. Studien zeigen, dass bis zu 60 % der Betroffenen zum Zeitpunkt der Diagnose einer ATTR-Amyloidose bereits eine Karpaltunneloperation durchlaufen haben. Daten aus Registerstudien, z. B. aus Dänemark, zeigen, dass umgekehrt ca. 10 % der Patienten mit Karpaltunnelsyndrom im Langzeitverlauf eine klinisch manifeste Amyloidose entwickeln. Andere muskuloskelettale Manifestationen wie eine spontane Bizepssehnenruptur oder eine lumbale Spinalkanalstenose können ebenfalls Hinweise auf eine zugrunde liegende Amyloidose sein. Dies wird bislang im kardiologischen Alltag zu selten beachtet. Eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere mit Handchirurgie und Orthopädie, erscheint hier sinnvoll. Eine histologische Aufarbeitung nach orthopädischen operativen Eingriffen, insbesondere bei Karpaltunnelsyndrom oder Spinalkanalstenose, kann ein wichtiges Instrument zur Identifikation präklinischer oder asymptomatischer Formen der kardialen ATTR-Amyloidose sein. In einer Kohorte operierter Patienten mit Spinalkanalstenose ließ sich bei etwa 13 % histologisch eine ATTRwt-Amyloidose nachweisen. Bei histologisch gesicherter Amyloidablagerung im muskuloskelettalen Gewebe sollte zeitnah eine kardiologische Abklärung erfolgen. Bei initial unauffälligen kardiologischen Befunden kann ein strukturiertes Verlaufsmonitoring in definierten Abständen sinnvoll sein, z. B. im Abstand von ein bis zwei Jahren. Ein weiterer potenzieller Hinweis auf eine präklinische kardiale ATTR-Amyloidose ergibt sich aus der histologischen Untersuchung von Prostatagewebe. In älteren Studien fanden sich bei etwa 11 % der Männer mit Prostatabiopsie Amyloidablagerungen, zumeist vom ATTR-Typ. Langzeitbeobachtungen zeigten, dass bis zu 40 % dieser Männer im weiteren Verlauf eine klinisch manifeste Herzinsuffizienz entwickelten.
Echokardiografie
Die Echokardiografie ist ein wichtiges diagnostisches Instrument für die Abklärung einer kardialen ATTR-Amyloidose. Die Interpretation ist allerdings herausfordernd. Die meisten Betroffenen erfüllen bei Erstdiagnose die formalen Kriterien einer Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion (HFpEF). In der klinischen Praxis erfolgt jedoch häufig keine konsequente Dokumentation dieses Befundes. Dies spiegelt unter anderem die lange Zeit von unzureichend definierten und sich kontinuierlich weiterentwickelnden Kriterien der HFpEF wider. Auch in der aktuellen Leitlinie der European Society of Cardiology (ESC) bleibt die Definition der HFpEF eher unspezifisch. Bislang wurde die ESC-Definition noch in keiner der einschlägigen Studien zur HFpEF angewendet. Dennoch ist es üblich, sich bei der klinischen Dokumentation an der ESC-Definition oder am H2FPEF-Score zu orientieren. Eine präzise Kodierung nach ICD-10 ist aufgrund der fehlenden Adaptation der Kodierung trotz neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ebenfalls nicht möglich. In der Praxis erfolgt häufig die Kodierung unter I50.9 („Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet”) oder I11.9 („Hypertensive Herzkrankheit ohne Angabe einer Herzinsuffizienz”), was zu Missverständnissen und einem Informationsverlust beitragen kann. Es muss beachtet werden, dass sich keineswegs alle Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose mit vorbeschriebener HFpEF vorstellen. Eine Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) kann bei Erstdiagnose ebenfalls vorliegen und in Einzelfällen sogar die Erstmanifestation der kardialen ATTR-Amyloidose darstellen. Vor allem die Beurteilung der systolischen Funktion mittels Echokardiografie ist bei ausgeprägter myokardialer Hypertrophie fehleranfällig. Zudem spiegelt die EF (Ejektionsfraktion) den Schweregrad der Herzerkrankung bei kardialer ATTR-Amyloidose oft unzureichend wider. Alternative Parameter wie die Strain-Analyse (longitudinale Deformation) können eine differenziertere Beurteilung ermöglichen. Die morphologische echokardiografische Beurteilung bietet mehrere typische, wenngleich nicht pathognomonische Befunde („Red Flags”), die gezielt erfasst und dokumentiert werden sollten. Dazu gehören eine symmetrische Wandverdickung mit „Sparkling”-Myokard, eine Verdickung der Herzklappen, ein verdicktes interatriales Septum sowie ein vergrößerter linker Vorhof. Zudem kann ein Perikarderguss vorhanden sein. Die ESC-Klassifikation der Kardiomyopathien orientiert sich an fünf überlappenden Phänotypen: hypertroph, dilatiert, restriktiv, arrhythmogen und nicht klassifizierbar. Die kardiale ATTR-Amyloidose lässt sich nicht streng einer dieser Kategorien zuordnen, sondern ist vielmehr im Übergangsbereich zwischen hypertropher und restriktiver Kardiomyopathie zu verorten. Hierbei spielt die zeitliche Dynamik ebenfalls eine Rolle. Ein anfangs rein hypertrophes Muster kann zunehmend in ein restriktives übergehen. Im Rahmen der Strain-Analyse fällt teilweise das sogenannte „apical sparing” auf, ein Erhalt der apikalen Kontraktilität bei reduzierter basaler Myokardkontraktion. Dieses Muster korreliert mit der Amyloidlast im Myokard, ist jedoch nicht bei allen Patienten nachweisbar. Differenzialdiagnostisch kann es zudem auch bei anderen Herzerkrankungen (u. a. bei Aortenklappenstenose) auftreten und ist somit nicht spezifisch. Weitere Hinweise auf eine kardiale ATTR-Amyloidose ergeben sich aus der Gewebecharakterisierung sowie aus der diastolischen Funktionsanalyse, unterstützt durch die klinische Chemie: Eine restriktive Füllung mit hohem E/A-Verhältnis (>2 : 1), ein erhöhtes E/E’-Verhältnis (>20) und ein deutlich erhöhter NT-proBNP-Wert gelten als typische Befunde. Die longitudinale systolische Funktion ist oft früher betroffen als die radiale, was sich visuell im Vierkammerblick an einer fehlenden longitudinalen Verkürzung des linken Ventrikels und in der longitudinalen Strain-Analyse erkennen lässt. Amyloidablagerungen im Vorhofmyokard führen zu fibrotischen Veränderungen, erhöhter Steifigkeit und einem proarrhythmogenen Remodelling. Über die konventionelle echokardiografische Diagnostik hinaus stellt die Analyse der linksatrialen Myokarddeformation („left atrial strain”, LA-Strain) einen zunehmend wichtigen Parameter zur Beurteilung der atrialen Funktion dar. Der links atriale Reservoir-Strain (LA-Reservoir-Strain), der die Dehnbarkeit des linken Vorhofes in der systolischen Füllungsphase widerspiegelt, beträgt bei gesunden Personen typischerweise 40 %. Bei Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose zeigen sich hingegen häufig deutlich reduzierte Werte. In Einzelfällen wurden Werte <7 % beschrieben, was auf eine deutlich fortgeschrittene Infiltration des Vorhofmyokards hindeutet. Ein niedriger Vorhof-Strain geht mit einer schlechteren Prognose einher. In prospektiven Beobachtungsstudien war eine ausgeprägte Reduktion des LA-Strains mit einer signifikant erhöhten Mortalität assoziiert. Der Vorhof-Strain eignet sich potenziell sowohl zur Risikostratifizierung als auch zur Verlaufsbeurteilung unter Therapie. Es werden allerdings weitere Daten benötigt. Die Erhebung erfolgt in der Regel automatisiert und ist auch retrospektiv mit gespeicherten Bilddatensätzen noch möglich. Während einzelne Studien eine differenzierte Analyse der Komponenten des LA-Strains (Reservoir-, Konduit- und kontraktile Funktion) anstreben, gilt der globale LA-Reservoir-Strain derzeit als etablierter Parameter mit ausreichend prognostischer Aussagekraft für die klinische Routine. Die Datenlage basiert bislang überwiegend auf kleineren Kohortenstudien, eine Validierung in größeren multizentrischen Kollektiven steht gegenwärtig aus. Der linksatriale Strain gilt als sensitiver Marker für frühe funktionelle Veränderungen und zeigt möglicherweise eine engere Korrelation zur Belastbarkeit als klassische Parameter wie der linksatriale Volumenindex (LAVI) oder diastolische Füllungsindices.
Knochenszintigrafie
Die Knochenszintigrafie mit knochenspezifischen Tracern wie 99mTc-DPD oder 99mTc-PYP hat sich in den letzten Jahren als primäres Instrument in der Diagnostik der kardialen ATTR-Amyloidose etabliert. Während bei gesunden Kontrollpersonen eine regelrechte Anreicherung des Tracers ausschließlich im Skelettsystem zu beobachten ist, zeigt sich bei Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose eine pathologische Tracer-Anreicherung im Myokard. Die Intensität der kardialen Tracer-Aufnahme korreliert mit dem Ausmaß der Amyloidablagerung und kann semi-quantitativ anhand des Perugini-Scores graduiert werden (Grad 0 bis 3). Der Perugini-Score liefert somit wichtige Informationen zu Diagnose und Krankheitsstadium. Rückblickend wirkt es kurios, dass kardiale Tracer-Anreicherungen im Knochenszintigramm früher oft als Zufallsbefund gewertet wurden, ohne dass eine weitere diagnostische Abklärung erfolgte. Inzwischen gilt die Knochenszintigrafie bei entsprechender klinischer Fragestellung als hochspezifisches nicht invasives Diagnoseverfahren für die kardiale ATTR-Amyloidose. Um sicherzustellen, dass ein geeigneter Tracer verwendet wird, sollte bereits in der Anforderung explizit der Verdacht auf ATTR-Amyloidose angegeben werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Untersuchung korrekt durchgeführt und interpretiert wird.
Kardiale Magnetresonanztomografie
Die kardiale Magnetresonanztomografie (Kardio-MRT) stellt ein nicht invasives Verfahren ohne Strahlenbelastung dar und wird aufgrund ihrer hohen Gewebeauflösung immer häufiger in der Diagnostik der kardialen ATTR-Amyloidose eingesetzt. Die Kardio-MRT stellt eine wertvolle Ergänzung und zunehmend auch Alternative zur Knochenszintigrafie dar. Der diagnostische Stellenwert des Kardio-MRT wurde in multizentrischen Studien bestätigt, die im direkten Vergleich zur Knochenszintigrafie eine höhere Detektionsrate nachweisen konnten. Dies gilt insbesondere für Patienten mit einem niedrigen Perugini-Score. Eine diffuse Kontrastmittelanreicherung in beiden Ventrikeln sowie in den Vorhofwänden wird als spezifisch für eine kardiale ATTR-Amyloidose angesehen. Untersuchungen zeigen, dass die Kombination dieses MRT-Befundes mit unauffälliger Leichtkettenanalytik eine Spezifität von 98 % für die Diagnose einer kardialen ATTR-Amyloidose erreicht. Die frühe Detektion stellt jedoch auch für die Kardio-MRT weiterhin eine große Herausforderung dar. Während strukturelle Veränderungen in fortgeschrittenen Stadien deutlich erkennbar sind, bleiben sie in frühen Krankheitsphasen häufig subtil und können leicht übersehen werden.
Diagnosesicherung
Die Endomyokardbiopsie mit Histologie ist indiziert zur Diagnosesicherung der kardialen ATTR-Amyloidose, wenn die nicht invasive Diagnostik keine eindeutigen Ergebnisse ergibt. Mithilfe einer endomyokardialen Biopsie lassen sich amyloide Ablagerungen direkt im Herzmuskel nachweisen. Spezielle Färbetechniken machen die typischerweise diffusen und homogenen Ablagerungen im Extrazellulärraum sichtbar. Angesichts der diagnostischen Komplexität und der weitreichenden therapeutischen Konsequenzen sollte bei Verdacht auf ATTR-Amyloidose mindestens einmal eine Vorstellung in einem spezialisierten Amyloidose-Zentrum erfolgen. Dort kann durch ein interdisziplinäres Team sowohl die Diagnose gesichert werden als auch die individuelle Therapieplanung erfolgen. Hierbei sind natürlich die jeweiligen regionalen Versorgungsstrukturen zu beachten.
Therapie
Allgemeine Therapie der Herzinsuffizienz
Unabhängig von einer spezifischen krankheitsmodifizierenden Therapie sollte bei Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose die leitliniengerechte Behandlung der Herzinsuffizienz nicht vernachlässigt werden. Ebenso müssen etwaige andere Komorbiditäten berücksichtigt und leitliniengerecht behandelt werden. Die diuretische Therapie stellt eine zentrale Säule der Behandlung bei kardialer ATTR-Amyloidose mit symptomatischer Herzinsuffizienz dar. Daneben scheint ein Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist sinnvoll zu sein, wohingegen ACE-Hemmer keinen nachgewiesenen Nutzen haben. Insbesondere bei Vorliegen einer symptomatischen Herzinsuffizienz mit HFpEF kann eine begleitende medikamentöse Therapie mit „sodium glucose-linked transporter 2”-(SGLT-2-)Inhibitoren erwogen werden. Registerdaten deuten auf einen potenziellen klinischen Nutzen hin: In einer 2023 publizierten Kohortenanalyse war die Einnahme eines SGLT-2-Inhibitors bei Amyloidose-Patienten mit einer manifesten Herzinsuffizienz mit einer besseren Prognose verbunden, v. a. mit einer reduzierten Inzidenz der kardialen Dekompensation. Die Datenlage für den Einsatz in asymptomatischen Stadien ist jedoch derzeit unzureichend, weshalb eine routinemäßige Anwendung in dieser Gruppe aktuell nicht empfohlen werden kann. Die Therapie mit SGLT-2-Inhibitoren stellt zudem keine Alternative zur spezifischen Amyloidose-Therapie dar, sondern kann als ergänzender Baustein in der symptomorientierten Behandlung betrachtet werden.
Spezifische Therapie der kardialen ATTR-Amyloidose
RNA-Silencer
Vutrisiran ist ein „small interfering” Ribonukleinsäure-(siRNA-)basierter Wirkstoff, der gezielt die Messenger-RNA (mRNA) von TTR abbaut und dadurch die endogene TTR-Proteinproduktion reduziert. Der Wirkmechanismus zielt somit auf den Kausalmechanismus der ATTR-Amyloidose ab. Die HELIOS-B-Studie untersuchte die Wirksamkeit von Vutrisiran bei Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose über einen Zeitraum von bis zu 42 Monaten. In der doppelblinden Studienphase mit anschließender Open-Label-Extension zeigte sich unter Vutrisiran im Vergleich zu Placebo eine signifikante Reduktion der Gesamtmortalität und der kardiovaskulären Mortalität. Zudem kam es zu einer deutlichen Senkung kardiovaskulärer Ereignisse, einschließlich Hospitalisierungen und Notfallvorstellungen aufgrund von Herzinsuffizienz (kombinierter Endpunkt; Hazard Ratio [HR] 0,67, 95%-Konfidenzintervall 0,47–0,96). Diese Effekte traten unabhängig von einer begleitenden Tafamidis-Therapie auf (ca. 40 %). Vutrisiran ist bereits für die Behandlung der hereditären ATTR-(hATTR-)Polyneuropathie im Stadium 1 und 2 zugelassen und zeigte in klinischen Studien eine signifikante Verbesserung der neurologischen Funktion.
TTR-Stabilisatoren Acoramidis und Tafamidis
Zur Verhinderung des TTR-Tetramer-Zerfalles stehen die TTR-Stabilisatoren Acoramidis und Tafamidis zur Verfügung. Tafamidis ist bereits seit 2019 im klinischen Einsatz, und seine Wirksamkeit wurde durch zahlreiche Studien belegt. Seit Februar 2025 ist mit Acoramidis ein neuer TTR-Stabilisator zugelassen. Damit stehen nun zwei vergleichbare Wirkstoffe zur Verfügung, die das Therapieprinzip der TTR-Stabilisierung unabhängig voneinander bestätigt haben. In-vitro-Studien weisen auf eine höhere Tetramer-Stabilisierung und höhere Bindungsaffinität für Acoramidis im Vergleich zu Tafamidis hin. Präklinische Daten aus dieser Studie zeigen, dass unter Acoramidis eine nahezu vollständige Tetramer-Stabilisierung erzielt werden kann. Während unter Tafamidis eine Stabilisierung von etwa 50 % erreicht wird, was bereits mit einer Verlangsamung des Krankheitsverlaufes assoziiert ist, deuten erste Daten zu Acoramidis auf eine Tetramer-Stabilisierung von bis zu 100 % hin. Es handelt sich hierbei nicht um einen direkten Head-to-Head-Vergleich beider Substanzen innerhalb einer klinischen Studie, sondern um Daten aus präklinischen Analysen sowie klinischen Studien. Die Kombination aus Acoramidis und Tafamidis scheint im Vergleich zur Monotherapie mit Acoramidis nicht zu einer zusätzlichen TTR-Stabilisierung zu führen. In der Phase-III-Studie ATTRibute-CM wurde Acoramidis-Hydrochlorid (800 mg zweimal täglich) über einen Zeitraum von 30 Monaten bei Patienten mit kardialer ATTR-Amyloidose untersucht. Im Vergleich zu Placebo zeigte sich unter Acoramidis ein signifikant besseres Ergebnis im hierarchisch zusammengesetzten primären Endpunkt, der Mortalität, Morbidität sowie funktionelle Parameter einschloss. So zeigte sich eine 35,5%ige Abnahme des Risikos für die Kombination aus Gesamtmortalität oder erstmaliger kardiovaskulär bedingter Hospitalisierung (HR 0,65). Die Überlebenskurven trennten sich ab Monat 3 und gingen danach bis Monat 30 stetig auseinander. Die Open-Label-Verlängerungsphase der ATTRibute-CM-Studie untersuchte den langfristigen Effekt einer kontinuierlichen Therapie mit Acoramidis im Vergleich zu einem späten Wechsel von Placebo auf Acoramidis. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Überlebensvorteil zugunsten der kontinuierlich mit Acoramidis behandelten Patientengruppe. Die Analyse ergab eine relative Risikoreduktion der Gesamtmortalität um 36 % im Vergleich zur Placebogruppe mit späterer Umstellung auf Acoramidis. Diese Daten unterstreichen zudem die prognostische Relevanz einer frühzeitigen Therapieeinleitung. Ein Direktvergleich zwischen Acoramidis und Tafamidis hinsichtlich klinischer Ergebnisse liegt bislang nicht vor. Daten zur Umstellung der Therapie zwischen Tafamidis und Acoramidis liegen nicht vor. Derzeit wird ein neues Studienprogramm durchgeführt, das gezielt die Dynamik verschiedener Biomarker, darunter auch Serum-TTR, im Verlauf einer medikamentösen Umstellung von Tafamidis auf Acoramidis untersucht.
TTR-Depletoren und -Antikörper
NI006 und PRX-004 sind monoklonale Antikörper, die fehlgefaltetes TTR erkennen und eliminieren, wodurch Amyloidablagerungen reduziert werden. AT-02 bindet an TTR und verhindert dessen Aggregation, was zur Verlangsamung der Krankheitsprogression beiträgt. In einer Phase-I-Studie wurde die kardiale Wirkung von NI006 nach vier Monaten Therapie mittels Kardio-MRT evaluiert. Der initial hohe mittlere extrazelluläre Volumenanteil (ECV) von 60 % sank unter Behandlung auf 49 % nach vier Monaten und auf 41,6 % nach zwölf Monaten. Derzeit laufen Phase-II- und Phase-III-Studien zur Evaluierung der Wirksamkeit der Antikörper auf kardiovaskuläre Endpunkte bei Patienten mit fortgeschrittener ATTR-Amyloidose.
Prognostische Biomarker
Erhöhte NT-proBNP-Spiegel und die Notwendigkeit einer Intensivierung der Diuretikatherapie gelten als bewährte klinische Marker für eine Krankheitsprogression bei kardialer ATTR-Amyloidose. Darüber hinaus ist eine Reduktion der 6-Minuten-Gehstrecke um >35 m mit einem um 80 % erhöhten Mortalitätsrisiko über einen Zeitraum von 60 Monaten assoziiert. Zur prädiktiven Bewertung und zum Monitoring des Therapieansprechens unter Acoramidis wurden verschiedene Biomarker und klinische Parameter in klinischen Studien untersucht. Eine Stabilisierung der NT-proBNP-Spiegel konnte unter Acoramidis und Tafamidis im Vergleich zu Placebo nachgewiesen werden. Zudem zeigten sich eine Verbesserung der 6-Minuten-Gehstrecke sowie eine geringere Abnahme im Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) im Vergleich zu Placebo. Darüber hinaus wurde ein anhaltender Anstieg des TTR-Serumspiegels am Tag 28 unter Acoramidis im Vergleich zu Placebo beobachtet. Diese Parameter könnten potenziell auch in der klinischen Praxis zur Beurteilung des Therapieverlaufes herangezogen werden. Es bedarf jedoch noch weiterer Validierung. Die Messung von Serum-TTR-Spiegeln gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zwar handelt es sich bislang nicht um einen standardisierten Laborparameter im klinischen Alltag, jedoch zeigen erste Daten, dass die TTR-Konzentration als krankheitsspezifischer Biomarker nutzbar bei der kardialen ATTR-Amyloidose sein könnte. Der TTR-Serumspiegel könnte v. a. bei der Beurteilung des Therapieansprechens auf eine spezifische Amyloidose-gerichtete Therapie helfen. Im Gegensatz zu konventionellen Parametern wie NT-proBNP, die unspezifisch die kardiale Funktion wiedergeben, bietet TTR potenziell eine krankheitsspezifische Aussagekraft, die den zugrunde liegenden pathophysiologischen Prozess betrifft. Ein erniedrigter TTR-Serumspiegel zeigt eine verstärkte Amyloidablagerung an, was mit einer ungünstigeren Prognose einhergeht. In einer Studie zum Gesamtüberleben unbehandelter Patienten mit einer ATTRwt-Kardiomyopathie zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen TTR-Serumspiegel und Prognose: Patienten mit TTR-Serumkonzentrationen <18 mg/dl (Normwert) wiesen innerhalb von acht Jahren eine etwa doppelt so hohe Mortalität auf wie jene mit Werten oberhalb dieses Schwellenwertes. Eine Post-hoc-Analyse der ATTRibute-CM-Studie zeigte, dass ein Anstieg des stabilisierten TTR-Serumspiegels um 5 mg/dL am Tag 28 nach Therapiebeginn mit einer Reduktion des Gesamtmortalitätsrisikos um nahezu 31 % assoziiert war. In einer weiteren Auswertung wurde ein Zusammenhang zwischen einer Zunahme des stabilisierten TTR um jeweils 1 mg/dL am Tag 28 und einer Reduktion des kardiovaskulären Mortalitätsrisikos um etwa 5,5 % sowie einer Senkung des Risikos einer erstmaligen kardiovaskulären Hospitalisierung um 4,1 % beschrieben. Die Etablierung eines standardisierten und validierten Assays zur Bestimmung des stabilisierten TTR gestaltet sich derzeit jedoch schwierig, da Referenzbereiche und Messmethoden zwischen verschiedenen Laboren und Testsystemen zum Teil erhebliche Unterschiede aufweisen.
Fazit
- Die kardiale ATTR-Amyloidose ist unterdiagnostiziert und tritt häufiger auf als bisher angenommen.
- Extrakardiale Manifestationen wie Karpaltunnelsyndrom oder Spinalkanalstenose können der kardialen Beteiligung Jahre vorausgehen und bieten eine diagnostische Chance im Frühstadium.
- Typische echokardiografische Befunde wie symmetrische Hypertrophie, „apical sparing” und reduzierter Vorhof-Strain sollten gezielt erhoben werden.
- Eine frühzeitige interdisziplinäre Diagnostik in spezialisierten Zentren ist entscheidend für den Therapieerfolg und sollte bei begründetem Verdacht initiiert werden.
- Die Dissoziation des Transthyretin-(TTR-)Tetramers in Monomere, die sich fehlgefaltet im Anschluss als Amyloid ablagern, stellt einen zentralen pathogenetischen Mechanismus dar.
- Eine reduzierte Amyloidbildung steht in direktem Zusammenhang mit einem günstigeren klinischen Verlauf.
- Die pharmakologische Stabilisierung des TTR-Tetramers kann die Bildung amyloidogener Monomere vermindern und stellt somit ein zentrales spezifisches Therapieziel dar.
- Ein Anstieg des TTR-Serumspiegels ist mit einer Reduktion des kardiovaskulären Risikos und mit einem besseren Überleben assoziiert.
- Moderne krankheitsspezifische Therapien wie TTR-Stabilisatoren, RNA-Silencer und monoklonale Antikörper können die Prognose und die Lebensqualität verbessern.
- Die Messung von Serum-TTR als Biomarker gewinnt an Bedeutung für das Therapiemonitoring.
Bildnachweis
MrPanya – Adobe Stock
Referenten
PD Dr. Daniel Lavall Oberarzt Klinik und Poliklinik für Kardiologie Uniklinik Leipzig Liebigstraße 20 04103 Leipzig. Prof. Dr. Fabian Knebel Chefarzt Sana Klinikum Lichtenberg Innere Medizin II: Kardiologie Fanningerstraße 32 10365 Berlin Prof. Dr. med. Frank Edelmann Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin Campus Virchow Klinikum Mittelallee 11 13353 BerlinInteressenkonflikte
Prof. Knebel: Amicus, Pfizer, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Chiesi, Takeda, BMS, Canon, TomTec, Bracco, Novartis, Zoll, Philips, Bride Bio, Boston Scientific Prof. Edelmann: Bayer, Merck, Vifor Pharma, PharmaCosmos, NovoNordisc, AstraZeneca, Böhringer Ingelheim, Novartis, BerlinChemie, Biotronik, Medtronic, Amgen PD Dr. Lavall: Bayer, Pfizer, Boehringer, Alnylam, AstraZeneca, BMSSponsoring
Diese Fortbildung wurde im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit 14.900 EUR durch die Bayer Vital GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt