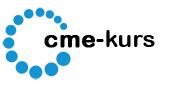Einteilung Epilepsie und Migräne
Eine empfehlenswerte Einführung in das Thema Epilepsie und Migräne bietet die Übersichtsarbeit von Sharyl Haut und Kollegen aus dem Jahr 2006. Die Autoren beschreiben Epilepsie und Migräne konzeptuell als chronische Erkrankungen mit episodischer Manifestation. Die Inzidenz dieser beiden neurologischen Erkrankungen ist vergleichsweise hoch, während andere Leiden, wie Cluster-Kopfschmerzen oder episodische Ataxie deutlich seltener vorkommen. Die Forscher beleuchten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Epilepsie und Migräne, die bis heute weitestgehend Bestand haben. [1]
Im Folgenden werden die Themen Epidemiologie, Genetik und Pathophysiologie sowie therapeutische Konzepte bei Epilepsie und Migräne näher beleuchtet.
Epidemiologie
Die Prävalenz der Migräne beträgt etwa 12 Prozent, während Epilepsie nur in etwa 0,7 Prozent der Patienten vorkommt. Migräne ist demnach etwa 20-mal häufiger als Epilepsie. [1,2]
Der Krankheitsbeginn, die Aktivitätsmuster der Erkrankung und die Geschlechterverteilung bei Migräne und Epilepsie unterscheiden sich deutlich. Abbildung 1 zeigt auf der linken Seite die Inzidenz der Migräne in Blau und die Prävalenz der Migräne in Rot. Bei der Migräne steigt die Punktprävalenz, also die Inzidenz von Kopfschmerzen innerhalb der letzten zwölf Monate, ab der Pubertät an. Mit dem 60. Lebensjahr fällt die Punktprävalenz wieder ab. In den aktivsten Lebensabschnitten ist die Migräne am stärksten ausgeprägt und es ereignen sich die meisten Attacken. Des Weiteren gibt es einen deutlichen Geschlechtsunterschied: Frauen sind etwa doppelt bis dreimal so häufig betroffen wie Männer.
Im rechten Teil der Abbildung ist das Auftreten der Epilepsie nach Patientenalter dargestellt. Die Kurven sind deutlich komplexer als bei der Migräne und zeigen für die Inzidenz einen umgekehrten Verlauf. Eine besonders hohe Inzidenz besteht in den ersten fünf bis zehn Lebensjahren (blaue Kurve). Danach treten bis zum 60. Lebensjahr relativ selten neue Epilepsien auf, danach steigt die Kurve wieder an. Die Prävalenz (rote Kurve) der Epilepsie lässt sich nicht mit der Punktprävalenz der Migräne vergleichen. Selbst anfallsfreie Patienten, unter medikamentöser Therapie, gelten noch als Epilepsie-Patienten. Im mittleren Lebensalter bleibt die Prävalenz relativ konstant, weil einige Patienten lange anfallsfrei sind und keine Medikamente mehr einnehmen.
Die Geschlechtsverteilung der Epilepsie zeigt keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Patienten.
Welche Kosten verursachen unterschiedliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems und welche ökonomischen Auswirkungen haben insbesondere Epilepsie und Migräne?
In einer Metaanalyse haben Gustavsson und Kollegen Kostenschätzungen des Jahres 2004 mit denen des Jahres 2010 für Europa verglichen. Betrachtet wurden nur die direkten Kosten, ohne Diagnosekosten, Krankheitstage und Ausfallskosten. Tabelle 1 zeigt die Kosten der Versorgung mit Medikamenten und Krankenhausaufenthalte pro Millionen Patienten, pro Einzelpatient und die absoluten Gesamtkosten. [3]
Die Untersuchung bestätigt die um den Faktor 20 unterschiedliche Prävalenz: in Europa leiden schätzungsweise 2,6 Millionen Patienten an Epilepsie und etwa 50 Millionen unter Migräne. Hinsichtlich der Kosten zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Erkrankungen. Epilepsie erzeugt etwa um den Faktor 13 höhere Medikamentenkosten. Auch kommt es unter Epilepsie häufiger zu Krankenhausaufenthalten im Vergleich zu Migräne. Pro Patient fallen bei Epilepsie etwa 5.200 Euro an, und nur etwa 370 Euro für Migräne.
Die höchsten Kosten verursachen psychiatrische Erkrankungen, insbesondere affektive Störungen, gefolgt von Demenz, Abhängigkeitserkrankungen und Angststörungen.
Im Rahmen einer Studie wurden 201 Epilepsiepatienten untersucht, von denen jeder dritte über einen periiktalen Kopfschmerz klagte. Unter dem Begriff periiktale Kopfschmerzen werden präiktale und postiktale Kopfschmerzen zusammengefasst. Präiktale Kopfschmerzen beginnen innerhalb von 24 Stunden vor dem Anfall, postiktale innerhalb von 24 Stunden nach dem Anfall. In der Regel treten diese Schmerzen zeitlich nahe dem epileptischen Anfall auf. [4]
Ein Fünftel der Patienten mit periiktalen Kopfschmerzen hatte einen präiktalen Kopfschmerz, vier Fünftel einen postiktalen. Sehr wenige Patienten hatten sowohl präiktale als auch postiktale Kopfschmerzen. Ein einzelner Patient hatte einen iktalen Kopfscherz.
Mehr als ein Viertel der periiktalen Kopfschmerzen waren migränösen Charakters, erfüllten also die Kriterien einer Migräneattacke. 62 % waren Spannungskopfschmerzartig, die restlichen Kopfschmerzformen waren nicht kategorisierbar. Die Schmerzen waren stark ausgeprägt und erreichten auf der visuellen Analogskala einen Wert von sechs, ± 2 cm. Die meisten Patienten behandelten den Kopfschmerz entweder gar nicht oder mittels rezeptfreier Analgetika, wie Aspirin oder Paracetamol. Vermutlich waren sie primär auf den Anfall fixiert.
Ein Risikofaktor für den periiktalen Kopfschmerz ist insbesondere ein jüngeres Alter bei Beginn der Epilepsie.
Patienten mit generalisierten, tonisch-klonischen Anfällen litten sehr häufig an periiktalen Kopfschmerzen. Während Patienten mit Absencen oder einfachen fokalen Anfällen signifikant seltener über periiktale Kopfschmerzen klagten.
In einer Studie der Montreal-Gruppe zur Lateralisierung von Kopfschmerzen wurden 100 Patienten mit fokaler Epilepsie im prächirurgischen Monitoring rekrutiert. Die Patienten wurden klassifiziert nach temporalen und extratemporalen Epilepsien. 50% der temporalen Patienten berichteten über periiktale Kopfschmerzen und bei 90 % dieser Patienten war die Seite des Kopfschmerzes mit dem Anfallsfokus identisch.
Im Gegensatz dazu gab es bei den Patienten mit extratemporalen Epilepsien keinen Zusammenhang zwischen der Seite des Kopfschmerzes und dem Anfallsfokus. Die beiden Patientengruppen unterschieden sich diesbezüglich signifikant. Es kann daher sinnvoll sein, die Patienten explizit danach zu fragen, ob sie vor oder nach dem Anfall Kopfschmerzen haben.
Der iktale Kopfschmerz ist eher eine Rarität: In einer Studie aus Seoul an 831 Patienten wurden mittels Video-EEG sechs Patienten (also 0,7 Prozent) identifiziert, bei denen der Kopfschmerz maßgeblich oder wahrscheinlich die epileptische Aura darstellte. [6]
Es gibt Epilepsiesyndrome, die mit Kopfschmerzen als iktales Phänomen assoziiert sind. Diese kommen insbesondere im pädiatrischen Bereich vor und werden als Panayiotopoulos-Syndrom oder kindliches Epilepsiesyndrom bzw. benigne occipitale Epilepsie vom Typ Lennox-Gastaut bezeichnet. Beim kindlichen Epilepsiesyndrom sind Kopfschmerzen elementarer Teil der Anfallssymptomatik. Auch bei Frontallappen-Epilepsien können Kopfschmerzen Teil der iktalen Symptomatik sein.
In der Literatur wird das zeitgleiche Auftreten von Migräne und Epilepsie mitunter als „Migralepsie“ bezeichnet. Der Begriff taucht immer wieder unter dem Stichwort „borderland of epilepsy“ auf. [8]
In der International Classification of Headache Disorders (IHS) ist die Migralepsie per se nicht klassifiziert, wohl aber der zerebrale Krampfanfall, der durch eine Migräneaura getriggert wurde. Die Diagnose ist erfüllt, wenn a) die Migräne, die Kriterien einer Migräne mit Aura erfüllt und b) sich ein zerebraler Krampfanfall, der die Kriterien eines Epilepsietyps erfüllt, während oder innerhalb von einer Stunde nach einer Migräneaura ereignet. Dazu kommentiert die IHS: „Migräne und Epilepsie sind Prototypen von paroxysmalen zerebralen Anfallsleiden. Während migräneähnliche Kopfschmerzen in der Postiktalphase relativ häufig sind, können manchmal auch zerebrale Krampfanfälle während oder im Anschluss an eine Migräne auftreten. Dieses Phänomen, als Migralepsie bezeichnet, wurde bei Patienten mit Migräne mit Aura beschrieben.“
Diese Definition wird kritisch diskutiert, da es sich auch um einen Zufallsbefund handeln kann. Der betreffende Patient kann zufällig häufig an Migräneattacken und an einer hohen Epilepsiefrequenz leiden.
Die Arbeitsgruppe von Josemir Sander aus London hat sich intensiv mit Komorbiditäten von Epilepsie beschäftigt und die möglichen Zusammenhänge in dem folgenden Konzept dargestellt (Abbildung 2). [9]
Die Forscher haben insgesamt fünf Komorbiditäts-Kategorien gebildet. Eine durchgezogene Linie zwischen den Kästchen weist auf einen kausalen Zusammenhang hin, eine gestrichelte Linie bedeutet, dass kein kausaler Zusammenhang besteht.
Die erste Kategorie beschreibt Konstellationen, in denen eine Epilepsie und eine andere Erkrankung, ohne jeglichen Zusammenhang auftreten. Und trotzdem gibt es Artefakte, die auftreten können. Deswegen ist der Zusammenhang hier noch einmal hervorgehoben.
Die zweite Kategorie beschreibt Komorbiditäten die direkt oder indirekt zu Epilepsie führen können. Beispielsweise hat jemand, der einen Schlaganfall erleidet, ein 10-prozen-tiges Risiko in den nächsten Jahren an Epilepsie zu erkranken. Beim indirekten Zusammenhang liegt eine Verkettung von unterschiedlichen Erkrankungen vor. Beispielsweise kann schwerer Nikotin-Abusus als psychiatrische Erkrankung begriffen werden. Infolge des Rauchens kann es dann zu einem Schlaganfall kommen. Oder es manifestiert sich ein Bronchialkarzinom mit Metastasen im Gehirn. In beiden Fällen steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Epilepsie.
Die zeitliche Abfolge kann auch umgekehrt sein (Kategorie 3). Die Epilepsie kann dazu führen, dass andere Erkrankungen auftreten, oft Anfalls-assoziiert. In der Praxis ereignen sich häufiger Frakturen bei Patienten mit Epilepsie als bei Menschen ohne Epilepsie, weil erstere häufiger stürzen. Möglicherweise begünstigen sogar die eingenommenen Antiepi-leptika die Sturzfolgen, weil sie den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen.
Das geläufige Verständnis von Komorbidität ist, dass es gemeinsame Risikofaktoren gibt, die auf der einen Seite Epilepsie auslösen und zusätzlich eine andere Erkrankung hervorrufen, wie beispielsweise Kopfschmerzen oder Migräne. Es besteht also ein Zusammenhang hinsichtlich des Risikofaktors. Zwischen der Epilepsie und der Komorbidität gibt es hingegen keinen direkten Zusammenhang (Kategorie 4). Die Arbeitsgruppe beschreibt hierfür das folgende Beispiel: Perinatale Hypoxie. Die Kinder entwickeln eine Epilepsie und sie haben eine spastische Parese. Aber die Epilepsie ist nicht Auslöser der spastischen Parese oder umgekehrt. Es handelt sich vielmehr um eine gemeinsame erworbene perinatale Schädigung, welche zu beiden Erkrankungen führt.
Schließlich gibt es noch den bidirektionalen Zusammenhang (Kategorie 5). Hierbei beeinflusst sowohl die Epilepsie die Komorbidität als umgekehrt die Komorbidität die Epilepsie.
Die gleiche Arbeitsgruppe hat ebenfalls einen systematischen Review zum Thema Komorbidität zwischen Migräne und Epilepsie veröffentlicht. [10]
Die Metaanalyse geht der Frage nach, wie häufig Patienten mit Migräne an Epilepsie leiden und umgekehrt. Im Rahmen der systematischen Recherche wurden mehrere Tausend Studien identifiziert. Letztendlich erfüllten nur 9 verschiedene Publikationen zu 10 Studien die prädefinierten Einschlusskriterien.
Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass bei Patienten mit Epilepsie ein 1,52-faches Risiko besteht, eine Migräne zu entwickeln. Epilepsiepatienten haben daher eine um 50 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, auch an Migräne zu leiden als Patienten ohne Epilepsie.
Die umgekehrte Situation, also das Auftreten von Epilepsie bei Migränepatienten, tritt mit einem Faktor von 1,79 häufiger auf als bei Patienten ohne Migräne, d.h. mit einer 80 % höheren Wahrscheinlichkeit.
Die Vergesellschaftung von Migräne mit Epilepsie bzw. von Epilepsie mit Migräne ist also zwischen 1,5- und 2-mal wahrscheinlicher als bei Patienten ohne die jeweilige Grunderkrankung. Vermutlich beruhen sowohl die Migräne als auch die Epilepsie auf einem gemeinsamen genetischen Hintergrund.
Zusammenfassung Epidemiologie:
- Migräne ist 20 Mal häufiger als Epilepsie
- Migräne betrifft Frauen zwei bis drei Mal häufiger als Männer. Jeder dritte Epilepsie-Patient hat einen schweren periiktalen Kopfschmerz, ein Viertel ist migräneartig. Diese Unterschiede lassen sich als Lateralisierungszeichen bei Temporallappen-Epilepsien nutzen.
- Bei Epilepsie tritt Migräne um 50 % häufiger auf als bei Patienten ohne Epilepsie.
- Bei Migräne tritt Epilepsie um 80 % häufiger auf als bei Patienten ohne Migräne.
Genetik und Pathophysiologie
Eine niederländische Arbeitsgruppe hat mögliche Gen-Loci identifiziert, die an der Entstehung von Migräne beteiligt sein können. Dazu wurden Daten aus drei großen sogenannten Genome-Wide-Association-Studien und einer Meta-Analyse ausgewertet. [10] Die Forscher konnten 13 Suszepitbilitäts-Genvarianten identifizieren, die in Clustern auf fünf verschiedene pathophysiologische Pathways hindeuten. Auch für die Entwicklung der Epilepsie sind entsprechende Daten in der Literatur zu finden.
Insbesondere für die genetischen Hintergründe der epileptischen Enzephalopathien liegen belastbare Daten vor. 17 Prozent der epileptischen Enzephalopathien sind über genetischen Faktoren erklärbar. Von den genetisch-generalisierten Epilepsien sind hingegen nur fünf Prozent eindeutig gesichert. Für 95 % lassen sich bisher keine genetische Zusammenhänge bilden. Noch weniger bekannt ist über die genetischen Hintergründe von nicht läsionellen fokalen Epilepsien. Es gibt zwar seltene Fälle von autosomal-dominanter Frontallappenepilepsie, insgesamt sind jedoch nur zwei Prozent genetisch erklärbar. [12]
Auf der anderen Seite gibt es immer wieder einzelne Familien, bei denen ein konkreter Gen-Locus identifiziert wurde, der für die Entstehung seltener, familiärer occipitotemporaler Epilepsien und Migränen mit visueller Aura verantwortlich ist. Das sind Patienten, bei denen plötzlich, aus der Migräne-Aura ein epileptischer Anfall wird. Dieser Zusammenhang wurde eingangs bereits unter dem Stichwort „Migralepsie“ beschrieben. [13]
Pathophysiologisch unterliegen sowohl Epilepsie als auch Migräne einer neuronalen Hyperexzitabilität. In dieser Eigenschaft erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten zwischen den Erkrankungen jedoch bereits.
Die Migräne-Aura zeichnet sich durch die "spreading depolarisation" aus. In Abbildung 3 ist diese Depolarisation dargestellt: Das blaue Areal bezeichnet die Front der voranschreitenden Depolarisation, und der rosafarbene Bereich stellt die Zone mit verminderter neuronaler Depolarisation dar. Dieser Prozess, sowie das Auftreten der Aura, dauert üblicherweise 15 bis 20 Minuten an. [11]
Normalerweise beginnt der Prozess der neuronalen Depolarisation occipital und wandert mit einer Geschwindigkeit von drei Millimeter pro Minute nach vorne. Der Gyrus postcentralis wird nach etwa 10 bis 15 Minuten erreicht. Hinter dieser Front besteht eine Phase der verringerten neuronalen Depolarisation mit einem gleichzeitig verringerten Blutfluss. Dagegen ist der Blutfluss im Bereich der Aurafront erhöht. Diese Veränderungen lassen sich sowohl im Tiermodell als auch am Mensch durch funktionelle Bildgebung nachweisen. [11,14]
Der Migräne-Kopfschmerz an sich stellt ein anderes Phänomen dar. Er ist mit einer Aktivierung des trigemino-vaskulären Systems assoziiert. Wahrscheinlich werden die Nozizeptoren der betroffenen Gefäße durch einen akuten inflammatorischen Prozess gereizt. Dieser Prozess zieht sich in das trigemino-zervikale Kerngebiet fort und steigt nach oben in den Thalamus. Im Locus coeruleus kann noch eine Modulation stattfinden, bevor der Prozess den Kortex erreicht und dann den Migränekopfschmerz hervorruft.
Ein wichtiger Transmitter in diesem Ablauf ist das Calcitonin gene-related peptide (CGRP). Dieser Neurotransmitter stellt ein neues therapeutisches Target im Rahmen der Migränebehandlung dar.
Zusammenfassung Genetik und Pathophysiologie
- Sowohl Migräne als auch Epilepsie basieren auf neuronaler Hyperexzitabilität.
- Mirgäne entsteht durch Aktivierung des trigemino-vaskulären Systems.
Epilepsie entsteht aufgrund neuronaler Hypersynchronisation.
Therapeutische Konzepte
Ziel der Behandlung chronischer Erkrankungen mit episodischen Manifestationen, wie Epilepsie oder Migräne, ist die Aufrechterhaltung eines möglichst normalen Lebensstils für die Patienten. Dazu gehört eine bestmögliche Symptomkontrolle. Im Idealfall hat der Patient unter der Therapie weder epileptische Anfälle noch Migräne-Attacken. Des Weiteren sollten unter einer Dauertherapie keine, oder allenfalls minimale Nebenwirkungen auftreten.
Daher steht die Pharmakotherapie an erster Stelle.
Bei pharmakoresistenten Patienten mit fokaler Epilepsie sollte immer eine Epilepsiechirurgie in Erwägung gezogen werden.
Als Verfahren der Epilepsiechirurgie stehen die offene Resektion und die Laserablation zur Verfügung.
Erst nachdem Patienten epilepsiechirurgisch evaluiert worden sind, sollten andere therapeutische Konzepte erwogen werden. Dazu gehören Neurostimulation, ketogene Diät und Bio-Feedback-Verfahren. Die beste Evidenz liegt diesbezüglich für die Neurostimulation vor.
In der Praxis kommt immer wieder vor, dass Patienten einen Vagusnervstimulator erhalten, ohne vorher epilepsiechirurgisch evaluiert worden zu sein. In solchen Fällen ist es unter anderem nicht mehr möglich, ein 3-Tesla-MRT durchzuführen.
Bei der Behandlung der
Migräne steht die Pharmakotherapie im Vordergrund. Inzwischen liegen auch erste randomisierte, kontrollierte Studien zur Anwendung von Botulinumtoxin vor.
Begleitend, nicht nachgeordnet, sollen Verhaltenstherapie und aerober Ausdauersport betrieben werden. Diese Maßnahmen helfen bei der Stabilisierung der Patienten im Rahmen ihrer chronischen Schmerz-erkrankung und werden daher von der DGN empfohlen.
Medikamentöse Therapie der Epilepsie
Zur Pharmakotherapie der Epilepsie sind in der Monotherapie zahlreiche Medikamente zugelassen. Tabelle 2 zeigt zusätzlich die zur Zusatztherapie zugelassenen Medikamente. Die in Orange hervorgehoben Substanzen sind ausschließlich zur Zusatztherapie zugelassen.
Abbildung 4 zeigt die Responderraten, die verschiedene Antiepileptika im Rahmen der jeweiligen Zulassungsstudien demonstriert haben. Balken in orange zeigen die Responderrate der aktiven Substanz, in blau die unter Placebo. Im Durchschnitt zeigen die Substanzen eine Responderrate von 30 bis 35 Prozent bei schwer behandelbaren Epilepsiepatienten. Als Response wird gewertet, wenn mindestens 50 % weniger Anfälle unter dem Medikament im Vergleich zur Ausgangssituation beobachtet werden. Insgesamt hat also nur jeder dritte Patient unter Antiepileptika etwa 50 % weniger Anfälle. [17-19]
Dieses ernüchternde Ergebnis basiert darauf, dass im Rahmen klinischer Studien nur bestimmte Patientenpopulationen untersucht werden, die nicht unbedingt der großen Gruppe der Epilepsiepatienten im Alltag entspricht.
Abbildung 5 zeigt die anfallsfreien Patienten in Abhängigkeit von der Anzahl vorausgegangener, erfolgloser Therapien. Je mehr Medikamente bereits erfolglos eingesetzt worden sind desto unwahrscheinlicher ist eine Anfallsfreiheit unter einer Folgetherapie. Nach dem sechsten oder siebten Medikament sind nahezu null Prozent der Patienten anfallsfrei. Abbildung 6 zeigt die Responderrate in Abhängigkeit von der Anzahl vorausgegangener, erfolgloser Therapien. Nach dem sechsten bis siebten Antiepileptikum ist eine Responder-Rate von 30 % zu erwarten. [20]
Die meisten Patienten, die in Antiepileptika Zulassungsstudien aufgenommen werden, hatten zuvor circa fünf erfolglose Therapieregime und mehr. Die Patienten müssen schließlich damit einverstanden sein, für drei Monate möglicherweise lediglich ein Placebo zu erhalten. Die Teilnahmebereitschaft setzt daher einen entsprechend hohen Leidensdruck voraus.
Diese Studien werden vornehmlich durchgeführt, um den Zulassungsbehörden die Wirksamkeit des Medikaments im Vergleich zu Placebo nachzuweisen. Würden die neuen Medikamente dagegen bereits nach zwei oder drei erfolglosen Therapien eingesetzt, wären durchaus höhere Responderraten zu erwarten.
Betrachtet man Abbildung 7 unter dem Aspekt des Placeboeffekts, so zeigen sich etwa 15 % Responder auch unter der Behandlung mit Placebo.
Der zusätzliche Gewinn durch das aktive Medikament im Vergleich zu Placebo beträgt daher nur etwa 20 Prozentpunkte. In dieser schwer behandelbaren Gruppe hat also nur jeder fünfte Patient einen Vorteil durch die Einnahme des Antiepileptikums.
Dies entspricht einer „number needed to treat“ von fünf Patienten.
Epilepsiechirurgie
Die „number needed to treat“ lässt sich auch für die Epilepsiechirurgie ermitteln.
Samuel Wiebe und sein Team konnten zeigen, dass Patienten mit Temporallappenepilepsie ein Jahr nach Intervention zu 58 % anfallsfrei sind. In der rein medikamentös behandelten Gruppe erreichen hingegen nur acht Prozent dieses Ziel. Gegenüber der konservativ behandelten Gruppe zeigt sich demnach ein Behandlungsvorteil der Epilepsiechirurgie von etwa 50 %. [21]
Im Gegensatz zur Responderrate unter Pharmakotherapie wird in der Epilepsiechirurgie die Anfallsfreiheit ermittelt. Die „number needed to treat“ bis zur Anfallsfreiheit war in der hier vorgestellten Studie zwei. Das bedeutet, von zwei operierten Patienten besteht bei einem ein Vollerfolg hinsichtlich einer Anfallsfreiheit.
Eine Herausforderung im Rahmen der Epilepsiechirurgie ist die Akzeptanz bei den Patienten: Etwa 20 % der für Epilepsiechirurgie ideal geeigneten Kandidaten, zum Beispiel mit rechtsseitiger Hippocampus-Sklerose, weigern sich, den Eingriff durchführen zu lassen. Dieser Anteil unterscheidet sich international kaum. Die Ablehnung beruht auf der Angst vor der Entfernung von Gewebe aus dem Gehirn. [22]
Bei einer dokumentierten Pharmakoresistenz ist es daher wichtig, dem Patienten klar zu machen, dass seine Anfälle ohne chirurgischen Eingriff vermutlich ein Leben lang bestehen. Auch sollten Patienten, die eine Epilepsiechirurgie ablehnen, über ein möglicherweise erhöhtes Sterberisiko aufgeklärt werden.
Michael Sperling und Kollegen haben die Mortalität nach Epilepsiechirurgie mit der von ausschließlich pharmakologisch behandelten Patienten verglichen. Patienten hatten nach Resektion eine signifikant höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als konservativ behandelte, bei denen es vermehrt zu Grand Mal-assoziierten SUDEP-Ereignissen kam. [23] Allerdings haben Patienten mit rein komplex-fokalen Anfällen ein reduziertes Risiko, an SUDEP zu versterben.
Die Laserablation verfolgt konzeptuell den gleichen Ansatz wie die Epilepsiechirurgie. Allerdings wird die Region, in der die Anfälle beginnen, nicht entfernt, sondern zerstört bzw. funktionsunfähig gemacht. Abbildung 8 zeigt die Prozedur am linken mesialen Temporallappen. Im MRT wird eine Laser-Elektrode an den Ort gelegt, der zerstört werden soll - hier im Hippocampus auf der linken Seite. Im MRT kann vorberechnet werden, welche Läsion mit welcher Temperatur erreicht werden kann. Der Hippocampus hat eine längliche Struktur. Bei Bedarf kann die Elektrode nach hinten gezogen werden, um noch weitere Bereiche zu zerstören. Konzeptuell ist der Vorgang mit einer selektiven Amygdalo-Hippocampektomie vergleichbar, bei der nur ein kleiner Bereich zerstört wird.
Die Arbeitsgruppe von Micheal Sperling hat erste Outcome-Daten zur neuen Interventionstechnik publiziert. In der offenen Studie wurden 20 laserabladierte Patienten 20 Monate nachbeobachtet und eine 40-prozentige Anfallsfreiheit nachgewiesen. Zur Erinnerung: In der oben beschriebenen Studie an Patienten mit Temporallappenepilepsie waren etwa 58 % der Patienten nach dem Eingriff anfallsfrei. [24]
In den USA wird die Laserablation inzwischen selbst bei mesialer Temporallappenepilepsie bevorzugt angeboten, weil diese deutlich weniger invasiv ist und der Patient bereits am nächsten Tag entlassen werden kann. Sollte die Laserablation nicht zum gewünschten Erfolg führen, kann anschließend immer noch eine offene Resektion in Betracht gezogen werden. Die Patienten scheinen vor der Laserablation weniger Angst zu haben und stimmen dem Eingriff eher zu als der offenen Resektion.
Die Laserablation wird in Kürze auch in Europa zugelassen werden. Auch in Deutschland wird diese Methode vor allem Patienten mit Angst vor der offenen Resektion und bei schlecht erreichbarem Anfallsfokus angeboten. Dazu gehören beispielsweise hypothalamische Hamartome und periventrikuläre Heterotopien. Diese lassen sich mit einer Elektrode gut erreichen.
Therapeutische Konzepte bei Migräne
Zur Standardtherapie der Migräne gemäß den DGN-Leitlinien gehören Beta-Blocker wie Metoprolol und Propranolol, aber auch Kalziumantagonisten sowie Antiepileptika, bevorzugt Topiramat und Valproat. Lamotrigin zeigt hingegen keine ausreichende Wirksamkeit bei Migräne. Wirkstoffe der zweiten Wahl sind beispielsweise sind der Beta-Blocker Bisporolol, das Trizyklikum Amitriptylin und Naproxen als COX-Hemmer.
Neue pharmakologische Therapiekonzepte haben das eingangs beschriebene Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) im Fokus. Mittlerweile werden vier verschiedene Antiköper gegen diesen Neurotramsitter im Rahmen von Phase-II-Studien untersucht. [25]
Diese Antikörper verfügen im Vergleich zu Placebo über eine signifikant bessere Wirksamkeit hinsichtlich der Anzahl kopfschmerzfreier Tage. Bezogen auf den Patientenalltag sind die Ergebnisse wiederum ernüchternd. Patienten, die zu Studienbeginn unter 20 Migränetagen pro Monat litten hatten unter der Antikörpertherapie etwa zwei Tage weniger Kopfschmerzen oder Migräne pro Monat, als unter Placebo.
Im Rahmen eines Reviews wurde die „number needed to treat“ für die Responderzahl unter der Antikörpertherapie identifiziert. Responder waren Patienten, bei denen die Anzahl der Tage mit Kopfschmerzen im Vergleich zur Baseline mindestens halbiert wurde. Die „number needed to treat“ lag bei vier bis sechs Patienten. Es müssen demnach vier bis sechs Patienten behandelt werden, damit ein Patient nur noch halb so viele Kopfschmerztage hat wie vorher. Eine vollständige Kopfschmerzfreiheit wurde nicht erreicht. [26]
Eine weitere Behandlungsalternative ist Botulinumtoxin. Die Substanz wurde bei Patienten mit chronischer Migräne, also mindestens 15 Migränetage pro Monat, in einer randomisiert kontrollierten Studie untersucht.
Die Patienten hatten zu Studienbeginn 20 Migränetage. Auch unter Botulinumtoxin stellte sich ein Unterschied von lediglich zwei Tagen zwischen Placebo und dem Verum ein. Im Vergleich zur Epilepsie kann bei Patienten mit Migräne ein sehr starker Placeboeffekt beobachtet werden.
Auch in dieser Untersuchung wurden die Responderraten ermittelt. In der Botulinumtoxin-Gruppe wurden 48 und im Placebo-Arm 36 Prozent dokumentiert. Anhand der Responderraten wurde die „number needed to treat“ ermittelt.
Zwischen den Gruppen bestand ein Unterschied von etwa 14 Prozent, die „number needed to treat“ betrug sieben. Demnach müssen sieben Patienten mit Botulinumtoxin behandelt werden, damit ein Patient eine Response zeigt.
Der hypothetische Wirkmechanismus des Botulinumtoxins ist eine Interaktion mit dem Calcitonin gene-related proteine. Dadurch soll die Ausschüttung des Neurotransmitters gehemmt und die Entwicklung von Kopfschmerzen verhindert werden.
Die Behandlung mit Botulinumtoxin hatte darüber hinaus keinen Einfluss auf die Menge der benötigten Akutmedikamente im Vergleich zu Placebo.
Therapeutische Konzepte
Die Arbeitsgruppe von Michele Romoli vom Universitätsklinikum in Perugia hat die Verträglichkeit von Antiepileptika bei Migränepatienten und Epilepsiepatienten untersucht. Migränepatienten zeigten unter denselben Medikamenten mehr Nebenwirkungen als Epilepsiepatienten. [28]
In der Studie erhielten Patienten mit neu diagnostizierter Epilepsie oder neu entdeckter Migräne Lamotrigin, Topiramat oder Valproat als Monotherapie. Die häufigsten Verschreibungen waren Topiramat bei knapp 70 Prozent der Migränepatienten, gefolgt von knapp 50 Prozent Valproat bei Epilepsiepatienten.
Interessant ist, dass die Medikamente bei Epilepsie höher dosiert werden: Lamotrigin 180 Milligramm bei Epilepsie und 125 Milligramm bei Migräne. Topiramat 180 Milligramm bei Epilepsie und 110 Milligramm bei Migräne und Valproat 1.000 Milligramm bei Epilepsie und nur 650 Milligramm bei Migräne.
Migränepatienten erhielten also etwa nur ein Drittel weniger Dosis derselben Medikamente wie Epilepsiepatienten.
Dennoch zeigten Migränepatienten mehr Nebenwirkungen, obwohl die Wirkstoffdosis geringer war. Besonders groß war der Unterschied bei Topiramat: Knapp 78 Prozent der Migränepatienten, aber nur bei 53 Prozent der Epilepsiepatienten berichteten über Nebenwirkungen unter diesem Antiepileptikum. Allgemein zeigte sich, dass Migränepatienten trotz geringerer Medikamentendosis unter mehr Nebenwirkungen litten als Epilepsiepatienten.
Den Ergebnissen einer multivariaten Analyse zufolge ist Topiramat bei Epilepsie deutlich schlechter verträglich als Lamotrigin, und Valproat ist schlechter verträglich als Lamotrigin. Im Rahmen der SANAD-Studie zeigte sich eine gute Verträglichkeit von Lamotrigin im Langzeitverlauf.
Bei Patienten mit Migräne schnitt nur Topiramat bezüglich der Verträglichkeit schlechter ab als Valproinsäure.
Zusammenfassung
- Sowohl bei Migräne als auch bei Epilepsie ist der erste Schritt die Pharmakotherapie
- Bei schwer behandelbaren Patienten müssen fünf behandelt werden, um bei einem Patienten eine Response zu erreichen.
- Bei Patienten mit chronischer Migräne unter Botulinumtoxin müssen sogar sieben Patienten behandeln werden, um einen Responder zu erzielen.
- Bei Epilepsie sollten chirurgische Verfahren immer in Betracht gezogen werden, denn diese erreichen häufig sogar eine Anfallsfreiheit. Die „number needed to treat“ bei herkömmlicher Resektion beträgt zwei, bei Laserablation 2,5.