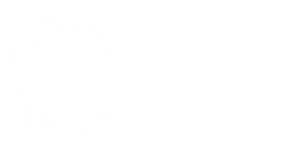Clusterkopfschmerz und trigeminoautonome Kopfschmerzen erkennen und multimodal behandeln
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie …
- die klinischen Merkmale des Clusterkopfschmerzes und anderer trigeminoautonomer Kopfschmerzen (TAK),
- die differenzialdiagnostischen Kriterien zur Abgrenzung der TAK untereinander,
- aktuelle Therapieoptionen zur Attackenkupierung und Prophylaxe bei Clusterkopfschmerz,
- wichtige psychosoziale Aspekte und häufige Komorbiditäten bei Clusterkopfschmerz.
Klinische Präsentation
Der Clusterkopfschmerz ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung, klinisch gekennzeichnet durch streng einseitige, attackenartig auftretende, äußerst intensive Schmerzen, die am stärksten retroorbital ausgeprägt sind. Die Diagnose wird gegenwärtig rein klinisch definiert: A) Mindestens fünf Attacken, die die Kriterien B bis D erfüllen. B) Starke oder sehr starke einseitig orbital, supraorbital und/oder temporal lokalisierte Schmerzattacken, die unbehandelt 15 bis 180 Minuten anhalten. C) Einer oder beide der folgenden Punkte ist/sind erfüllt: 1. mindestens eines der folgenden Symptome oder Zeichen, jeweils ipsilateral zum Kopfschmerz: a. konjunktivale Injektion und/oder Lakrimation, b. nasale Kongestion und/oder Rhinorrhö, c. Lidödem, d. Schwitzen im Bereich der Stirn oder des Gesichtes, e. Miosis und/oder Ptosis 2. körperliche Unruhe oder Agitiertheit D) Die Attackenfrequenz liegt zwischen einer jeden zweiten Tag und acht pro Tag. E) Nicht besser erklärt durch eine andere ICHD(International Classification of Headache Disorders)-3-Diagnose. Die Angaben zu Attackendauer und Frequenz treffen für >50 % aller Patienten zu, nach ICHD-3 sind Abweichungen bei vorliegendem Clusterkopfschmerz möglich. Die Begleitsymptomatik kann gelegentlich auch fehlen, was die Diagnose jedoch nicht grundsätzlich ausschließt. Die Attacken weisen eine typische Häufung in den Nachtstunden auf, insbesondere ein bis zwei Stunden nach dem Einschlafen, oder während der frühen Morgenstunden. Charakteristisch ist zudem die während der Attacken auftretende psychomotorische Unruhe. Betroffene zeigen oft ein auffälliges Agitationsverhalten bis hin zu selbstverletzenden Impulsen (z. B. den Kopf gegen die Wand schlagen), was sowohl für das soziale Umfeld als auch im klinischen Alltag eine große Herausforderung darstellen kann. In Einzelfällen werden dadurch sogar polizeiliche oder psychiatrische Interventionen erforderlich. Die Schmerzintensität ist in der Regel extrem hoch (bis 10/10 auf der visuellen Analogskala) und wird von Patientinnen mit Geburtserfahrung teilweise noch intensiver als Geburtsschmerzen erlebt. Im Gegensatz zur Migräne, die ein breites Spektrum an Schmerzqualitäten und -intensitäten zeigt, verlaufen Clusterattacken monomorph und stereotyp, das heißt bei den meisten Betroffenen mit nahezu identischem Ablauf jeder einzelnen Attacke. Etwa die Hälfte der Betroffenen berichtet zusätzlich über einen begleitenden Dauerkopfschmerz, häufig einseitig betont und kontinuierlich verlaufend. Auch migräneartige Begleitsymptome wie Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit sowie Aurasymptome können vorkommen, vor allem bei Frauen. In rund 80 % der Fälle liegt ein episodischer Clusterkopfschmerz vor, bei dem sich symptomatische Episoden (sog. Bouts) über Wochen bis wenige Monate erstrecken und von längeren, symptomfreien Intervallen unterbrochen werden. Bei einer Krankheitsdauer von >1 Jahr ohne Remission oder Remissionsphasen von <1 Monat spricht man hingegen vom chronischen Clusterkopfschmerz. Zudem zeigt sich bei vielen Patienten eine saisonale Häufung der Episoden im Frühjahr und Herbst. Ein einzelner Bout dauert im Regelfall sechs bis acht Wochen, kann jedoch kürzer oder länger ausfallen. Aufgrund dieser Struktur unterscheidet sich der episodische Clusterkopfschmerz klar von anderen primären Kopfschmerzerkrankungen wie der Migräne.
Atypische klinische Präsentationen des Clusterkopfschmerzes
Obwohl der Clusterkopfschmerz typischerweise mit einer eindeutigen klinischen Symptomatik einhergeht, existieren auch atypische Verlaufsformen, die die Diagnosestellung erschweren können. Weibliche Betroffene weisen häufiger atypische Verläufe auf, etwa eine weniger klare Periodik oder ein abweichendes Muster der autonomen Begleitsymptomatik mit migräneähnlichen Beschwerden. Dies führt dazu, dass der Clusterkopfschmerz bei Frauen häufiger fehldiagnostiziert wird. Während der Schmerz üblicherweise retroorbital lokalisiert ist, sind auch atypische Lokalisationen dokumentiert, etwa im Oberkiefer-, Hinterhaupt- oder Nackenbereich. Diese untypischen Manifestationen können ebenfalls zu Fehldiagnosen führen. Sie werden häufig beispielsweise mit einer Sinusitis oder zervikogenen Kopfschmerzen verwechselt. In seltenen Fällen treten die charakteristischen autonomen Begleitsymptome, wie Tränenfluss, Nasenlaufen oder Ptosis, ohne das klassische Leitsymptom Schmerz auf. Diese sogenannten „kalten Attacken” gelten als selten, können aber insbesondere in der Remissionsphase oder im Zuge chronischer Verlaufsformen beobachtet werden.
Epidemiologie und Verlauf des Clusterkopfschmerzes
Die 1-Jahres-Prävalenz des Clusterkopfschmerzes wird auf 0,1 bis 0,2 % geschätzt. Die Erkrankung kann beide Geschlechter betreffen. Die lange Zeit postulierte männliche Prädominanz wurde durch neuere Daten infrage gestellt. Möglicherweise besteht ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, wobei viele Frauen fälschlicherweise mit einer Migräne diagnostiziert werden. Gleichzeitig wird bei Männern Migräne häufig übersehen. Entscheidend bleibt die Beachtung der Attackendauer, Unilateralität und das Vorliegen typischer trigeminoautonomer Begleitsymptome. Der Erkrankungsbeginn liegt im Mittel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, kann jedoch grundsätzlich in jedem Lebensalter auftreten. Clusterkopfschmerzen können auch bei Jugendlichen auftreten. Fälle im Kindesalter (<10 Jahre) sind jedoch extrem selten und diagnostisch besonders anspruchsvoll. Wichtig ist hierbei, dass Migräneattacken bei Kindern ebenfalls kürzer verlaufen können und die Differenzierung anhand der Attackenlänge somit altersabhängig interpretiert werden muss.
Trigeminoautonome Kopfschmerzen
Der Clusterkopfschmerz gehört zur Klasse der trigeminoautonomen Kopfschmerzen (TAK; engl. „trigeminal autonomic cephalalgias”, TAC). TAK bilden eine klinisch definierte Gruppe primärer Kopfschmerzerkrankungen mit Gemeinsamkeiten hinsichtlich Schmerzcharakteristik, Begleitsymptomatik, zeitlichem Muster und Therapieansprechen. Zu den wichtigsten Entitäten innerhalb dieser Gruppe zählen der Clusterkopfschmerz, die paroxysmale Hemikranie (PH), die Hemicrania continua (HC) sowie das „short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing”-(SUNCT-) und das „short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms”-(SUNA-)Syndrom. Um eine geeignete Therapie zu ermöglichen, müssen diese Krankheitsbilder differenzialdiagnostisch voneinander abgegrenzt werden. Dies gelingt unter Berücksichtigung der folgenden klinischen Aspekte: 1. Schmerzlokalisation und -charakter: Allen TAK gemeinsam sind streng einseitige Kopfschmerzen, typischerweise im orbitalen, supraorbitalen oder temporalen Bereich lokalisiert. Der Schmerz wird als extrem stark und bohrend oder stechend beschrieben. 2. Autonome Begleitsymptomatik: Kennzeichnend ist eine ipsilaterale trigeminoautonome Symptomatik, deren Intensität nach Krankheitsbild variieren kann. Hierzu zählen Lakrimation, Konjunktiva-Injektion, Rhinorrhö, nasale Kongestion, Ptosis, Miosis sowie Stirn- oder Gesichtsschweiß. Die autonome Begleitsymptomatik ist während der Schmerzattacke obligat. Clusterkopfschmerz und PH zeigen in der Regel die am stärksten ausgeprägte autonome Symptomatik, bei HC ist sie eher gering. 3. Die Attacken zeigen distinkte zeitliche Profile hinsichtlich Dauer und Frequenz: Clusterkopfschmerz: 15 bis 180 Minuten, bis zu achtmal täglich; PH: zwei bis 30 Minuten, >5 Attacken/Tag; SUNCT/SUNA: Sekunden bis wenige Minuten, bis zu 200-mal täglich; HC: persistierender Kopfschmerz mit Exazerbationen 4. Verlauf: Sowohl episodische als auch chronische Verlaufsformen von TAK können auftreten. Beim Clusterkopfschmerz dominieren episodische Verläufe, während die paroxysmale Hemikranie häufiger chronisch verläuft. Die Hemicrania continua ist definitionsgemäß chronisch mit kontinuierlichem Schmerz und phasenweise Schmerzexazerbationen. 5. Therapieansprechen: Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal mit diagnostischer Relevanz ist das Therapieansprechen. Insbesondere die PH und HC sprechen vollständig und in therapeutischer Dosis obligat auf Indometacin an. Beim Clusterkopfschmerz hingegen sprechen Attacken typischerweise auf hochdosierten Sauerstoff oder parenterale Triptane an (siehe Abschnitt Therapie).
Diagnostisches Vorgehen
Allgemeines Vorgehen
Die Diagnosestellung von TAK basiert primär auf einer strukturierten Anamnese und einer zielgerichteten klinisch-neurologischen Untersuchung. Eine frühzeitige Differenzierung zwischen primären und sekundären Kopfschmerzformen ist essenziell, da insbesondere bei atypischer Präsentation oder Erstmanifestation sekundäre Ursachen wie Hirnblutungen, Tumoren, Gefäßdissektionen oder Raumforderungen ausgeschlossen werden müssen. Beim Clusterkopfschmerz ist v. a. die Abgrenzung zur Migräne mit trigeminoautonomer Begleitsymptomatik wichtig, die bei etwa 17 % der Migränepatienten auftreten kann. Die alleinige Präsenz autonomer Symptome erlaubt daher keine sichere Diagnosestellung. Entscheidend bleibt die Kombination aus Attackendauer, Schmerzcharakter, Lokalisation, Begleitsymptomatik und Verhalten während der Attacke. Eine Differenzierung gegenüber dem streng schlafgebundenen „hypnic headache” ist wichtig. Während Letzterer im Gegensatz zum Clusterkopfschmerz ausschließlich im Schlaf auftritt und gut auf Koffein anspricht. Clusterkopfschmerz manifestiert sich überwiegend zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Ein erstmaliges Auftreten im höheren Lebensalter (>50 bis 60 Jahre) sollte immer an mögliche sekundäre Ursachen denken lassen. In der Praxis kommt es insbesondere bei unklaren Kopfschmerzen mit atypischer Lokalisation (z. B. Nasen-, Kiefer- oder Schulterschmerzen) oder bei trigeminoautonomer Begleitsymptomatik zu Fehldiagnosen, zum Beispiel als Sinusitis oder trigeminale Neuralgie. Durch zunehmende Verfügbarkeit digitaler Informationen suchen immer mehr Betroffene bereits mit konkretem Verdacht auf Clusterkopfschmerz medizinische Hilfe auf. Häufig stimmen diese Eigenvermutungen mit der späteren ärztlichen Diagnose überein. Selbsthilfegruppen und Onlineressourcen tragen maßgeblich zur verbesserten Patientenaufklärung und zur schnelleren Diagnosestellung bei.
Diagnostisches Vorgehen im hausärztlichen und notfallmedizinischen Setting
Beim Erstkontakt, etwa in der hausärztlichen oder notfallmedizinischen Versorgung, steht die Basisanamnese im Vordergrund. Wichtige Erfassungsparameter sind:
- Dauer, Frequenz und tageszeitlicher Verlauf der Attacken
- Schmerzlokalisation und -charakter
- Begleitsymptome (z. B. Rhinorrhö, Tränenfluss, Ptosis, Miosis, Gesichtsschweiß)
- Attackendynamik und Trigger
- Verlaufsmuster (episodisch vs. chronisch)
- Ansprechen auf Akutmedikation, insbesondere Triptane oder Sauerstoff
Neurologische Abklärung und bildgebende Diagnostik
Die weiterführende Diagnostik erfolgt in der Regel durch Neurologen oder Kopfschmerzspezialisten. Dazu gehört zuerst eine gründliche klinisch-neurologische Untersuchung. Bei der Erstdiagnose eines Clusterkopfschmerzes ist eine kraniale Bildgebung obligat. Im Gegensatz zur Migräne, bei der bei typischer klinischer Präsentation auf eine apparative Diagnostik verzichtet werden kann, müssen bei trigeminoautonomen Kopfschmerzen strukturelle Läsionen ausgeschlossen werden. Es wird angenommen, dass dem Clusterkopfschmerz pathophysiologisch eine zirkadiane Dysregulation im Hypothalamus zugrunde liegt. Strukturelle Läsionen im Hypothalamus und in angrenzenden Bereichen können daher einen Clusterkopfschmerz imitieren und dürfen nicht übersehen werden. Die kontrastmittelgestützte Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns, einschließlich Darstellung des kraniozervikalen Überganges und des Hypothalamus, ist hier das diagnostische Verfahren der Wahl. Typische Differenzialdiagnosen sind unter anderem Karotis- oder Vertebralisdissektionen, die mit streng einseitigen Kopfschmerzen und einem ipsilateralen Horner-Syndrom imponieren können. Auch entzündliche Erkrankungen wie eine akute Sinusitis, insbesondere im Bereich der Keilbeinhöhle, können eine ähnliche Symptomatik hervorrufen. Raumfordernde Prozesse, insbesondere im Bereich des Hypothalamus, der Schädelbasis oder der Orbitaspitze, sind weitere relevante Differenzialdiagnosen. Eine zusätzliche Computertomografie (CT) der knöchernen Schädelbasis kann in Einzelfällen erwogen werden, insbesondere bei Verdacht auf ossäre Destruktionen oder Läsionen der Nasennebenhöhlen. Zufallsbefunde in der Bildgebung (z. B. Hypophysenzysten) können allerdings auch zu unnötigen und potenziell gefährlichen Interventionen führen, wenn die Kopfschmerzdiagnose nicht korrekt gestellt wurde. Dies muss stets abgewogen werden. In der klinischen Praxis werden häufig Patienten mit einer bereits seit Jahren bestehenden Symptomatik vorstellig, bei denen sich die Diagnose von TAK retrospektiv stellt. In solchen Fällen ist eine sofortige Bildgebung weniger dringlich, insbesondere wenn keine atypischen Symptome vorliegen und der Verlauf über längere Zeit stabil war. Anders verhält es sich bei der Erstmanifestation, insbesondere bei sehr starken, einseitigen Kopfschmerzattacken mit vegetativen Begleitsymptomen. Hier ist eine frühzeitige, gezielte bildgebende Diagnostik zur Abgrenzung sekundärer Ursachen unverzichtbar.
Rolle elektrophysiologischer Verfahren
Elektrophysiologische Verfahren wie trigeminale somatosensorisch evozierte Potenziale (SEP) oder der Blinkreflex spielen keine primäre Rolle in der Routinediagnostik, können jedoch bei Verdacht auf Läsionen im trigeminalen System ergänzende Hinweise liefern. Der Ausschluss ophthalmologischer Ursachen, insbesondere eines Glaukoms, ist ebenfalls Bestandteil der differenzialdiagnostischen Abklärung.
Abgrenzung zu anderen primären Kopfschmerzen
Gerade in Notaufnahmen wird die initiale Vorstellung dieser Patientengruppe häufig nicht ausreichend diagnostisch abgeklärt. Die Kopfschmerzen werden oft als unspezifisch eingeordnet und symptomatisch mit Analgetika behandelt, ohne die spezifische Kopfschmerzform zu erkennen. Dabei können Medikamente wie Metamizol oder Paracetamol fälschlich als wirksam bewertet werden, wenn die Schmerzattacke zufällig nach Gabe der Medikation endet. Eine genaue zeitliche Einordnung des Wirkungseintrittes in Relation zur natürlichen Attackendauer ist daher entscheidend, um Therapieeffekte korrekt zu interpretieren und diagnostische Fehlzuordnungen zu vermeiden. Die Differenzialdiagnostik innerhalb der Gruppe TAK ist neben der Abgrenzung gegenüber anderen primären Kopfschmerzformen, wie der Migräne, von zentraler klinischer Bedeutung. Obwohl sich die Entitäten in ihrer Symptomatik überlappen können, unterscheiden sie sich deutlich hinsichtlich ihres therapeutischen Ansprechens. Dies gilt sowohl für die Akuttherapie als auch für die Prophylaxe. Während z. B. HC und PH ein hervorragendes Ansprechen auf Indometacin zeigen, spricht der Clusterkopfschmerz in der Akutbehandlung typischerweise auf subkutanes Sumatriptan oder Sauerstoffinhalation an (siehe Abschnitt Akuttherapie). Eine fehlerhafte Zuordnung kann somit zu inadäquater oder unwirksamer Therapie führen und die Krankheitslast der Betroffenen unnötig erhöhen. Bei streng einseitigen Kopfschmerzen mit fehlendem Ansprechen auf typische Clusterkopfschmerzmedikamente sollte differenzialdiagnostisch stets an eine PH oder eine HC gedacht werden. Der sogenannte Indometacin-Test kann in solchen Fällen wegweisend sein: Üblicherweise wird mit einer Dosis von 25 mg dreimal täglich begonnen und die Dosis schrittweise alle drei Tage gesteigert, bis zu einer Tagesgesamtdosis von maximal 150 mg. Ein gleichzeitiger Magenschutz (Protonenpumpeninhibitor) ist obligat. Das Ansprechen auf Indometacin dient zugleich als diagnostisches Kriterium und ermöglicht eine klare Abgrenzung zum Clusterkopfschmerz und zur Migräne. Ein lediglich partieller oder unspezifischer Effekt spricht hingegen eher für andere Kopfschmerzformen, wie etwa eine Migräne, bei der Indometacin als nicht steroidales Antirheumatikum zwar ebenfalls wirksam sein kann, jedoch nicht in gleicher Ausprägung. Die Verfügbarkeit von Indometacin ist jedoch in den letzten Jahren zunehmend eingeschränkt gewesen. Lieferengpässe stellen eine erhebliche therapeutische Herausforderung dar, da derzeit keine gleichwertige pharmakologische Alternative mit vergleichbarem Wirkprofil verfügbar ist. Die Trigeminusneuralgie stellt ebenfalls eine wichtige Differenzialdiagnose im Kontext einseitiger Gesichtsschmerzen dar. Im Gegensatz zu TAK treten bei der Trigeminusneuralgie keine autonomen Begleitsymptome wie Tränenfluss, Rhinorrhö oder Augenrötung auf. Charakteristisch für die Trigeminusneuralgie ist die Triggerbarkeit der Schmerzattacken: Alltagsreize wie Berührungen im Gesicht, Kauen, Sprechen oder Zähneputzen lösen typischerweise blitzartig einschießende Schmerzattacken aus. Fehlt diese Triggerbarkeit, ist eine Trigeminusneuralgie unwahrscheinlich. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die strikte Lateralität. Ein Seitenwechsel der Schmerzlokalisation spricht gegen eine klassische Trigeminusneuralgie und eher für andere Schmerzsyndrome. Der atypische Gesichtsschmerz (persistierender idiopathischer Gesichtsschmerz; englisch „persistent idiopathic facial pain”, PIFP) unterscheidet sich ebenfalls deutlich: Er ist durch einen dumpfen, schlecht lokalisierbaren, häufig tiefsitzenden Dauerschmerz gekennzeichnet, der nicht attackenartig verläuft, keine autonomen Begleitsymptome aufweist und nicht durch äußere Reize ausgelöst wird. Ein Seitenwechsel ist hier häufiger möglich. In der klinischen Untersuchung fallen Patienten mit Trigeminusneuralgie häufig durch eine ausgeprägte Schonhaltung und eingeschränkte Mimik auf. Viele berichten über Gewichtsverlust aufgrund vermiedener Nahrungsaufnahme aus Angst vor Schmerzprovokation. Während Schmerzen bei TAK typischerweise um das Auge herum (V1) lokalisiert sind, betreffen Trigeminusneuralgien häufiger den zweiten (V2) oder dritten Ast (V3) des Nervus trigeminus. Bei Schmerzen im V1-Gebiet und begleitenden autonomen Symptomen ist differenzialdiagnostisch an ein SUNCT- oder SUNA-Syndrom zu denken.
Versorgungslage und Herausforderungen
Trotz der markanten klinischen Symptomatik bleibt der Clusterkopfschmerz in der Versorgungspraxis häufig unterdiagnostiziert und unzureichend behandelt. Eine aktuelle Untersuchung an 207 Patienten der Schmerzklinik Kiel verdeutlicht die hohe Krankheitslast und die Versorgungslücken, die mit dieser Erkrankung einhergehen. In der Kohorte waren 62,3 % männlich und 37,7 % weiblich. Ein chronischer Verlauf lag bei 61,8 % der Betroffenen vor, während 38,2 % episodische Attacken beschrieben. Über 70 % der Teilnehmenden litten bereits seit mehr als fünf Jahren an der Erkrankung, wobei 98,6 % die Schmerzintensität als sehr stark bis extrem stark angaben. In einer aktuellen Übersichtsarbeit betrug die durchschnittliche Zeit bis zur korrekten Diagnosestellung eines Clusterkopfschmerzes bis zu acht Jahre. In dieser Zeit suchten viele Betroffene wiederholt Notaufnahmen auf und wiesen eine hohe Anzahl ärztlicher Konsultationen auf, oft ohne adäquate Diagnostik oder zielgerichtete Therapie. Auch nach erfolgter Diagnosestellung bestehen häufig erhebliche Versorgungslücken. So erhalten viele Patienten keine evidenzbasierte Akutbehandlung, etwa mit subkutanem Sumatriptan, intranasalem Zolmitriptan oder hochdosierter Sauerstoffinhalation, und auch eine geeignete Prophylaxe wird nicht regelhaft eingeleitet. Wesentliche Barrieren bestehen insbesondere in der mangelnden Vertrautheit mit der Anwendung von parenteralen Triptanen im ärztlichen Alltag sowie in strukturellen Defiziten an den Schnittstellen zwischen hausärztlicher, notfallmedizinischer und spezialisierter neurologischer Versorgung. Patienten mit TAK, insbesondere mit Clusterkopfschmerz, stellen sich überdurchschnittlich häufig in Notaufnahmen vor. Dennoch ist die Diagnose dort oftmals nicht ausreichend bekannt oder wird in der akuten Versorgungssituation nicht erkannt. In Anbetracht der strukturellen Belastung vieler Notaufnahmen bleibt eine umfassende Differenzialdiagnostik häufig aus. In der Praxis hat sich gezeigt, dass gut informierte Patienten, insbesondere durch die Unterstützung von Selbsthilfegruppen und digitalen Informationsquellen, die richtige Diagnose mitunter selbst vorschlagen und gezielt eine adäquate Akuttherapie einfordern, etwa die Gabe von Sauerstoff oder parenteralen Triptanen. Diese Entwicklung kann in Fällen mit typischer Anamnese und bekannter Erkrankung zur Verbesserung der Versorgung beitragen. Digitale Plattformen und soziale Medien spielen zunehmend eine Rolle in der Aufklärung über Kopfschmerzerkrankungen. Während die Mehrzahl der Inhalte auf Migräne fokussiert ist, finden auch seltenere Entitäten wie Clusterkopfschmerz zunehmend Berücksichtigung. Vor diesem Hintergrund ist es essenziell, dass medizinische Fachpersonen aktiv an der Gestaltung und Verbreitung evidenzbasierter Inhalte mitwirken. Nur durch fachlich fundierte Beiträge lässt sich der Verbreitung pseudowissenschaftlicher oder potenziell schädlicher Empfehlungen entgegenwirken und die Patientenkompetenz gezielt stärken.
Psychosoziale Belastung und Komorbiditäten
Die psychosoziale Belastung durch Clusterkopfschmerz ist erheblich. In der Literatur wird die Erkrankung aufgrund der extremen Schmerzintensität auch „suicide headache“ beschrieben. Die fehlende oder inadäquate Akuttherapie kann zu suizidalen Krisen führen. Suizidgedanken treten bei etwa 40,5 % der Patienten gelegentlich auf, 7,6 % berichten von regelmäßigen Suizidgedanken, und 1,8 % geben an, aktuell unter Suizidgedanken zu leiden. Häufig treten depressive Symptome unterschiedlicher Schwere auf, die in engem Zusammenhang mit dem chronischen Schmerzgeschehen stehen. Rückzugsverhalten, soziale Isolation und ein signifikanter Verlust an Lebensqualität sind häufige Folgen. Die langfristige Versorgung erfordert daher neben der symptomatischen Therapie auch eine psychosoziale Unterstützung und gegebenenfalls psychotherapeutische Begleitung. Daten aus einer Patientenkohorte der Schmerzklinik Kiel belegen, dass Betroffene zudem häufig unter anhaltender Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und ausgeprägter Erschöpfung leiden. Diese Symptome führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Alltagsfunktion. Patienten mit Clusterkopfschmerz weisen darüber hinaus häufig somatische Komorbiditäten auf. Dazu zählen vor allem Rückenschmerzen, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit (KHK) sowie Hirninfarkte. Zudem zeigen diese Patienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine höhere Prävalenz an lebensstil-bezogenen Risikofaktoren wie Rauchen, vermehrter Alkoholkonsum und erhöhter Body-Mass-Index (BMI). Diese Faktoren müssen im Rahmen der Behandlung mitberücksichtigt werden. Ein gehäuftes Auftreten von Clusterkopfschmerz wird in epidemiologischen Untersuchungen mit einem höheren Anteil an Nikotin- und Alkoholkonsum assoziiert. Alkohol gilt dabei insbesondere als Triggerfaktor, der während aktiver Clusterperioden akute Attacken auslösen kann. Eine strikte Alkoholabstinenz während der Clusterphasen ist daher empfohlen. Darüber hinaus zeigen Studien Hinweise auf eine erhöhte Prävalenz von Konsum psychotroper Substanzen in dieser Patientengruppe. Dabei ist jedoch zu betonen, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Gebrauch solcher Substanzen und der Entstehung des Clusterkopfschmerzes nachgewiesen ist. Vielmehr berichten einige Betroffene, insbesondere bei therapieresistenter Symptomatik, über den Einsatz halluzinogener Substanzen wie Psilocybin oder LSD sowie Cannabinoiden in der Hoffnung auf eine Linderung der Beschwerden. Eine sachliche und vorurteilsfreie ärztliche Kommunikation über solche Strategien der Selbstmedikation ist essenziell, um Patienten adäquat zu begleiten und gleichzeitig Risiken nicht evidenzbasierter Maßnahmen zu minimieren. Trotz dieser Belastung zeigen viele Patienten eine hohe Resilienz und Aufrechterhaltung beruflicher und sozialer Aktivitäten. Eine frühzeitige und klare Kommunikation über Behandlungsoptionen, Prognose und therapeutische Ziele ist zentral. Zudem kann eine enge Anbindung an Selbsthilfegruppen oder Informationsangebote, etwa über qualitätsgesicherte Inhalte in sozialen Medien, helfen, Versorgungslücken zu überbrücken und die Patientenkompetenz zu stärken.
Akuttherapie des Clusterkopfschmerzes
Parenterale Triptane
Die Behandlung von Clusterattacken erfordert aufgrund ihrer hohen Schmerzintensität und kurzen Dauer eine schnell wirksame Medikation. Orale Schmerzmittel wie Metamizol, Acetylsalicylsäure oder orale Triptane sind aufgrund der zu langsamen Wirkstoffaufnahme ungeeignet. Die wirksamsten Optionen sind die subkutane Gabe von Sumatriptan (6 mg) sowie intranasales Zolmitriptan (5 mg), wobei Sumatriptan subkutan in der Regel die höchste Effektivität und schnellste Wirkung (innerhalb weniger Minuten) zeigt. Intranasales Zolmitriptan wirkt mit einer Latenzzeit von etwa zehn bis 15 Minuten etwas langsamer, weist jedoch ein etwas günstigeres Nebenwirkungsprofil auf. Sumatriptan subkutan wirkt bei bis zu 80 % der Patienten. Die zugelassene maximale Tagesdosis von subkutanem Sumatriptan beträgt 12 mg. Trotz der Effektivität der verfügbaren Akuttherapeutika besteht eine relevante Versorgungslücke. Eine wesentliche Barriere ist die begrenzte Verschreibungsfrequenz von parenteralen Triptanen durch Sorge vor Einfluss auf das Budget und vor Regressen. Eine klare Dokumentation der Diagnose (ICD-10: G44.0) sowie der Indikationsstellung ist essenziell, um Rückfragen oder Regressforderungen durch die Kostenträger zu vermeiden. In komplexen Fällen sollte eine Mitbetreuung in spezialisierten Zentren erwogen werden. Eine weitere Hürde ist die überzogene Sorge vor einem medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Für den Clusterkopfschmerz ist ein Triptan-Übergebrauchskopfschmerz nicht beschrieben. Die häufig geäußerte Empfehlung, die Akutmedikation auf maximal zehn Tage pro Monat zu beschränken, ist bei dieser Entität nicht sinnvoll, insbesondere bei Patienten mit mehreren täglichen Attacken. In der Praxis benötigen viele Betroffene mehrmals täglich ein parenterales Triptan zur Akutbehandlung. Eine Limitierung der Einnahme kann in solchen Fällen zu einem erheblichen Versorgungsdefizit führen und ist angesichts der hohen Schmerzintensität medizinisch nicht vertretbar. Zwar sind kardiovaskuläre Risiken bei hoher kumulativer Triptan-Dosis zu berücksichtigen, diese müssen jedoch individuell gegen den Leidensdruck und die Alternativlosigkeit bei schwerem Clusterkopfschmerz abgewogen werden. Die unzureichende Akutbehandlung birgt nicht nur ein Risiko für eine Chronifizierung und eine funktionelle Beeinträchtigung, sondern kann in besonders schweren Fällen auch mit einer erhöhten Suizidalität einhergehen. Daher ist eine suffiziente Akuttherapie mit parenteralen Triptanen, gegebenenfalls mehrfach täglich, auch aus ethischer Perspektive erforderlich.
Sauerstofftherapie
Ein weiterer evidenzbasierter Ansatz ist die Sauerstofftherapie mit 100%igem Sauerstoff in einer Flussrate von mindestens zwölf bis 15 l/min über eine Mund-Nasen-Maske mit Reservoir. Der Effekt ist besonders dann zuverlässig, wenn die Therapie frühzeitig zu Beginn einer Attacke eingeleitet wird. Eine Applikation über Nasensonde oder Masken ohne Reservoirsystem ist ineffektiv. Die Sauerstofftherapie ist gut verträglich, kann bei entsprechender Erstverordnung dauerhaft über Sanitätshäuser organisiert werden und sollte idealerweise sowohl für die häusliche als auch berufliche Umgebung verfügbar sein.
Lidocain
Die nasale Applikation von Lidocain-Lösung in einer Konzentration von meist 4 % wird zur Linderung akuter Symptome empfohlen. Die Applikation erfolgt in das ipsilaterale Nasenloch bei etwa 45° zurückgelehnter Kopfhaltung und Kopfdrehung von 30 bis 40°. Der Nutzen der topischen Anwendung von Lokalanästhetika ist jedoch nur bei einem Teil der Patienten nachweisbar, und die Wirksamkeit zeigt sich nicht durchgängig. Die bisherige Evidenz beruht ausschließlich auf Kasuistiken und Fallserien. Aufgrund der geringen Nebenwirkungsrate kann diese Maßnahme als initialer Therapieversuch erwogen werden, die Wirkung hält jedoch nur etwa zwei Stunden an.
Systemische Glukokortikoidgabe beim Clusterkopfschmerz
Zur Bridging-Therapie beim episodischen Clusterkopfschmerz wird häufig ein systemischer Kortisonstoß eingesetzt. In der Praxis hat sich ein Schema bewährt, bei dem über fünf Tage 100 mg Prednisolon pro Tag verabreicht werden. Anschließend erfolgt eine schrittweise Reduktion der Dosis alle drei Tage um 20 mg, sodass sich eine Gesamtdauer der Therapie von etwa 17 Tagen ergibt. Ein begleitender Magenschutz ist obligat. Vor Einleitung der Glukokortikoidtherapie sollte das Vorliegen schwerer Infektionen ausgeschlossen werden. Geringfügige Symptome wie Rhinorrhö oder produktiver Husten stellen in der Regel keine Kontraindikation dar, insbesondere wenn der Nutzen der antiinflammatorischen Wirkung im Rahmen der Clusterbehandlung überwiegt. Die Kombinationstherapie aus Glukokortikoiden und Verapamil (siehe Abschnitt Prophylaktische Therapie) ist in vielen Fällen sinnvoll. Dabei erfolgt parallel zum Kortisonstoß die schrittweise Aufdosierung von Verapamil, das aufgrund seines Wirkmechanismus mehrere Tage bis Wochen benötigt, um eine ausreichende prophylaktische Wirkung zu entfalten. Die systemische Glukokortikoidtherapie wird von den meisten Betroffenen gut vertragen. Dennoch sind psychische Nebenwirkungen möglich. Seltene Komplikationen wie affektive Entgleisungen oder psychotische Symptome sind in Einzelfällen beschrieben, insbesondere bei vorbestehender Vulnerabilität. Eine sorgfältige Risikoabschätzung und klinische Beobachtung sind daher insbesondere bei vulnerablen Personen (u. a. solchen mit bekannten psychischen Störungen) erforderlich. Für Patienten mit bekannter Diagnose von Clusterkopfschmerz kann die Verordnung eines Notfallsets mit oralen Glukokortikoiden zur eigenständigen Anwendung in Ausnahmefällen sinnvoll sein. Dies ermöglicht ein frühzeitiges Kupieren beim Auftreten erster Symptome, insbesondere in Zeiträumen mit eingeschränkter medizinischer Erreichbarkeit. Die Glukokortikoidtherapie ist aufgrund erheblicher unerwünschter Wirkungen nicht für den langfristigen Einsatz geeignet.
Prophylaktische Therapie des Clusterkopfschmerzes
Zeitpunkt der Einleitung einer medikamentösen Prophylaxe
Die Indikation zur Einleitung einer medikamentösen Prophylaxe beim episodischen Clusterkopfschmerz besteht unabhängig von der Anzahl bereits aufgetretener Attacken und sollte möglichst frühzeitig erfolgen. Eine abwartende Haltung bis zum Auftreten mehrerer Attacken oder einer definierten Anzahl von Tagen ist nicht gerechtfertigt, da bereits einzelne Attacken mit erheblichem Leidensdruck und funktionellen Einschränkungen einhergehen. Ziel ist es, die Clusterperiode so früh wie möglich zu begrenzen und eine Chronifizierung oder Eskalation der Attackenfrequenz zu verhindern. Besonders wirksam ist der frühzeitige Therapiebeginn zu Beginn einer Episode, da präventive Maßnahmen in dieser Phase eine größere Wahrscheinlichkeit haben, das Fortschreiten der Attackenfrequenz zu bremsen oder die Dauer der Episode zu verkürzen.
Verapamil als Therapie der ersten Wahl
Obwohl Verapamil nicht für die Prophylaxe des Clusterkopfschmerzes zugelassen ist (off Label), gilt es im deutschsprachigen Raum als Standardtherapie und wird in den Leitlinien der neurologischen Fachgesellschaften entsprechend empfohlen. Diese breite Anwendung wird von der vorhandenen Evidenz und von jahrelanger klinischer Erfahrung getragen. Im Jahr 2012 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine Ausnahme in die Arzneimittel-Richtlinie aufgenommen: Verapamil darf seitdem im Rahmen des Off-Label-Use auf Kassenrezept zulasten der gesetzlichen Krankenkassen bei Clusterkopfschmerz verordnet werden. Dies gilt nur für Präparate von Herstellern, die dem G-BA-Beschluss zugestimmt haben (etwa die Hälfte der Anbieter). Aufgrund möglicher kardiovaskulärer Nebenwirkungen ist eine langsame Aufdosierung erforderlich, kann üblicherweise beginnend mit 40 mg, schrittweise bis zu einer Zieldosis von 360 bis 480 mg täglich, in Einzelfällen auch bis zu 960 mg aufdosiert werden. Elektrokardiografie-(EKG-) Kontrollen sind vor Therapiebeginn und bei Erreichen höherer Dosen obligat. Die Retardform (120 mg, 240 mg) ist derzeit die gängigste galenische Form, sie ist jedoch nicht ideal für flexible Dosierungsanpassungen. Verapamil sollte auch nach dem Abklingen der Bout-Phase noch für sechs bis acht Wochen fortgeführt werden, bevor ein langsames Ausschleichen entsprechend des Aufdosierungsschemas erfolgt. Ein vorzeitiges Absetzen kann zu einem Wiederaufflammen der Attacken führen. Bei erneuten Episoden ist eine erneute Aufdosierung möglich.
Lithium
Lithium ist in der Prophylaxe des Clusterkopfschmerzes offiziell zugelassen, wird jedoch in der klinischen Praxis wegen des schmalen therapeutischen Fensters, der Notwendigkeit eines engmaschigen Serumspiegel-Monitorings und häufiger Nebenwirkungen eher zurückhaltend eingesetzt. Die Anwendung erfolgt primär bei fehlendem Ansprechen auf Verapamil, meist initial als Kombinationstherapie mit späterem Wechsel. Insbesondere bei älteren Patienten ist die Handhabung schwierig. Lithiumcarbonat wird in Dosierungen von 600 bis 1500 mg täglich eingesetzt. Ein Plasmaspiegel von 1,2 mmol/l sollte nicht überschritten werden. Für eine ausreichende therapeutische Wirksamkeit scheint ein Mindest-Serumspiegel von 0,4 mmol/l erforderlich zu sein; ideal sind Werte im Bereich von 0,6 bis 0,8 mmol/l. Es wird jedoch auch diskutiert, dass möglicherweise keine eindeutige Korrelation zwischen dem Lithiumspiegel im Plasma und der klinischen Wirksamkeit besteht.
Weitere prophylaktische Optionen
Topiramat: Wird gelegentlich als Off-Label-Therapie eingesetzt, insbesondere bei begleitender Migräne. Aufgrund zahlreicher Nebenwirkungen (kognitive Einschränkungen, Gewichtsverlust) und eines ungünstigen Nutzen-Risiko-Profils ist der Einsatz jedoch limitiert. Frauen im gebärfähigen Alter sollten aufgrund teratogener Risiken (Rote-Hand-Brief) grundsätzlich nicht mit Topiramat behandelt werden. Melatonin: Trotz positiver experimenteller Befunde zeigt sich in der klinischen Anwendung häufig keine ausreichende Wirksamkeit. Melatonin hat sich insbesondere bei rein durch Clusterattacken bedingten Schlafunterbrechungen als nicht effektiv erwiesen.
Nicht empfohlene Therapieoptionen
Die Anwendung von Opioiden ist beim Clusterkopfschmerz kontraindiziert. Es besteht keine Evidenz für eine präventive oder akute Wirksamkeit, zudem ist das Abhängigkeitsrisiko hoch.
Okzipitalis-Blockade
Die Okzipitalis-Blockade stellt eine effektive therapeutische Option bei Clusterkopfschmerz dar, insbesondere in akuten Phasen oder bei Beginn einer Attackenserie. Die Infiltration erfolgt in der Regel am Austrittspunkt des Nervus occipitalis major oder minor, der gut palpatorisch auf Höhe der Linea nuchae in der Nähe der Protuberantia occipitalis externa lokalisiert werden kann. Die Durchführung kann in der Praxis auch ohne Ultraschallkontrolle erfolgen, da die anatomischen Landmarken in der Regel zuverlässig zu ertasten sind. Zur Injektion wird üblicherweise eine Kombination aus einem Glukokortikoid (z. B. 10 mg Triamcinolon) und einem Lokalanästhetikum verwendet. Letzteres ermöglicht eine rasche analgetiche Wirkung, während das Kortikosteroid eine länger anhaltende entzündungs-hemmende Komponente liefert. Die Applikation erfolgt meist einseitig entsprechend der betroffenen Seite, kann aber bei Bedarf auch beidseitig erfolgen. Wiederholungen der Infiltration im Abstand von etwa 14 Tagen sind möglich, wobei auf die kumulative Glukokortikoiddosis geachtet werden sollte. Bei mehrfacher Anwendung sind mögliche Nebenwirkungen wie eine lokale Fettgewebsatrophie oder in seltenen Fällen osteonekrotische Veränderungen zu berücksichtigen. In Einzelfällen wurden systemische Nebenwirkungen wie Schlafstörungen oder psychotische Symptome berichtet, insbesondere bei Glukokortikoid-sensiblen Personen oder bei gleichzeitig hoher systemischer Belastung. Insgesamt ist die Okzipitalis-Blockade ein praktikables, gut wirksames und nebenwirkungsarmes Verfahren, das auch bei Patienten mit Kontraindikationen für systemische Steroidgaben eine geeignete Alternative darstellen kann.
Invasive Therapieansätze
Invasive Therapieansätze beim Clusterkopfschmerz sind mit erheblichen Risiken verbunden und sollten nur in streng selektionierten Einzelfällen und nach Ausschöpfen konservativer Optionen in Betracht gezogen werden. Insbesondere die Anwendung von Okzipital-Nervenstimulatoren ist mit potenziellen Komplikationen wie Infektionen, dislozierten Elektroden oder der Ausbildung schmerzhafter Narbengewebe assoziiert. In der klinischen Praxis zeigt sich bei vielen Patienten die Notwendigkeit zur Revision oder Explantation der Systeme. Auch bei anderen Indikationen wie der Trigeminusneuralgie wurden vereinzelt schwere unerwünschte Ereignisse beobachtet, unter anderem traumatische Erfahrungen im Rahmen der Implantation, insbesondere bei unzureichender Analgosedierung. Die Stimulation des Ganglion sphenopalatinum stellt zwar eine weitere potenzielle Option dar, ist jedoch ebenfalls mit Vorsicht zu bewerten. In seltenen Fällen entwickeln Patienten infolge invasiver Interventionen persistierende neuropathische Gesichtsschmerzen, die mit einem erheblichen Leidensdruck einhergehen und therapeutisch kaum zugänglich sind. Auch wenn die Indikation wohlbegründet erscheint und die Datenlage selektiv einen Nutzen nahelegt, ist ein besonders zurückhaltender, risiko-basierter Umgang mit diesen Verfahren erforderlich. Diese Erfahrungen unterstreichen die Bedeutung einer differenzierten Nutzen-Risiko-Abwägung bei jeder Form interventioneller Schmerztherapie, insbesondere bei jungen Patienten.
Fazit
- Clusterkopfschmerz ist eine hochschmerzhafte, einseitig auftretende Kopfschmerzerkrankung mit charakteristischen autonomen Begleitsymptomen.
- Die Erkrankung führt zu erheblicher psychosozialer Belastung mit häufig komorbiden Depressionen und erhöhtem Suizidrisiko.
- Der Clusterkopfschmerz wird häufig übersehen, die Diagnoseverzögerung kann bis zu acht Jahre betragen.
- Bei Erstdiagnose müssen mögliche strukturelle Läsionen als sekundäre Ursachen ausgeschlossen werden.
- Die Akuttherapie umfasst Sauerstoffinhalation und Analgesie mit Sumatriptan 6 mg subkutan oder Zolmitriptan 5–10 mg intranasal.
- Als effektivste analgetische Akuttherapie gilt Sumatriptan 6 mg subkutan.
- Eine effektive interventionelle Therapieoption stellt die Okzipitalis-Blockade mittels Glukokortikoidinjektionen dar.
- Begleiterkrankungen wie psychische Störungen sowie kardiovaskuläre Risikofaktoren erhöhen die Krankheitslast und müssen mitbehandelt werden.
Bildnachweis
9nong – stock.adobe.com
Referenten
Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums Essen Leiterin des Schwindelzentrums Essen Oberärztin der Klinik für Neurologie Universitätsklinikum Essen (AöR) Klinik für Neurologie Hufelandstraße 55 D-45147 Essen Dr. med. Marc Borner, MHBA Praxis für Schmerztherapie Bornheim Trierer Straße 1 53332 BornheimInteressenkonflikte
Sponsoring
Diese Fortbildung wurde im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit 14.900 EUR durch die HORMOSAN PHARMA GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt