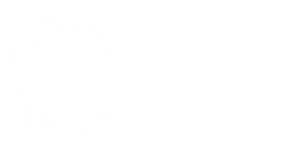Versorgungssituation und Therapie bei vaskulären Makulaödemen – ein Update
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
- epidemiologische Daten,
- verfügbare Therapieoptionen für vaskuläre Makulaödeme,
- Effekte moderner Medikamente für Krankheitskontrolle und Behandlungslast,
- Tipps zur Anwendung in der klinischen Routine.
Einleitung
Bei Patienten mit Diabetes mellitus ist das diabetische Makulaödem (DMÖ) eine der häufigsten mikrovaskulären Komplikationen und kann die Sehkraft der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Die 10-Jahres-Inzidenz für ein DMÖ liegt bei Patienten, die zum Zeitpunkt der Diagnose des Diabetes mellitus älter als 30 Jahre alt waren, bei 40 %. Derzeit sind weltweit etwa 19 Millionen Menschen von einem behandlungsbedürftigen, klinisch signifikanten DMÖ betroffen und ein weiterer deutlicher Anstieg auf 29 Millionen bis 2045 wird infolge der steigenden Zahlen an Patienten mit Diabetes mellitus erwartet. Gleichzeitig ist der Verlust des Augenlichtes die am meisten gefürchtete Komplikation von Patienten mit Diabetes - noch vor nephrologischen oder kardiologischen Komplikationen.
Hohe Belastung durch Behandlung
Zur Behandlung eines DMÖ stehen leistungsfähige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die bei rascher Diagnosestellung und konsequenter, individualisierter Langzeittherapie das Sehvermögen der Betroffenen erhalten oder wieder verbessern können. Für Patienten mit einem DMÖ mit Beteiligung der Fovea und mit einer Visusminderung ist derzeit eine intravitreale Medikamentengabe (IVOM) von Anti-VEGF-Wirkstoffen (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) die empfohlene Therapie. Allerdings stellt deren konsequente Einhaltung eine hohe Belastung für die Betroffenen dar. So berichteten in der Barometer-Umfrage, die in mehr als 70 Kliniken in 24 Ländern auf sechs Kontinenten durchgeführt wurde, die Patienten über eine hohe Gesamtbelastung durch die Anti-VEGF-Therapie: 58 % der Patienten gaben an, zwischen zwei und sechs Stunden für den Behandlungstermin zu benötigen. Etwas mehr als die Hälfte der Patienten berichteten, die Behandlungsfrequenz könne zu hoch sein, und waren besorgt, dass sie eine Belastung für Familie und Freunde sein könnten. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Patienten aufgrund der Grunderkrankung Diabetes zusätzlich von zahlreichen Komorbiditäten betroffen sind, für die ebenfalls ein hoher Behandlungsbedarf besteht: Einer retrospektiven Analyse zufolge müssen DMÖ-Patienten im erwerbsfähigen Alter pro Jahr durchschnittlich 25,5 Arztbesuche wahrnehmen.
Fachärztemangel bei steigenden Patientenzahlen
Zusätzlich steht die augenärztliche Versorgung vor großen Herausforderungen: Steigende Patientenzahlen bei gleichzeitig stagnierender und prognostizierter rückläufiger Zahl an Fachärzten sorgen dafür, dass zukünftig immer mehr Patienten durch immer weniger Ärzte versorgt werden müssen. Schon heute besteht in vor allem ländlichen Regionen Deutschlands Facharztmangel – und in den nächsten Jahren ist mit einem weiteren, deutlichen Rückgang von medizinischem Fachpersonal zu rechnen. Gleichzeitig treten allerdings die starken Jahrgänge der Babyboomer-Generation in das Alter ein, in dem sie zunehmend von chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder DMÖ betroffen sind und eine regelmäßige Therapie mit intravitrealen Injektionen benötigen. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere im Hinblick auf chronische Augenerkrankungen innovative Lösungen gefragt, um zukünftig deren adäquate Versorgung zu ermöglichen.
Umfangreiche Palette an Anti-VEGF-Wirkstoffen
Therapieoptionen, die bei vergleichbarem Visusgewinn verlängerte Behandlungsintervalle ermöglichen, können dazu beitragen, für eine gute Planbarkeit der Therapie und eine reduzierte Behandlungslast zu sorgen, um so auch zukünftig eine adäquate Versorgung zu ermöglichen. Schon heute stehen zur Behandlung des DMÖ verschiedene Anti-VEGF-Wirkstoffe einschließlich Biosimilars sowie Kortikosteroide zur Verfügung. Während Kortikosteroide wegen ihres ungünstigeren Nebenwirkungsprofils vorwiegend bei einem chronisch persistierenden DMÖ zum Einsatz kommen und eine wichtige Behandlungsoption darstellen, sind bei DMÖ mit fovealer Beteiligung und Visusminderung insbesondere bei noch klarer Linse die intravitrealen Anti-VEGF-Wirkstoffe die empfohlene Therapie. Basierend auf den vorliegenden Studienergebnissen weisen die derzeit verfügbaren Anti-VEGF-Wirkstoffe über einen Beobachtungszeitraum von zwei Jahren eine ähnliche Wirksamkeit hinsichtlich Visusentwicklung und Reduktion der zentralen Netzhautdicke auf. Allerdings wurde in den Studien deren Einsatz in unterschiedlichen Behandlungsintervallen und mit teilweise sehr unterschiedlichen Aktivitäts- bzw. Wiederbehandlungskriterien evaluiert. So wurden für Brolucizumab die Anwendung von Intervallen von bis zu zwölf Wochen, für Faricimab von bis zu 16 Wochen und für Aflibercept 2 mg von zwölf Wochen oder länger untersucht, während für das hochdosierte Aflibercept 8 mg sogar eine Intervalllänge von bis zu 24 Wochen untersucht wurde. Valide Daten für einen Vergleich der Wirkdauer der verschiedenen intravitrealen Wirkstoffe stehen weiterhin kaum zur Verfügung.
Mehrere Signalwege adressieren
Die zugelassenen Wirkstoffe unterscheiden sich u. a. hinsichtlich ihrer Dosis, Halbwertzeit und Bindungsaffinität sowie im Hinblick auf die adressierten Bindungsziele. Während Ranibizumab und Brolucizumab ausschließlich gegen VEGF-A gerichtet sind, bindet der bispezifische Antikörper Faricimab zusätzlich zu VEGF-A auch Angiopoetin-2. Diese duale Hemmung zielt darauf ab, die Gefäßpermeabilität und Entzündung zu reduzieren sowie die Angiogenese zu hemmen und die Gefäßstabilität zu fördern. Die Zulassungsstudien YOSEMITE und RHINE haben gezeigt, dass unter Faricimab mit Injektionsintervallen von zwölf oder 16 Wochen ähnlich gute Ergebnisse erzielt werden konnten, wie mit Aflibercept 2 mg in achtwöchigen Intervallen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass in dem Aflibercept-2-mg-Arm die Behandlungsintervalle nicht verlängert werden durften. Die ergänzende Stellungnahme der Fachgesellschaften hält dazu fest: „Hierbei ist aufgrund des Studiendesigns kein direkter Wirksamkeitsvergleich mit den anderen Wirkstoffen für die üblichen Behandlungsstrategien möglich. Auch die klinische Relevanz unterschiedlicher Therapieintervalle ist in zukünftigen Studien noch weiter zu klären.”
Auch Plazentawachstumsfaktor inhibieren
Im Vergleich zu den anderen Anti-VEGF-Medikamenten weist Aflibercept die größte Anzahl an Bindungszielen auf und ist der einzige breit zugelassene Wirkstoff, der alle VEGFR-1-Liganden (VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor) und den zentralen VEGFR-2-Liganden hemmt. Als einziger breit zugelassener Wirkstoff neutralisiert Aflibercept zusätzlich zu VEGF-A auch den Plazentawachstumsfaktor („placenta growth factor”, PlGF). Wird PlGF nicht abgefangen, so bleiben die über diesen Signaltransduktionsweg vermittelte Entzündungsreaktion und Leckage unberücksichtigt. Insbesondere für Patienten mit proliferativer diabetischer Retinopathie und DMÖ kann dies bedeutsam sein, da bei ihnen sowohl VEGF-A als auch PlGF deutlich erhöht vorliegen und sich bei der Ödembildung gegenseitig zu verstärken scheinen. Zudem weist der Wirkstoff auch die stärkste gemeldete Bindungsaffinität für VEGF-A im Vergleich zu anderen intravitrealen Medikamenten auf. Allerdings ist auch hier zu beachten, dass die Relevanz dieser molekularen Eigenschaften für die klinischen Ergebnisse bisher nicht klinisch nachgewiesen wurde. Außerdem ist ein Vergleich der Daten nur eingeschränkt möglich, da diese aus separaten, unabhängigen Studien mit unterschiedlichen Studienkollektiven stammen.
Dosiserhöhung für längere Wirkdauer
Aktuelle Weiterentwicklungen zielen darauf ab, den Wirkeffekt bei gleichzeitigem Erhalt der bekannten Wirkstärke zu verlängern, um so den Anteil an Patienten zu erhöhen, die mit langen Behandlungsintervallen behandelt werden können. Eine hohe molare Dosis ist eine wichtige Stellschraube zur Verlängerung des Wirkeffektes im Auge, da die Wirkstoffkonzentration im Auge bei höherer Ausgangsdosis länger über dem Schwellenwert für die VEGF-Suppression bleibt und sich somit die Wirkdauer verlängert. Ziel der Entwicklung von Aflibercept 8 mg war es, durch die vierfache Dosis im Vergleich zu Aflibercept 2 mg eine Verlängerung der effektiven Konzentration des Wirkstoffes im Glaskörper zu erreichen und so den Anteil an Patienten mit verlängerten Behandlungsintervallen von 16 Wochen oder mehr noch weiter zu steigern.
Vergleichbare Visusgewinne, weniger Injektionen
Der lang anhaltende Wirkeffekt von Aflibercept 8 mg wird durch die 3-Jahres-Daten (96 Wochen) der multizentrischen, randomisierten, doppelt maskierten Phase-III-Studie PHOTON bei Patienten mit DMÖ gezeigt. Bereits zu Baseline wurden die Patienten auf die drei Behandlungsarme Aflibercept 2 mg alle acht Wochen (AFL 2q8), Aflibercept 8 mg alle zwölf Wochen (AFL 8q12) und Aflibercept 8 mg alle 16 Wochen (AFL 8q16) randomisiert. Nach fünf initialen Uploaddosen in der 2q8-Gruppe und drei Uploaddosen in den beiden Aflibercept-8-mg-Gruppen wurde die Behandlung gemäß Randomisierung fortgesetzt. Im ersten Jahr waren nur Intervallverkürzungen je nach Krankheitsaktivität möglich, im zweiten Jahr konnten bei Krankheitsstabilität auch Intervallverlängerungen erfolgen. Im Verlauf der zweijährigen Studie erreichten die Patienten mit Aflibercept 8 mg anhaltende Visusgewinne, die denen unter Aflibercept 2 mg in festen achtwöchigen Intervallen vergleichbar waren – und dies bei einer deutlich geringeren Injektionszahl. So benötigten etwa Patienten im 8q16-Arm durchschnittlich sechs Injektionen weniger als im 2q8-Arm. Zudem konnte die Mehrheit der Patienten in den beiden Armen mit dem hochdosierten Präparat die ihnen zugewiesenen Behandlungsintervalle im ersten Jahr, in dem nur Intervallverkürzungen möglich waren, beibehalten Das Sicherheitsprofil entsprach über den gesamten Studienverlauf dem gut etablierten Sicherheitsprofil von Aflibercept 2 mg.
Hinweise für ruhigere Netzhaut
Nach Studienende konnten die Patienten zudem in einer optionalen Verlängerungsstudie weiterbehandelt werden. Dazu setzten die Patienten der beiden Aflibercept-8-mg-Arme die Behandlung in den zuletzt zugewiesenen Intervallen fort und konnten den zu Woche 96 erreichten Visus bis zu Woche 156 mit durchschnittlich 3,3 Injektionen aufrechterhalten. Außerdem konnten auch die Patienten des 2-mg-Behandlungsarmes nach Woche 96 ohne vorherigen Upload auf eine Behandlung mit 8 mg Aflibercept in einem zwölfwöchigen Intervall umgestellt werden. Auch in dieser Gruppe konnte der zu Woche 96 erreichte Visus bei reduzierter Behandlungslast bis zu Woche 156 aufrechterhalten werden. Zudem trat bei den Switch-Patienten nach der ersten Injektion des hochdosierten Präparates eine stärkere Verringerung der Netzhautdicke im Vergleich zu den ersten zwei Jahren sowie eine langsamere Netzhautdickenzunahme innerhalb der nächsten acht Wochen ein. Auch in Woche 156 wurde diese stärkere Reduktion der Netzhautdicke nach dem Switch auf das hochdosierte Präparat beobachtet. Darüber hinaus erreichten 83 % der Switch-Patienten ein zuletzt zugewiesenes Behandlungsintervall von zwölf Wochen oder mehr zu Woche 156.
Retinale Venenverschlüsse
Eine weitere, häufige Ursache für eine Sehverschlechterung ist ein Makulaödem (MÖ) infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV). Auch hier stellt die intravitreale Anti-VEGF-Therapie aufgrund des günstigeren okulären Nebenwirkungsprofils die initial bevorzugte Therapie dar. In den COMRADE-Studien wurde gezeigt, dass die Therapie mit Dexamethason-Implantat einen ebenfalls sehr schnellen Wirkeintritt zeigt, aber die Wirkdauer oft bereits nach zwei bis drei Monaten nachlässt. Damit ist gerade auch gegenüber den neuen Anti-VEGF-Substanzen mit längerer Wirkdauer keine deutliche Reduktion der Behandlungslast mehr gegeben. Allerdings ist bei fehlender und nicht ausreichender Reaktion auf VEGF-Hemmstoffe die intravitreale Steroidtherapie eine wertvolle Therapieoption, auf die einige Patienten sehr gut ansprechen, bei denen die entzündliche Komponente das Makulaödem unterhält. In Deutschland sind etwa 300.000 Menschen von einem MÖ infolge RVV betroffen, wobei Venenastverschlüsse (VAV) deutlich häufiger auftreten als Zentralvenenverschlüsse (ZVV). Die Prävalenz für einen RVV steigt mit dem Alter, häufig sind Menschen zwischen 60 und 70 Jahren betroffen. Die meisten Patienten mit RVV suchen den Augenarzt wegen Sehverschlechterungen infolge eines MÖ auf, aber für die Behandlungsplanung sollte auch das Vorliegen von Ischämien und Neovaskularisationen, die mit Glaskörperblutungen, Sekundärglaukom oder einer traktiven Netzhautablösung einhergehen können, beachtet werden.
Präzise Diagnosestellung – interdisziplinäre Abklärung
Die Fachgesellschaften empfehlen eine komplette augenärztliche Untersuchung mit Visus, Pupillenreaktionstestung, Augeninnendruckmessung, Kammerwinkelinspektion und Beurteilung des vorderen und hinteren Augenabschnittes in Mydriasis. Eine Fluoreszeinangiografie sollte erfolgen, sobald die retinale Blutung weitgehend resorbiert ist. Da es sich zudem bei RVV in der Regel um die Folge einer Systemerkrankung handelt, sollte nach retinalem Verschlussgeschehen eine interdisziplinäre Abklärung insbesondere von kardio- und zerebrovaskulären Risikofaktoren erfolgen und die Grunderkrankung angemessen kontrolliert werden. Zu den häufigsten mit RVV assoziierten Erkrankungen zählen neben arterieller Hypertonie auch Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus und Vorhofflimmern. Zudem sollte auch die Papillenmorphologie kontrolliert werden, um eine möglicherweise zugrunde liegende Glaukomerkrankung nicht zu übersehen. So weisen etwa 70 % aller RVV-Patienten auch ein Glaukom auf. Umgekehrt gilt das Vorliegen eines Glaukoms wiederum als wichtiger okulärer Risikofaktor für einen RVV. Weiterhin gilt es, zwischen ischämischen und nicht ischämischen Gefäßverschlüssen zu unterscheiden und dies aufgrund des hohen Konversionsrisikos auch im weiteren Therapieverlauf regelmäßig zu kontrollieren. Beispielhaft ist hier der Fall eines 70-jährigen Patienten mit einem zunächst nicht ischämischen Gefäßverschluss dargestellt, der bereits sehr gut auf eine Anti-VEGF-Therapie angesprochen hatte. Allerdings stellte er plötzlich eine erhebliche Sehverschlechterung fest, deren Ursache ein massiver ischämischer Schub war.
Biomarker in der OCT-Bildgebung
Im Zentrum der Diagnostik und Therapieplanung steht die optische Kohärenztomografie (OCT), mit der sich Flüssigkeitsansammlungen in der Makula präzise beurteilen lassen. Wesentlich für die Therapieplanung ist, das Ausmaß des MÖ zu beurteilen und mögliche Neovaskularisationen frühzeitig zu erkennen. Eine systemische Literaturrecherche ermittelte verschiedene OCT-Biomarker, die zu einer individualisierten Therapieplanung und Prognoseeinschätzung beim retinalen Venenverschluss beitragen können. So korrelieren unter anderem eine erhöhte zentrale Netzhautdicke sowie auch das Auftreten hyperreflektiver Foci (HRF) mit einem schlechteren Visus. Eine Desorganisation der inneren Netzhautschichten (DRIL, „disorganization of inner retinal layers”) weist ebenfalls auf eine schlechtere Visusprognose hin und zudem auf das Vorliegen einer Ischämie, während Defekte in den äußeren Netzhautschichten die stärkste negative prädiktive Aussagekraft besitzen.
Rasche und konsequente Therapie
Liegt ein MÖ infolge RVV vor, so ist eine rasche und konsequente intravitreale operative Medikamenteneingabe (IVOM-Therapie) indiziert. Dabei stehen mit Anti-VEGF-Medikamenten und Kortikosteroiden grundsätzlich zwei Wirkstoffklassen mit jeweils verschiedenen Präparaten zur Verfügung, mit denen sich ähnliche Visusergebnisse erzielen lassen. Allerdings gilt es, bei der Therapieplanung auch das Nebenwirkungsprofil und die Behandlungslast zu bedenken. So gehen Kortikosteroide mit einem erhöhten Risiko für Augeninnendruckerhöhung und Kataraktentwicklung einher. Zudem weist die Stellungnahme der Fachgesellschaften daraufhin, dass die Wirkung des Dexamethason-Implantates nach ca. 60 Tagen nachzulassen scheint und bei früherem Rezidiv ggf. frühere Re-Implantationen erwogen werden sollten, um eine konsequente Therapie aufrechtzuerhalten. Insgesamt wird die Anti-VEGF-Behandlung als Therapie der ersten Wahl empfohlen, während der Einsatz von Kortikosteroiden als Alternative für ausgewählte Patienten vorgesehen ist. Wesentliche Grundvoraussetzung für den Therapieerfolg ist ein rascher und intensiver Behandlungsstart, um eine zügige Rückbildung des Ödems zu erreichen und so morphologische Schäden gering und die Chance auf gute Visusergebnisse hoch zu halten. Gemäß Stellungnahme sollte mit einer Dreierserie monatlicher Anti-VEGF-Injektionen gestartet werden. Mindestens nach der dritten Injektion sollte das Ansprechen kontrolliert und bei weiterem Behandlungsbedarf die Therapie mit einer weiteren Dreierserie monatlicher Injektionen fortgesetzt werden. Bei – trotz Ansprechen – weiterhin vorliegendem, klinisch relevantem Restödem muss weiterbehandelt werden. Dazu können ab dem siebten Behandlungsmonat verschiedene individualisierte Injektionsschemata eingesetzt werden.
Verschiedene Anti-VEGF-Wirkstoffe?
Auch zur Behandlung eines MÖ nach RVV stehen mittlerweile – wie für andere retinale Erkrankungen auch – verschiedene Anti-VEGF-Medikamente zur Verfügung. Diese ermöglichen bei optimaler Therapieumsetzung einen Visusgewinn von durchschnittlich 15 bis 20 ETDRS-Buchstaben und verhindern die Entwicklung von Neovaskularisationen. Bislang liegen allerdings nur wenige Head-to-Head-Studien vor, die verschiedene Präparate unter Anwendung des gleichen Behandlungsregimes vergleichen. In der SCORE-II-Studie zum Vergleich von Bevacizumab und Aflibercept erreichten Patienten mit RVV (n = 362) in beiden Behandlungsgruppen mit durchschnittlich sechs Injektionen im Mittel einen Visusgewinn von über 18 ETDRS-Buchstaben. Allerdings ergab eine Post-hoc-Analyse deutliche Unterschiede bezüglich der anatomischen Ergebnisse. So erreichten in der Aflibercept-Gruppe signifikant mehr Augen einen Rückgang des MÖ (p < 0,001) als in der Bevacizumab-Gruppe. Zudem war der Anteil der Augen, bei denen sich innerhalb von sechs Monaten das MÖ vollständig zurückgebildet hatte, unter Aflibercept signifikant größer als unter Bevacizumab (Odds Ratio 0,28; p < 0,001). Weitere Hinweise auf mögliche Unterschiede liefert die prospektive LEAVO-Studie, in der die Nichtunterlegenheit von Aflibercept und Bevacizumab gegenüber Ranibizumab bei 463 ZVV-Patienten untersucht wurde. Die Patienten wurden nach vier monatlich aufeinanderfolgenden Injektionen bei bestehender Krankheitsaktivität im PRN-Regime weiterbehandelt. Der numerisch größte Visusgewinn zum Studienende (Woche 100) wurde in der Aflibercept-Gruppe mit durchschnittlich 15,1 ETDRS-Buchstaben erzielt, gefolgt von Ranibizumab (12,5) und Bevacizumab (9,8). Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Bevacizumab nicht gegen Aflibercept oder Ranibizumab austauschbar sei.
Daten erlauben keinen direkten Vergleich moderner Wirkstoffe
Seit Sommer 2024 ist auch Faricimab zur Behandlung einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems nach RVV zugelassen. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Faricimab wurde in den beiden zulassungsrelevanten Phase-III-Studien BALATON und COMINO untersucht und während der initialen Phase von 24 Wochen mit einer Behandlung mit Aflibercept 2 mg verglichen. In diesem Zeitraum erhielten alle Patienten sechs monatliche Injektionen des jeweiligen Wirkstoffes. Mit beiden Wirkstoffen erreichten die Patienten frühzeitige und anhaltende Visusverbesserungen, sodass der primäre Endpunkt, die Nichtunterlegenheit der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA) gegenüber Aflibercept in Woche 24, für Faricimab erreicht wurde. Zudem ergab sich bezogen auf den Ausgangswert eine schnelle und andauernde Trocknung der retinalen Flüssigkeit, gemessen anhand der Reduktion der zentralen Netzhautdicke. Ab Woche 24 konnten alle Patienten in einem individualisierten Therapieregime mit Faricimab behandelt werden. Im Mittel wurden die initial erzielten funktionellen und anatomischen Ergebnisse bis zum Studienende (Woche 72) aufrechterhalten. Ein Zusatznutzen von Faricimab konnte aufgrund der vorliegenden Daten gegenüber den Vergleichstherapien nicht nachgewiesen werden. Auch aus diesen Studien lässt sich kein Vergleich der beiden Wirkstoffe Faricimab und Aflibercept im Hinblick auf Wirksamkeitsdauer bzw. Injektionsfrequenz ableiten, da eine individuelle Anpassung der Dosierungsschemata nicht in beiden Armen möglich war.
Behandlungslast reduzieren
Auch bei RVV können – wie bei anderen retinalen Gefäßerkrankungen – individualisierte Therapieregime angewendet werden, um bei Krankheitsstabilität die Injektionsintervalle zu verlängern und die Behandlungslast zu reduzieren – bei gleichzeitigem Erhalt der initial erzielten Visusgewinne. In der PLATON-Studie wurde bei Patienten mit Venenastverschluss (n = 48) eine Behandlung mit Aflibercept 2 mg im „Treat-and-Extend”-(T&E-)Regime untersucht. In dieser war es nach der Uploadphase mit drei monatlichen Injektionen möglich, bei Krankheitsstabilität die Intervalle in vierwöchigen Schritten bis zu einem maximalen Intervall von 16 Wochen zu verlängern. Patienten, die schon während der Uploadphase einen Visus von ≥1,0 erreichten, konnten sofort mit verlängerten Intervallen weiterbehandelt werden. Mit dieser Vorgehensweise erreichten die Patienten im Mittel einen Visusgewinn von 23,6 ETDRS-Buchstaben, wobei 73 % der Patienten zum Studienende (Woche 52) einen Visusgewinn von ≥15 Buchstaben erzielt hatten. Zudem hatten 71 % der Patienten das maximal mögliche 16-wöchige Intervall erreicht (durchschnittliches Behandlungsintervall 14,4 Wochen). Auch Patienten mit MÖ nach einem Zentralvenenverschluss können mit Aflibercept 2 mg im T&E-Regime im Mittel einen Visusgewinn von etwa 20 ETDRS-Buchstaben bei sinkender Behandlungslast im Zeitverlauf erreichen, wie die Phase-IV-Studie CENTERA zeigt. Während einer Uploadphase erhielten die Patienten zunächst monatliche Injektionen bis zum Erreichen von Krankheitsstabilität oder bis zu Woche 20. Anschließend war bei Krankheitsstabilität eine Verlängerung der Behandlungsintervalle in zweiwöchigen Schritten möglich. Bereits innerhalb der ersten vier Wochen trat im Mittel eine rasche und ausgeprägte Visusverbesserung ein, die anschließend unter der Behandlung im T&E-Schema über anderthalb Jahre erhalten blieb. Gleichzeitig nahm die Behandlungslast im Studienverlauf ab: Waren innerhalb der ersten 24 Wochen noch durchschnittlich fünf Injektionen erforderlich, so reduzierte sich dies auf vier Injektionen zwischen Woche 24 und 52 sowie weiter auf nur drei Injektionen innerhalb der letzten 24 Wochen. Mehr als zwei Drittel der Patienten erreichten zum Studienende ein geplantes Intervall von acht Wochen oder länger. Auch morphologisch zeigten sich ein rasches Ansprechen und klinisch relevante Verbesserungen zu allen vorgesehenen Visiten: Direkt nach der ersten Injektion wurde die stärkste Reduktion der zentralen Netzhautdicke (–462 μm in Woche 4) beobachtet, zum Studienende war die Netzhautdicke im Mittel um 496 µm reduziert.
Gute Ergebnisse im klinischen Alltag
Auch im klinischen Alltag lassen sich mit einer Anti-VEGF-Therapie und individualisierten Therapieregimen bei Patienten mit RVV rasche und klinisch relevante Visusgewinne sowie eine Reduktion der zentralen Netzhautdicke erzielen – und bei abnehmender Behandlungslast anhaltend aufrechterhalten. Dies zeigt u. a. die derzeit größte, weltweite prospektive Beobachtungsstudie AURIGA mit über 600 Patienten mit MÖ nach RVV zum Einsatz von Aflibercept 2 mg in der klinischen Routinepraxis. Im 24-monatigen Verlauf erreichten behandlungsnaive Patienten mit MÖ infolge RVV im Mittel nach 6,9 Injektionen einen Visusgewinn von 11,4 ETDRS-Buchstaben.
Ausblick
Zukünftig könnte auch das hochdosierte Aflibercept 8 mg dazu beitragen, auch bei Patienten mit MÖ nach RVV die Behandlungslast weiter zu reduzieren. Dies legen die ersten positiven Ergebnisse der multizentrischen, doppelt verblindeten Phase-III-Studie QUASAR nahe, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Aflibercept 8 mg bei behandlungsnaiven Patienten mit MÖ infolge RVV untersucht wird. Verglichen wird eine Behandlung mit Aflibercept 8 mg alle acht Wochen (nach initialem Upload mit drei oder fünf monatlichen Injektionen) mit einer monatlichen Behandlung mit Aflibercept 2 mg. Erste Ergebnisse der QUASAR-Studie zeigen, dass der primäre Endpunkt der Studie, die Nichtunterlegenheit von Aflibercept 8 mg gegenüber Aflibercept 2 mg hinsichtlich der durchschnittlichen Veränderung des bestkorrigierten Visus zu Woche 36 gegenüber dem Ausgangswert, erreicht wurde. Gleichzeitig wurden unter Aflibercept 8 mg weniger Injektionen verabreicht als unter Aflibercept 2 mg. Die überwiegende Mehrheit der Patienten unter dem hochdosierten Präparat konnte die achtwöchigen Intervalle bis zu Woche 36 beibehalten. Zusätzlich erzielte Aflibercept 8 mg eine schnelle Reduktion der zentralen Makuladicke zu Woche 36. Das Medikament zeigte eine gute Verträglichkeit und bestätigte das bekannte Sicherheitsprofil von Aflibercept 2 mg.
Fazit
- Die intravitreale Anti-VEGF-Therapie hat sich als initiale Behandlung eines visusmindernden DMÖ mit fovealer Beteiligung sowie bei Makulaödem nach RVV etabliert.
- Bei beiden Erkrankungen sind ein intensiver Therapiestart und eine konsequente Weiterbehandlung wesentlich für langfristig gute Visusergebnisse.
- Strukturelle, regionale, logistische Herausforderungen können eine adäquate augenärztliche Versorgung erschweren.
- Mit individualisierter Behandlung im T&E-Regime können initial erzielte Visusgewinne bei gleichzeitiger Reduktion der Behandlungslast dauerhaft erhalten werden.
- Bei RVV und DMÖ müssen neben der Kontrolle des Ausmaßes des MÖ im (Therapie-)Verlauf regelmäßige funduskopische Kontrollen erfolgen, um den Schweregrad der Retinopathie einzuschätzen und eventuelle Neovaskularisationen früh zu erkennen.
- Vor Therapiebeginn sollte beim DMÖ und RVV eine Fluoreszeinangiografie zur Abschätzung der Ischämie erfolgen, bei RVV kann aber bei vorhandenen kräftigen retinalen Blutungen erst deren Resorption zur besseren Beurteilung abgewartet werden.
Bildnachweis
GS-Studio – Adobe Stock
Referenten
Prof. Dr. med. Helmut Sachs Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde Carl-Thiem-Klinikum Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem Thiemstr. 111 03048 Cottbus Prof. Dr. med. Hans Hoerauf Theaterplatz 7 37073 GöttingenInteressenkonflikte
Interessenkonflikte Prof. Dr. Hans Hoerauf: Abbvie, Alcon, Allergan, Bayer, Biogen, Heidelberg-Engineering, Novartis, Roche, Stada,Thea, Outlook TherapeuticsSponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum 27.09.2024 bis 26.09.2025 mit EURO 14.900,- durch die Bayer Vital GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt