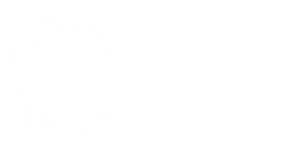Update kardiale Bildgebung bei koronarer Herzkrankheit
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
- die Indikationen und aktuelle Entwicklungen in der bildgebenden Diagnostik der KHK,
- den Stellenwert der Low-Dose-CT mit Berechnung des Koronarkalk-Scores (Agatston-Score) sowie der CT-Koronarangiografie,
- die Vorteile der funktionellen Bildgebung, einschließlich der Stress-Perfusions-MRT und Myokard-Perfusions-SPECT,
- die Prinzipien eines personalisierten, leitliniengerechten und multimodalen bildgebenden Ansatzes bei KHK.
Einleitung
Die Computertomografie des Herzens (Herz-CT) zur Beurteilung der Koronargefäße ist inzwischen weit verbreitet und ein aktuelles Thema, das sowohl in Fachkreisen als auch in der Presse viel diskutiert wird. Seit dem 1. Januar 2025 ist sie in Deutschland eine von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckte Leistung, die ambulant durchgeführt und abgerechnet werden kann. Diese Entwicklung ist für viele Patienten von großem Nutzen, da die koronare Herzerkrankung (KHK) weiterhin eine weit verbreitete und potenziell lebensbedrohliche Erkrankung darstellt. Die KHK stellt die klinisch relevante Manifestation der Atherosklerose an den Koronararterien dar. Sie verläuft in der Regel progredient und führt im Verlauf häufig zu einem Missverhältnis zwischen myokardialem Sauerstoffbedarf und -angebot. Klinisch manifestiert sich die Erkrankung typischerweise in Form einer belastungsabhängigen Angina pectoris. Die KHK ist mit einem signifikant erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität, vor allem infolge eines Myokardinfarktes, assoziiert. Eine frühzeitige Diagnose und risikoadaptierte Therapiekonzepte sind daher entscheidend, um kardiale Ereignisse zu verhindern und die Prognose zu verbessern. Die ischämischen Herzkrankheiten stellen in Deutschland die häufigste Todesursache dar. Prävalenz und Krankheitslast steigen mit zunehmendem Alter deutlich an. Ab einem Lebensalter von 60 Jahren liegt die Prävalenz bei >5 %. Männer sind dabei häufiger betroffen als Frauen. Die KHK ist allerdings keine ausschließliche Erkrankung des höheren Lebensalters. Sie tritt nicht selten bereits im mittleren Lebensalter auf, was das Risiko eines unerkannten kardiovaskulären Ereignisses erhöht und die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnostik unterstreicht. Allerdings erleidet ein erheblicher Anteil der Betroffenen den ersten Myokardinfarkt, obwohl sie zuvor als Patienten mit niedrigem Risiko eingestuft wurden und keine prodromalen Symptome aufwiesen. Dies verdeutlicht die Grenzen rein klinischer und laborchemischer Risikofaktoren für die Früherkennung. Moderne bildgebende Verfahren können hier viele Vorteile bieten und spielen in der klinischen Praxis eine zunehmend wichtige Rolle. Für die Diagnostik stehen gegenwärtig prinzipiell zwei unterschiedliche bildgebende Ansätze zur Verfügung: einerseits die anatomische Bildgebung, insbesondere durch Herz-CT, zur Darstellung koronarer Plaques und Gefäßveränderungen und andererseits die funktionelle Bildgebung zur Beurteilung der hämodynamischen Relevanz von Stenosen.
CT-basierte Bildgebung der koronaren Herzkrankheit
Für die CT-Diagnostik der KHK stehen zwei Modalitäten zur Verfügung: die Low-Dose-CT mit Berechnung des Koronarkalk-Scores (Agatston-Score) und die CT-Koronarangiografie („coronary computed tomography angiography, CCTA).
Koronarkalk-Score (Agatston-Score)
Die Bestimmung des Koronarkalkes erfolgt mit nicht kontrastverstärkter Low-Dose-CT und dient zur Quantifizierung koronarer Verkalkungen. Es handelt sich um eine schnell durchführbare und strahlungsarme Untersuchung, die aber als Limitation ausschließlich kalzifizierte Plaques erfasst. Die Risikokalkulation erfolgt in der Regel anhand des Agatston-Scores (auch Koronarkalk-Score, CAC-Score), der auf einem standardisierten Verfahren zur Flächen- und Dichtemessung basiert. Ein Agatston-Score von 0 weist auf das gänzliche Fehlen nachweisbarer Verkalkungen hin und ist mit einem „sehr niedrigen” kardiovaskulären Risiko im Verlauf von zehn Jahren assoziiert (<0,5 % über fünf bis sechs Jahre, <4 % über zehn Jahre), die sog. „power of zero”. Mit zunehmendem Score steigt das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse linear an. Werte von 1 bis 100 gelten als „leicht erhöht”, 101 bis 300 als „mäßig erhöht” und >300 als „hochgradig erhöht”. Ein Wert >1000 wird als Ausdruck eines „extrem hohen Risikos“ gewertet, vergleichbar mit dem Risiko bei Personen mit einem bereits überstandenen Myokardinfarkt. Daten aus großen Kohortenstudien wie der Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) oder der Heinz-Nixdorf-Recall-Studie belegen den prädiktiven Wert des Agatston-Scores, unabhängig von klassischen klinischen Risikofaktoren wie Adipositas und Dyslipidämie. So kann bei bis zu 30 % der Personen ohne nachweisbare klassische Risikofaktoren bereits signifikanter Koronarkalk nachgewiesen werden. Umgekehrt zeigt ein gewisser Anteil von Personen mit multiplen klassischen Risikofaktoren keine messbare Verkalkung. Besonders hilfreich ist der Score auch zur genauen Risikoabschätzung bei Patienten mit erhöhtem Lipoprotein (a) (Lp(a)) (Referenzbereich in aller Regel <30 mg/dl), einem wichtigen, weitgehend genetisch determinierten kardiovaskulären Risikofaktor. Liegt bei diesen Patienten ein Agatston-Score >100 vor, ist von einem deutlich erhöhten kardiovaskulären Risiko auszugehen. Internationale Fachgesellschaften empfehlen den Einsatz der Koronarkalkbestimmung bei asymptomatischen Personen im Alter von etwa 40 bis 75 Jahren mit niedrigem bis intermediärem kardiovaskulären Risiko, insbesondere wenn eine primärpräventive lipidsenkende Therapie diskutiert wird. Eine Verlaufsuntersuchung mit Bestimmung des Scores wird im Regelfall nicht empfohlen.
CT-Koronarangiografie
Die CCTA stellt im Vergleich zur Low-Dose-CT ein komplexeres Verfahren dar, bei dem unter Gabe von jodhaltigem Kontrastmittel und pharmakologischer Vorbereitung (z. B. Betablocker und sublinguales Nitroglyzerin) eine Darstellung der Koronargefäße erfolgt. Sie ist mit einer höheren Strahlenexposition verbunden. Neben verkalkten Plaques können hier insbesondere auch nicht kalzifizierte, sogenannte weiche Plaques detektiert werden. Im Gegensatz zum Agatston-Score allein erlaubt die CCTA somit eine umfassendere anatomische und stadienübergreifende Beurteilung des Koronargefäßstatus. Aufgrund der höheren Aussagekraft hinsichtlich Plaque-Morphologie und potenzieller Stenosen kommt die CCTA insbesondere bei symptomatischen Patienten mit intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit zur Anwendung. Sie ermöglicht eine differenzierte Risikostratifizierung und kann helfen, eine invasive Diagnostik zu vermeiden oder gezielt einzusetzen
Fallbeispiel 1: Koronarkalk zur individuellen Risikostratifizierung
Ein 66-jähriger Patient stellte sich im Rahmen eines kardiologischen Routine-Check-ups erstmalig vor. Anamnestisch bestanden keine kardio-pulmonalen Beschwerden. Der Patient war körperlich aktiv (regelmäßiges Wandern, Radfahren und Golf), Nichtraucher, ohne Hinweise auf vorherige kardiovaskuläre Ereignisse. Die klinische Untersuchung sowie Ruhe-Elektrokardiogramm (EKG) und transthorakale Echokardiografie waren unauffällig. Auch die Duplexsonografie der extrakraniellen Halsgefäße zeigte keine pathologischen Befunde. Laborchemisch fiel eine Dyslipidämie auf (Gesamtcholesterin 231 mg/dl, erhöhtes LDL-Cholesterin sowie Lp(a) mit 65 mg/dl). Als einzige relevante Vorerkrankung war eine bekannte arterielle Hypertonie dokumentiert, die bei intermittierender Therapieadhärenz jedoch überwiegend normoton eingestellt war. Eine medikamentöse Lipidsenkung mit einem Statin wurde vom Patienten ausdrücklich abgelehnt. Gemäß den aktuellen Leitlinien wurde das kardiovaskuläre 10-Jahres-Risiko mit dem SCORE2-Calculator bestimmt. Bei einem berechneten Risiko von 9,4 % lag der Patient an der Schwelle zum Hochrisikobereich (≥10 %). Zur weiteren Risikoeinordnung erfolgte eine native Koronarkalkbestimmung durch Low-Dose-CT. Der ermittelte Agatston-Score betrug 313, entsprechend einer relevanten koronaren Verkalkung mit Befall insbesondere im Bereich des Ramus interventricularis anterior und des Ramus circumflexus. Unter Einbezug des Koronarkalkes wurde das kardiovaskuläre Risiko mithilfe eines validierten Onlinekalkulators neu berechnet. Das resultierende 10-Jahres-Ereignisrisiko stieg auf 15 %, das errechnete „koronare Alter“ entsprach 80 Jahren, also 14 Jahre über dem kalendarischen Alter des Patienten. Unter Berücksichtigung der neuen Befunde stimmte der Patient einer Statintherapie zu. Der Fall verdeutlicht den prognostischen Zusatznutzen der Koronarkalkbestimmung zur individuellen Risikostratifizierung bei asymptomatischen Patienten mit einem niedrigen bis intermediären Risiko. Ende Fallbeispiel. Ein wichtiges und bislang weitgehend ungenutztes Potenzial liegt in der sogenannten opportunistischen Kalkdetektion. Weltweit werden jährlich Millionen von Thorax-CT für diverse Indikationen durchgeführt, ohne dass ein systematisches Koronarkalk-Screening erfolgt. Eine standardisierte Mitbeurteilung der Koronararterienverkalkung in diesen Routine-CT-Aufnahmen könnte zur frühzeitigen Identifikation von Hochrisikopatienten beitragen. Ein praxisnaher Ansatz zur opportunistischen Detektion koronarer Verkalkungen besteht darin, Patienten aktiv nach in den letzten vier bis fünf Jahren durchgeführten Thorax-CT-Untersuchungen zu befragen. In vielen Fällen lässt sich der Koronarkalk retrospektiv auf den vorhandenen Aufnahmen identifizieren. Für die visuelle Einschätzung stehen standardisierte semiquantitative Scores zur Verfügung, die in ihrer Aussagekraft gut mit dem etablierten Agatston-Score korrelieren. Zunehmend rücken auch Verfahren, die sich auf künstliche Intelligenz (KI) stützen, in den Fokus. Solche Verfahren ermöglichen die automatisierte Auswertung von Koronarkalk in Routine-CT-Datensätzen. Diese Technologien befinden sich aktuell noch in der wissenschaftlichen Erprobung, könnten jedoch in naher Zukunft breitere Anwendung in der Praxis finden.
CT-Koronarangiografie als First-Line-Diagnostik bei Verdacht auf koronare Herzkrankheit
Aktuelle Leitlinien, insbesondere die der European Society of Cardiology (ESC) sowie der American Heart Association (AHA) und des American College of Cardiology (ACC), empfehlen die CCTA als First-Line-Test bei Patienten mit Verdacht auf KHK. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Einschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit, die anhand von Patientencharakteristika und dem klinischen Beschwerdebild berechnet wird. Für Patienten mit intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit (üblicherweise entsprechend 15 bis 50 %) wird klar die CCTA empfohlen, insbesondere wenn mögliche Symptome vorliegen. In der klinischen Praxis gestaltet sich die genaue Berechnung dieser Vortestwahrscheinlichkeit jedoch mitunter als schwierig und spiegelt nicht immer den individuellen Kontext des Patienten wider. Die CCTA hat sich in den vergangenen Jahren technisch stark weiterentwickelt. Das Verfahren ermöglicht heute eine umfassende Beurteilung der Koronargefäße, die über die reine Beurteilung des Stenosegrades hinausgeht. Die CCTA ermöglicht eine differenzierte Charakterisierung der koronaren Plaques. Von besonderem Interesse ist die Detektion vulnerabler („Hochrisiko-”) Plaques, deren Vorhandensein mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, insbesondere Myokardinfarkte, einhergeht. Studien wie PROMISE und SCOT-HEART identifizierten vier wesentliche morphologische Merkmale solcher vulnerablen Plaques:
- Positives Remodeling
- Das sogenannte „napkin-ring sign”
- Niedrige Dichte (<30 Hounsfield-Einheiten)
- Lokal begrenzte „Spotty”-Verkalkungen
Fallbeispiel 2: Früher Nachweis einer koronaren Stenose bei jungem Patienten mit familiärer Belastung
Ein 43-jähriger Patient stellte sich zur kardiologischen Vorsorgeuntersuchung vor. Auffällig war eine Familienanamnese mit Myokardinfarkten sowohl beim Vater als auch beim Bruder, die jeweils bereits im ungefähren Alter des Patienten zum Zeitpunkt der Vorstellung auftraten. Der Patient war völlig asymptomatisch, körperlich belastbar, und die Basisdiagnostik einschließlich Ruhe-EKG und transthorakaler Echokardiografie zeigte keine Auffälligkeiten. Laborchemisch fiel eine deutlich erhöhte Lp(a)-Konzentration von 168 mg/dl auf. Die Ergometrie ergab eine Belastbarkeit von 175 Watt ohne belastungsinduzierte Beschwerden, jedoch mit vereinzelten ventrikulären Extrasystolen (VES). Aufgrund der Gesamtsituation wurde eine CCTA durchgeführt. Die Untersuchung zeigte eine nahezu filiforme Stenose im mittleren Segment der Ramus interventricularis anterior. Dieser Befund wurde im Anschluss durch eine invasive Koronarangiografie bestätigt. In diesem Rahmen erhielt der Patient eine koronare Intervention mit Stentplatzierung.
Innovative Technologien in der CT-Bildgebung der koronaren Herzkrankheit
Die Photon-Counting-CT (Photonen-zählende CT) stellt eine neue technologische Entwicklung in der kardialen Bildgebung dar und bietet eine deutlich höhere räumliche Auflösung im Vergleich zur herkömmlichen CT. Insbesondere bei Patienten mit ausgeprägten koronaren Verkalkungen oder Stents ermöglicht diese Technologie eine verbesserte diagnostische Beurteilung der Koronararterien, die im konventionellen CT aufgrund von Artefakten häufig eingeschränkt ist. Derzeit steht die Photon-Counting-CT nur in wenigen spezialisierten Zentren in Deutschland zur Verfügung, wird jedoch voraussichtlich in den kommenden Jahren zunehmend verfügbar sein. Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Forschung liegt auf der Untersuchung des perivaskulären Fettgewebes. Diese perivaskuläre Entzündungsaktivität lässt sich mithilfe moderner Bildgebungsparameter quantifizieren und liefert somit zusätzliche prognostische Informationen. Eine führende Arbeitsgruppe aus Oxford konnte zeigen, dass Veränderungen im Fettgewebe um die Koronararterien unabhängig von Plaquelast und Stenosegrad als prädiktiver Marker für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko zu werten sind. Zur Optimierung der Bildauswertung gewinnen auch hier KI-basierte Analyseverfahren zunehmend an Bedeutung. Diese automatisierten Verfahren erlauben eine präzise Quantifizierung verkalkter und nicht verkalkter Plaques im gesamten Koronarsystem. Aktuelle Studien untersuchen die Leistungsfähigkeit solcher Methoden für die Verlaufsbeurteilung und Therapieüberwachung.
Notwendigkeit der funktionellen kardialen Bildgebung bei Verdacht auf koronare Herzkrankheit
Es ist sehr wichtig zu beachten, dass unter den Hauptmechanismen der Myokardischämie neben strukturellen auch funktionelle Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Dies hat unmittelbare praktische Konsequenzen für die bildgebende Diagnostik. Die rein anatomische Darstellung der Koronararterien, etwa mit CCTA oder invasiver Koronarangiografie, zeichnet sich durch eine hohe Sensitivität aus, weist jedoch eine eingeschränkte Spezifität auf. Insbesondere besteht das Risiko des sogenannten „overcallings”, also der Überdiagnostik und damit verbundener Übertherapie von Läsionen ohne hämodynamische Relevanz. Patienten werden damit unnötig den Risiken interventioneller Therapien ausgesetzt, zum Beispiel bei einer angiografisch 70%igen Koronarstenose ohne signifikante Funktionseinschränkung in der fraktionellen Flussreserve-(FFR-)Messung >0,80. Die funktionelle Bildgebung ergänzt die rein anatomische Diagnostik um die Beurteilung der hämodynamischen Relevanz von Stenosen und ist somit entscheidend, um Patienten gezielt für geeignete Interventionen zu selektieren. Darüber hinaus liefert sie wichtige Informationen zur Risikoabschätzung vor operativen Eingriffen oder Sportfreigaben. Funktionelle Verfahren erlauben zudem die Erkennung pathophysiologischer Veränderungen jenseits obstruktiver Läsionen, wie beispielsweise Mikrogefäßstörungen, Vasospasmen oder hämodynamisch relevante Muskelbrücken. Je nach Modalität ist auch eine Aussage hinsichtlich der myokardialen Vitalität möglich. Gemäß den aktuellen Leitlinien der ESC zum chronischen Koronarsyndrom wird die Auswahl der diagnostischen Modalität anhand der klinischen Vortestwahrscheinlichkeit gesteuert:
- Bei niedriger bis intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit wird die CCTA bevorzugt.
- Bei mäßiger oder hoher Vortestwahrscheinlichkeit sollte eine funktionelle Bildgebung erfolgen.
- Bei sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird direkt die invasive Koronarangiografie empfohlen.
Stellenwert von Stresstests
Lange Zeit war das Belastungs-EKG (Ergometrie) das am häufigsten eingesetzte Stressverfahren, da es kostengünstig, weit verbreitet und einfach durchführbar ist. Die Sensitivität und Spezifität sind jedoch begrenzt, sodass die diagnostische Aussagekraft im Vergleich zu modernen bildgebenden Verfahren deutlich geringer ist. Das Belastungs-EKG behält dennoch eine wichtige Rolle bei der Detektion belastungsabhängiger Arrhythmien, der Bewertung des Blutdruckverhaltens unter Belastung sowie der quantitativen Einschätzung der individuellen Belastbarkeit. Zur direkten Diagnostik einer KHK ist das Belastungs-EKG jedoch nur noch sehr eingeschränkt indiziert und wird zunehmend durch bildgebende Verfahren ersetzt. Derzeit stehen hauptsächlich drei bildgebende Stresstests zur Verfügung: Stressechokardiografie: Weitverbreitet und kostengünstig, ohne Strahlenbelastung. Neben der Beurteilung von etwaigen regionalen Wandbewegungsstörungen und Ventrikelfunktion erlaubt sie auch eine gleichzeitige Evaluation der Herzklappen. Die Qualität der Untersuchung ist jedoch abhängig von der Expertise des Untersuchers sowie der Eignung des Schallfensters des Patienten. Die Quantifizierung bleibt subjektiv und untersucherabhängig. Myokard-Perfusions-SPECT: Ebenfalls breit verfügbar und mit guter objektiver Quantifizierbarkeit, geht jedoch mit einer Strahlenbelastung einher. Die Methode ist weniger von der Patientenkonstitution oder dem Untersucher abhängig, jedoch limitiert hinsichtlich der Beantwortung von Fragestellungen außerhalb der myokardialen Ischämie. Kardiales Stress-Perfusions-MRT: Bietet hochauflösende Aussagen zur Myokardfunktion und -anatomie sowie Gewebetypisierung; das Verfahren weist keine Strahlenexposition auf. Nachteile sind jedoch der höhere Kosten-, Zeit- und Ressourcenaufwand sowie die erforderliche technische Expertise, die bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) vergeben für diese drei Verfahren eine Klasse-I-Empfehlung zur Diagnostik der funktionellen Relevanz einer KHK. Die Wahl des geeigneten Verfahrens sollte dabei an die klinische Fragestellung, die individuelle Patientensituation sowie die lokal verfügbare Expertise und Infrastruktur angepasst werden. Bei sachgerechter Auswahl unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist bei allen drei Verfahren von einer hohen diagnostischen Sicherheit auszugehen.
Fallbeispiel 3: Belastungsabhängige Luftnot und Wandbewegungsstörung im Stressechokardiogramm
Ein 58-jähriger Patient stellte sich mit belastungsabhängiger Luftnot und Leistungsminderung vor. Zudem berichtete er über einmalige thorakale Schmerzen während einer Bergtour. Die Vortestwahrscheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit wurde anhand der Symptomatik zwischen 17 und 32 % eingeschätzt. Zur weiteren Abklärung wurde eine Stressechokardiografie durchgeführt. Unter Belastung ab ca. 75 Watt zeigte sich im apikalen Septum sowie im Bereich des Apex eine hypokinetische Wandbewegungsstörung, was als Indikator für eine relevante myokardiale Durchblutungsstörung interpretiert wurde. Aufgrund der Befunde erfolgte im nächsten Schritt eine invasive Koronarangiografie, die eine hochgradige Stenose der linken Vorderwandarterie (LAD) bestätigte, die in derselben Sitzung mit einem Stent versorgt wurde. Dieses Fallbeispiel illustriert den klinischen Wert der Stressechokardiografie als funktionelles Verfahren zur Identifikation hämodynamisch relevanter Koronarstenosen bei Patienten mit typischer Symptomatik und moderater Vortestwahrscheinlichkeit. Ende Fallbeispiel. Zur nicht invasiven Induktion einer myokardialen Belastung stehen sowohl physische als auch medikamentöse Verfahren zur Verfügung. Die klassische Methode im Rahmen der Stressechokardiografie ist die ergometrische Belastung mit standardisiertem Stufenprotokoll, bei dem in definierten Leistungsstufen (in der Regel Ruhe, submaximale, maximale Belastung und Postbelastung) kardiovaskuläre Parameter beurteilt werden. Im Rahmen der medikamentösen Stressinduktion kommt in aller Regel primär Dobutamin zum Einsatz, das gewichtsadaptiv in ansteigender Dosierung intravenös appliziert wird. Die häufigsten Komplikationen im Rahmen des Stressechokardiogramms sind ventrikuläre Arrhythmien. Der Einsatz von Dobutamin sollte daher vorzugsweise in Einrichtungen erfolgen, die eine adäquate Überwachung der Vitalparameter gewährleisten und nötigenfalls eine Notfallversorgung sicherstellen können. Der zeitlich verzögerte Wirkungseintritt der Inotropie unter Dobutamin verlangt allerdings Geduld und Erfahrung vom Untersucher. In der Myokard-Perfusions-SPECT sowie in der Stress-Perfusions-MRT hat sich Regadenoson zunehmend als pharmakologisches Stressmittel der Wahl etabliert und Adenosin weitergehend abgelöst. Der Vorteil von Regadenoson liegt in der einfachen Handhabung als Einmalbolus über eine periphere Vene sowie in der kurzen Halbwertszeit. Zudem ist keine körpergewichtsadaptierte Dosierung erforderlich. Im Vergleich zu Adenosin sind unter Regadenoson signifikant weniger Nebenwirkungen, insbesondere weniger Fälle von atrioventrikulärem Bloc, dokumentiert. Darüber hinaus ist es mit gängigen kardiovaskulär wirksamen Medikamenten, wie z. B. ACE-Hemmern, risikoarm kombinierbar. Ein direkter Vergleich zwischen Stress-Perfusions-MRT und Myokard-Perfusions-SPECT erfolgte im Rahmen der GadaCAD2-Studie. Dabei zeigte die Stress-Perfusions-MRT eine höhere diagnostische Genauigkeit. Neben der Beurteilung einer myokardialen Perfusion erlaubt das Verfahren auch eine Gewebedifferenzierung durch Late Gadolinium Enhancement (LGE) sowie Aussagen zur ventrikulären Morphologie und Funktion. Somit kann die Methode auch dann hilfreich sein, wenn keine Ischämie vorliegt, aber strukturelle Herzerkrankungen vermutet werden. Trotz der überlegenen Sensitivität und Spezifität der Stress-Perfusions-MRT besteht in der klinischen Routine für dieses Verfahren weiterhin eine eingeschränkte Verfügbarkeit und keine regelhafte Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung.
Fallbeispiel 4: Funktionelle Bildgebung bei bekannter KHK und geplanter nicht kardialer Operation
Ein 79-jähriger Patient mit bekannter KHK und Zustand nach aortokoronarem Bypass erhielt aufgrund belastungsabhängiger thorakaler Beschwerden mit Angina pectoris eine medikamentöse Myokard-Perfusions-SPECT. Eine ergometrische Belastung war infolge ausgeprägter Hüftbeschwerden nicht durchführbar. Die Untersuchung ergab eine ausgeprägte Ischämie der Lateralwand mit einem betroffenen Myokardareal von 23 %. In der konsekutiv durchgeführten invasiven Koronarangiografie zeigte sich ein Verschluss eines Bypasses, jedoch ohne Nachweis einer myokardialen Narbe. Zusätzlich wurde eine filiforme Stenose der distalen Ramus circumflexus diagnostiziert und mithilfe eines Stenteinsatzes therapiert. Der Patient stellte sich ein Jahr später erneut vor, diesmal zur kardiologischen Abklärung im Vorfeld einer geplanten Hüfttotalendoprothese. Aufgrund persistierender, jedoch atypischer thorakaler Beschwerden erfolgte eine erneute Myokardszintigrafie. Diese zeigte einen unauffälligen Befund ohne Hinweis auf eine relevante Ischämie. In der Folge konnte der Patient operativ versorgt werden. Dieses Fallbeispiel unterstreicht die Bedeutung der funktionellen Bildgebung bei Patienten mit bekannter KHK und erhöhter Vortestwahrscheinlichkeit, insbesondere auch im Vorfeld größerer operativer Eingriffe. Ende Fallbeispiel. Die Auswahl der geeigneten Bildgebungsmodalität zur myokardialen Ischämiediagnostik hängt maßgeblich von patientenbezogenen Faktoren, der zugrunde liegenden Fragestellung sowie den lokal verfügbaren Ressourcen und der diagnostischen Expertise des Zentrums ab. Nur bei ausreichender Erfahrung mit der jeweiligen Methode ist eine valide Befundinterpretation gewährleistet. Perspektivisch gewinnt die multimodale Bildgebung zunehmend an Bedeutung. Anstelle einer Entscheidung für ein einzelnes Verfahren rückt die kombinierte Nutzung komplementärer Techniken in den Vordergrund, mit dem Ziel, die diagnostische Genauigkeit und klinische Relevanz zu verbessern.
Fazit
- Die frühzeitige Detektion der KHK ist entscheidend zur Prävention schwerer kardiovaskulärer Ereignisse.
- Moderne Bildgebungsmodalitäten spielen in der Früherkennung eine zunehmend wichtige Rolle und sind gegenüber klassischen Biomarkern überlegen.
- Die multimodale Bildgebung bietet komplementäre Informationen und sollte integrativ eingesetzt werden.
- Die Auswahl des bildgebenden Verfahrens sollte individuell, indikationsbezogen und unter Berücksichtigung verfügbarer Ressourcen erfolgen.
- Low-Dose-CT mit Berechnung des Agatston-Score dient als einfaches, kostengünstiges und strahlungsarmes Verfahren zur Abschätzung des kardiovaskulären Langzeitrisikos; bereits vorhandene Thorax-CT-Aufnahmen können hierfür rückwirkend ebenfalls genutzt werden.
- Die CCTA ist die etablierte Erstliniendiagnostik beim klinischen Verdacht auf KHK und ermöglicht sowohl die Stenosebeurteilung als auch den Nachweis vulnerabler Plaques mit hohem Ischämierisiko.
- Neben der rein anatomischen Diagnostik bietet die funktionelle Bildgebung wichtige Zusatzinformationen und gewinnt immer mehr an Bedeutung.
- Vor allem die Stress-Perfusions-MRT ermöglicht bei ausgewählten Patienten eine differenzierte morphologische und funktionelle kardiale Beurteilung.
Bildnachweis
doraclub – Adobe Stock
Referenten
PD Dr. med. Philipp Nicol Facharzt für Innere Medizin - Schwerpunkt Kardiologie KARDIOLOGIE 360° IN MÜNCHEN Dienerstr. 12 80331 München PD Dr. med. Teresa Trenkwalder Oberärztin Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum Lazarettstr. 36 80636 MünchenInteressenkonflikte
PD Dr. Nicol: Vortragshonorare (AstraZeneca, GE Healthcare, BMS); Advisory Board (AstraZeneca); Reiseunterstützung (AstraZeneca) PD Dr. Trenkwalder: Speaker and travelgrants: Pfizer, Alnylam, Zoll, Novartis, Astra Zeneca, Alexion, Bayer, Bristol Myers Squibb, Zoll, Boehringer Ingelheim, Sanofi, GE HealthcareSponsoring
Diese Fortbildung wurde für den aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 18.900,- durch die Firmen GE HealthCare Pharmaceutical Diagnostics und ulrich GmbH & Co. KG unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt