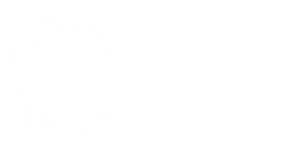Anwendungsorientiertes Hintergrundwissen zum Immunsystem und zu dessen zentraler Bedeutung in der Sepsis
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie ...
- die Komponenten des menschlichen Immunsystems,
- wichtige Mechanismen der Immunregulation,
- die Diagnostik und relevante immunologische Aspekte der Sepsis,
- praxisrelevante Ansätze für Präzisionstherapien der Sepsis.
Regulation der Komponenten der Immunantwort
Die Medizin versucht, physiologische Prozesse im Körper als lineare, interindividuell gleichartige Vorgänge zu begreifen. Dies macht an vielen Stellen allein schon aus evolutionsbiologischer Sicht Sinn. Das Immunsystem ist mit unzähligen Einflussebenen in seiner Funktionalität jedoch nicht linear zu gliedern. Es variiert von Individuum zu Individuum und von einem zum nächsten Zeitpunkt in seinen Abläufen, auch wenn ein gleicher Trigger es aktiviert. Die einzelnen Elemente des Immunsystems befinden sich durch Umweltfaktoren, (epi-)genetische Veranlagung und situative Faktoren (Umwelteinflüsse) in einem ständigen Wandel. Beispielsweise kann bereits ein vergleichsweise geringer körperlicher oder psychischer Stress das Immunsystem wesentlich beeinflussen. Das Immunsystem kann pragmatisch in zwei Teilsysteme unterteilt werden: das schnell wirksame, unspezifische angeborene (innate) Immunsystem und das spezifische, erworbene adaptive Immunsystem. In beiden Anteilen, die überdies eng verzahnt und nur artifiziell getrennt zu betrachten sind, gibt es Mechanismen der Aktivierung und Regulation, die die Immunantwort sowohl verstärken als auch hemmen können, um übermäßige Reaktionen zu verhindern.
Aktivierung des angeborenen Immunsystems
Im Folgenden wird der typische Ablauf einer Immunreaktion, etwa nach Eindringen eines Pathogens bei einer Verletzung, skizziert: Das Pathogen wird zunächst von Makrophagen im Gewebe erkannt, die über Pattern-Recognition-Rezeptoren (PRRs, z. B. Toll-like-Rezeptoren, TLR) verfügen. Diese Rezeptoren erkennen fremde Strukturen und aktivieren den Transkriptionsfaktor NF-κB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), was zur Transkription von Zytokingenen und der Freisetzung von Zytokinen führt. Zytokine dienen als interzelluläre Botenstoffe und aktivieren wiederum verschiedene Prozesse, einschließlich der Produktion von Akute-Phase-Proteinen wie CRP (C-reaktives Protein) oder Ferritin in der Leber (u. a.), die auch als Biomarker für die Diagnostik bei Entzündungen klinisch genutzt werden. CRP markiert Bakterien und aktiviert das Komplementsystem. Das Komplementsystem ist eine Enzymkaskade, die die Phagozytose anregt und das Gerinnungssystem aktiviert, um Thromben zu bilden, Bakterien einzuschließen und deren Ausbreitung einzudämmen. Über mehrere Komplementfaktoren können das Komplementsystem und das Gerinnungssystem sich wechselseitig aktivieren, was zu einer ständigen zirkulären Aktivierung verschiedener Wege des angeborenen Immunsystems führt. Dies kann, neben zellulären Aktivierungsmechanismen (tissue factor, TF), zu einer disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC) beitragen. Neben dem Komplementsystem und dem Gerinnungssystem wird auch HIF-1α (hypoxia-inducible factor-1 alpha) über NF-κB aktiviert Makrophagen enthalten Proteinkomplexe, die als Inflammasom bezeichnet werden, allen voran das NLRP3-Inflammasom. Das Inflammasom ist ein Enzymsystem, das wichtige Abwehrstoffe, insbesondere das Zytokin IL-(Interleukin-)1ß, prozessiert. IL-1ß ist essenziell für die Aktivierung neutrophiler Granulozyten, die bei der Eiterbildung eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus aktivieren Zytokine verschiedene Interferone, die als Verstärker (Amplifikatoren) fungieren. Diese kleinen Katalysatoren intensivieren die Zytokinaktivität, was letztlich zu einem Zytokinsturm führen kann. Zudem unterstützen sie den Brückenschlag zum adaptiven Immunsystem, insbesondere zum zellulären Arm.
Inhibition des angeborenen Immunsystems
Gleichzeitig mit der Aktivierung des angeborenen Immunsystems wird eine regulatorische Hemmung eingeleitet, die essenziell ist, um die Balance der Immunantwort sicherzustellen und Kollateralschäden zu begrenzen. „Pathogenassoziierte molekulare Muster” (englisch: pathogen-associated molecular patterns, PAMPs) und „Schadenassoziierte molekulare Muster” (englisch: damage-associated molecular patterns, DAMPs), also körpereigene Moleküle, die infolge von Zellschäden freigesetzt werden, induzieren epigenetische und metabolische Veränderungen. Dies kann eine immunologische Reprogrammierung und Modifikation myeloider Zellen mit der Konsequenz einer optimierten Immunantwort bei erneutem Kontakt mit dem gleichen Muster bedingen. Die Histonmodifikation beeinflusst die Transkription inflammatorischer Gene, was zu einer verminderten Produktion von proinflammatorischen Zytokinen oder einer vermehrten Expression von anti-inflammatorischen Zytokinen führen kann. Ein weiterer wichtiger Regulationsmechanismus betrifft den Transkriptionsfaktor NF-κB, der proinflammatorisch als Heterodimer aus den Untereinheiten p50 und p65 besteht. Wenn die Untereinheit p50 in hohen Mengen vorhanden ist, kann es zum Zusammenschluss von homodimeren p50/p50-Komplexen kommen, die antiinflammatorische Wirkungen haben und somit die Entzündungsreaktion hemmen. HIF-1α, das für die Aktivierung von Makrophagen entscheidend ist, wird hierbei ebenfalls reguliert. Bei Sauerstoffmangel, wie er bei Sepsis durch den hohen Energieumsatz entsteht, wird der Citratzyklus entkoppelt und hemmendes Succinat akkumuliert. Über die Hemmung der ATP-Synthase wird mehr Adenosinmonophosphat gebildet, was die Stabilität von HIF-1α beeinträchtigt und das System zusätzlich hemmt.
Aktivierung des adaptiven Immunsystems
Das angeborene und das adaptive Immunsystem arbeiten eng zusammen. Bei der Aktivierung des adaptiven Immunsystems treffen die von Makrophagen ausgeschütteten Zytokine (angeborenes Immunsystem) auf naive T-Zellen, die ein wichtiger Bestandteil des adaptiven Immunsystems sind. Diese Lymphozyten werden im Knochenmark gebildet und wandern in den Thymus, wo ihre Oberflächenmarker überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht auf körpereigene Strukturen reagieren. Die Oberflächenmarker bestimmen letztlich, ob die T-Zellen aktiviert werden oder nicht. T-Zellen interagieren über MHC-II-Rezeptoren mit Monozyten (zirkulierende Form der Makrophagen) und differenzieren sich daraufhin weiter. Für die proinflammatorische Wirkung des adaptiven Immunsystems sind drei Hauptgruppen von Bedeutung: TH17-Zellen: Diese aktivieren die Abwehr gegen extrazelluläre Erreger und stimulieren die Epithelzellen. TH2-Zellen: Diese Zellen differenzieren sich unter dem Einfluss von TH17-Zellen und aktivieren B-Zellen, die Antikörper produzieren, um zirkulierende Pathogene zu neutralisieren. TH1-Zellen: TH1-Zellen synthetisieren und sezernieren Interferon-(IFN-)γ, wenn sie an einen antigenpräsentierenden MHC-II-Rezeptor eines Makrophagen binden. Dieses IFN-γ beschleunigt anschließend Prozesse der adaptiven Abwehr. Diese drei Zellgruppen sind zentral für die Funktion des adaptiven Immunsystems und dessen Fähigkeit, auf unterschiedliche Pathogene zu reagieren. Anhand der Oberflächenmarker werden T-Lymphozyten in zwei Hauptgruppen unterteilt: T-Helferzellen (TH; CD4-positive Zellen) und zytotoxische T-Zellen (CD8-positive Zellen). CD4-positive T-Helferzellen fördern die Produktion weiterer Zytokine und unterstützen somit die Immunantwort. CD8-positive zytotoxische T-Zellen interagieren direkt mit den Pathogenen und sind in der Lage, infizierte Zellen abzutöten. Immunglobuline werden von aktivierten B-Zellen produziert. Diese Y-förmigen Proteine besitzen an beiden Armen eine spezifische Bindungsstelle für Antigene, die eine Schlüssel-Schloss-Bindung an ein spezifisches Pathogen ermöglicht. Der untere Teil des Immunglobulins, der Fc-Teil, interagiert mit dem Fc-Rezeptor auf phagozytierenden Immunzellen (Phagozyten) wie Makrophagen. Durch diese Interaktion werden die Phagozyten aktiviert, was zur Phagozytose der Pathogene führt. Die Fc-Domäne ist darüber hinaus in der Lage, das Komplementsystem (C3q) zu aktivieren, wodurch die Pathogene durch enzymatische Reaktionen abgetötet werden. Vereinfacht lassen sich drei Aktivierungspfade und ein hemmender Pathway des adaptiven Immunsystems charakterisieren, wobei das vorherrschende Zytokinmuster entscheidend für die Aktivierungsstärke ist: IL-23/17 -> TH17-Zellen entstehen, die Neutrophile und Epithelzellen aktivieren und extrazelluläre Pathogene eliminieren. IL-12 und IL-18 -> TH1-Zellen führen. Diese Zellen sind neben der Expression von Interferon-γ auch für die Aktivierung von CD8+ T-Zellen zuständig, die primär intrazelluläre Pathogene angreifen. IL-4 -> TH2-Zellen entwickeln. TH2-Zellen regen Plasmazellen zur Produktion von Antikörpern an und regulieren die Immunreaktion durch die Ausschüttung von Zytokinen. Der hemmende Pathway, entsprechend dem ersten Arm in Abbildung 3, leitet über zu den Mechanismen der „Bremse” des adaptiven Immunsystems.
Inhibition des adaptiven Immunsystems
Antiinflammation -> TGF-β zur Differenzierung von regulatorischen T-Zellen führen. Diese produzieren TGF-β + IL-10 und hemmen darüber die die Funktion der TH1- und TH2-Zellen, stellen also sozusagen eine „Bremse“ der adaptiven Immunreaktion da. Auch die Polarisierung von Makrophagen zu M2-Makrophagen wird hier angestoßen. Den im letzten Abschnitt vorgestellten TH1-, TH2- und TH17-Zellen stehen die regulatorischen T-Zellen gegenüber, die als Bremse im adaptiven inflammatorischen System fungieren. Diese Zellen schütten Zytokine wie IL-10 aus, die eine hemmende Wirkung auf TH1- und TH2-Zellen haben. Dadurch wird das gesamte System in eine Balance gebracht und eine übermäßige Immunantwort verhindert. Zellen, die in den programmierten Zelltod (Apoptose) übergehen, induzieren die Sekretion von Zytokinen, die eine Rolle bei der Auslösung von Reparaturprozessen und der Sekretion von „Reparaturzytokinen” spielen. Zudem werden inhibitorische Rezeptoren exprimiert. Bei Stress, Azidose oder Hypoxie erfolgt eine Hochregulation dieser Systeme. Auf B- und T-Zellen existieren Modulatoren wie der BTLA (B- and T-lymphocyte attenuator), zudem gibt es in Geweben Liganden wie den Herpesvirus entry mediator (HVEM), die mit dem BTLA-Rezeptor auf B-Lymphozyten interagieren. Diese Interaktion führt zu einer signifikanten Reduktion der zellulären Energie und verursacht eine Immunparalyse, die mit einer Herunterregulation der Abwehrmechanismen einhergeht.
Bedeutung des Mikrobioms für die Immunregulation
Das Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle in der Immunantwort, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von Immuntoleranz. Die Zusammensetzung des Mikrobioms, einschließlich der Präsenz (potenziell pathogener) Keime, beeinflusst die Genese von Toleranz. T-Lymphozyten werden im Knochenmark produziert und wandern in den Thymus, wo sie ausreifen. Nach ihrer Reifung werden sie in das Gewebe gesendet und gelangen dort über die Lymphe in den Ductus thoracicus. Von dort werden sie in das Blutsystem transportiert. Der Kreislauf führt sie in den Darm. Etwa 80 % der Lymphozytenpopulation befindet sich im Magen-Darm-Trakt, wo sie mit einer Vielzahl von Bakterienspezies konfrontiert wird. Die intestinalen Bakterien sind durch eine dünne Epithelschicht von den Lymphozyten getrennt. In diesem Grenzbereich lernt das Immunsystem, eine Immuntoleranz zu entwickeln. Die dendritischen Zellen, die mit ausgreifenden Fortsätzen ausgestattet sind, interagieren hier mit Bakterien, ohne dass es zur Aktivierung einer Immunantwort kommt. Bei systemischen Infektionen, aber auch bei „steriler Inflammation” wie z. B. der lokalen Ischämie (Schlaganfall oder Herzinfarkt), werden Lymphozyten aus dem Darm in die Peripherie des Kreislaufsystems mobilisiert. Dort werden sie durch Zytokine wie IL-6 und HIF-1α aktiviert. Die aktivierten regulatorischen T-Lymphozyten weisen Oberflächenmarker wie CD25, CD40 und CD80 auf und tragen zur Regulation der Immunantwort bei.
Immunregulation und Metabolismus
Unter Stress jeglicher Ursache (z. B. intensiver Sport oder Herzinfarkt) reagiert das Immunsystem, wobei sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem aktiviert werden. Neben diesen Reaktionen erfolgt eine Umstellung des Immunmetabolismus, was eine Veränderung im Zellstoffwechsel mit sich bringt. Insbesondere aktiviert HIF-1α den mTOR-(mammalian target of rapamycin-)Signalweg, eine Phosphorylierungsmaschinerie, die eine grundlegende Umstellung der zellulären Energieproduktion bewirkt. Ohne den Einfluss von Stress verstoffwechseln (die meisten) Zellen Nährstoffe wie Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, wobei der Citratzyklus als zentraler Stoffwechselweg fungiert. Der Citratzyklus produziert Energie und Protonen, die einen Protonengradienten an der Atmungskette in den Mitochondrien ermöglichen. Diese Protonen wandern durch die vier Komplexe der Atmungskette und führen zur Bildung von ATP (Adenosintriphosphat). Dieser Prozess ist für den Ruhe- oder Erhaltungsmodus der Zellen bestimmt, in dem keine exzessive Zellproliferation oder intensive Bekämpfung von Pathogenen erforderlich ist. Bei einer Immunzellaktivierung, wie sie bei Entzündungsprozessen und der Bekämpfung von Pathogenen auftritt, steigt der Bedarf an Energie unter anderem durch intensive Zellproliferation erheblich. Neben der notwendigen Energie für diese Zellfunktion erfordert auch die Zellmigration und Aktivität schnell viel Energie. Der Körper reagiert darauf, indem er die Mitochondrien in einen Zustand reduziert, der als „Winterschlaf” bezeichnet werden kann, und gleichzeitig die anaerobe Glykolyse um das 40-Fache erhöht. Aufgrund dieser deutlich gesteigerten anaeroben Glykolyse entsteht vermehrt Laktat. Zusätzlich zur gesteigerten Glykolyse wird auch der Pentosephosphatweg aktiviert. Akkumulierende Intermediate des unterbrochenen Citratzyklus (Itaconat und Succinat) beeinflussen rückkoppelnd den HIF-1α-Pathway. Enzyme wie die Glukose-6-Phosphatase und Fruktose-1,6-Bisphosphatase, die als Transkriptionsfaktoren auf inflammatorische Gene wirken, sind zudem regulatorisch von Bedeutung. Diese Enzyme hemmen die Produktion proinflammatorischer Zytokine wie IL-6, TNF-α und IL-8. Die gesteigerte Aktivität dieser Enzyme ermöglicht eine erhöhte Produktion und eine stärkere Wirkung dieser Zytokine, was den Entzündungsprozess propagiert. Zudem wird durch den Pentosephosphatweg NADPH (reduzierte Form des Nicotinamidadenindinukleotidphosphat [NADP]) produziert. Dieses ist für die NADPH-Oxidase notwendig, um reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu bilden, die für die Bekämpfung von Pathogenen und die Lipidsynthese erforderlich sind. Letztere ist wiederum wichtig für die T-Zell-Funktion unter Stressbedingungen. Glutathion spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation dieser Prozesse und der Eindämmung der Entzündung. Zusammenfassend wird der Mitochondrienstoffwechsel auf eine reduzierte Aktivität umgestellt, während die anaerobe Glykolyse und der Pentosephosphatweg massiv gesteigert werden. Dies unterstützt die Energiebereitstellung und die Proliferation von Zellen sowie deren Migration. An dieser Stelle sind mehrere Interventionsmöglichkeiten denkbar. Eine spezifische Ernährungsintervention, wie etwa eine ketogene Ernährungstherapie zur Reduktion der Kohlenhydrataufnahme, kann die Glykolyse herunterregulieren und somit die Entzündungsprozesse beeinflussen. Eine Zufuhr spezifischer Fettsäuren könnte ebenfalls unterstützend wirken. Des Weiteren könnte durch die Modulation des Citratzyklus, etwa durch Zufuhr von α-Ketoglutarat, eine Hemmung der Immunreaktion gefördert werden. Eine Ernährung, die reich an Kohlenhydraten ist, hat stets eine entzündungsfördernde Komponente. Dies muss im Gesamtkontext des Immunsystems berücksichtigt werden. Bestimmte moderne Medikamente zielen auf dieses Prinzip ab. Diese Medikamente wirken durch die Hemmung des Glukosetransporters im Darm, wodurch die Aufnahme von Zucker reduziert wird und folglich eine geringere Entzündungsaktivität erzielt wird. Im Kontext chronischer Entzündungen, wie sie z. B. bei Atherosklerose auftreten, ist die Glykolyse von zentraler Bedeutung, da die Zellen kontinuierlich Zucker benötigen. Eine Reduktion der Zuckerzufuhr kann zu einer Reduktion der Inflammation führen. Aus diesem Grund sind entsprechende Medikamente (z. B. SGLT2-Inhibitoren) äußerst erfolgreich. Ein tiefes Verständnis der Interaktionen zwischen dem angeborenen und adaptiven Immunsystem sowie des damit verbundenen Zellmetabolismus ist entscheidend, um die Wirkungsweise dieser neuen Medikamente zu verstehen.
Sepsis
Sepsis bezeichnet einen lebensbedrohlichen Zustand mit konsekutivem Organversagen, der durch eine dysregulierte, systemische Entzündungsreaktion infolge einer Infektion verursacht wird. Die Sepsis stellt einen medizinischen Notfall dar, der eine unverzügliche und adäquate antiinfektive Therapie unter intensivmedizinischer Überwachung erfordert. Es besteht die Gefahr von Multiorganversagen, septischem Schock und Tod. Für die Mehrzahl aller Patienten mit einer Sepsis gelingt der Nachweis des auslösenden Erregers nicht. Vorherige Sepsisdefinitionen (Sepsis-1) nutzten daher die SIRS-Kriterien als Ausgangspunkt der Diagnose. Das systemische inflammatorische Response-Syndrom (SIRS) besteht demnach, wenn zwei oder mehr der folgenden Kriterien erfüllt sind:
- Körpertemperatur <36 °C oder >38 °C
- Tachykardie (>90 Schläge pro Minute)
- Tachypnoe (>20 Atemzüge pro Minute oder paCO2 <33 mmHg), Horovitz-Quotient <200 (definiert als Quotient aus dem arteriellen Sauerstoffpartialdruck und der Konzentration von Sauerstoff in der eingeatmeten Luft)
- Leukozytenzahl <4.000/nL oder >12.000/nL oder >10 % unreife neutrophile Granulozyten
Pathophysiologie der Sepsis
Eine Sepsis beginnt typischerweise damit, dass PAMPs und DAMPs eine initiale Immunantwort auslösen. Diese Immunantwort hat weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Systeme, einschließlich des Gerinnungssystems, der autonomen Funktion und der Makro- und Mikrozirkulation. Auch das endokrine System kann dysreguliert sein, was sich unter anderem in einem erniedrigten TSH-(Thyroideastimulierendes Hormon-)Wert äußern kann. Letztlich resultiert eine Organdysfunktion, die das klinische Bild der Sepsis charakterisiert. Das Immunsystem hat die Aufgabe, eindringende Pathogene abzufangen. Zu der ersten Verteidigungslinie gehören die Gewebsmakrophagen, die Pathogene phagozytieren. Im Blut sind vor allem neutrophile Granulozyten für die Bekämpfung von Pathogenen zuständig. Bei lokalen Infektionen sind typische Symptome wie Rötung, Erwärmung und Schwellung zu beobachten, die meist nach kurzer Zeit wieder abklingen. Neutrophile Granulozyten und Monozyten werden kontinuierlich durch die Myelopoese nachgebildet, während die Lymphopoese zur Bildung von CD4- und CD8-T-Zellen führt, einschließlich TH17-Zellen, TH2-Zellen und TH1-Zellen. Makrophagen, die sich in verschiedenen Geweben wie Knochenmark, Leber (Kupffer-Sternzellen), Alveolen, Gehirn (Gliazellen), Milz, Darm und Lymphknoten befinden, sind entscheidend für die Erkennung und Bekämpfung von Pathogenen. Diese Zellen nutzen Pathogenrezeptoren, um eine Immunreaktion einzuleiten. Toll-like-Rezeptoren (TLRs), insbesondere TLR4, sind wichtige Mustererkennungsrezeptoren, die auf Lipopolysaccharide (LPS) oder andere „Fremd-“Antigene reagieren. Neben TLR4, der auf Zellmembranen vorkommt, gibt es intrazellulär lokalisierte Rezeptoren wie TLR7/8. Antigene werden von Monozyten phagozytiert und präsentiert. CD8-T-Zellen können infizierte Zellen direkt abtöten, während CD4-T-Zellen Botenstoffe freisetzen, um B-Zellen zur Antikörperbildung zu stimulieren und weitere Immunzellen wie Monozyten, Makrophagen und Neutrophile zu aktivieren. Stickstoffmonoxid (NO) spielt eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie der Sepsis, da es die Gefäße weitet und somit sowohl die Durchblutung wie bei körperlicher Aktivität als auch die Infektabwehr unterstützt. Ein Überschuss an NO führt jedoch durch die Gefäßerweiterung zu einem Blutdruckabfall, was zum Progress einer Sepsis in einen septischen Schock beitragen kann. Eine fehlregulierte Immunantwort kann mit einer beeinträchtigten Mitochondrienfunktion verbunden sein. Mitochondrien gelten als die „Kraftwerke der Zellen” und regenerieren über die Atmungskette das energiereiche Molekül ATP, das als universelle „Energiewährung” von Zellen genutzt wird. Im Rahmen der mit der Sepsis verbundenen Störung des mitochondrialen Energiestoffwechsels wird der Citratzyklus an zwei Stellen unterbrochen, was zu einem Stillstand der Energieproduktion in den Mitochondrien führt. Dabei akkumulieren Succinat und Itaconat als Intermediate des Citratzyklus. Der Stillstand der Energieproduktion in den Mitochondrien ist auch bei Sportlern unter extremer Trainingsbelastung zu beobachten. Das Immunsystem von Spitzensportlern zeigt so ähnliche Reaktionen wie das von Patienten mit einer Sepsis oder einem Myokardinfarkt. Akkumulierendes Succinat spielt eine wesentliche Rolle bei der Stabilisierung von HIF-1α, das die anaerobe Glykolyse induziert. Eine ausreichende Glykolyse ist erforderlich, um die Inflammation aufrechtzuerhalten. Es kann bei Sepsis vorkommen, dass die Umstellung von anaerober Glykolyse zurück zum Citratzyklus nicht unmittelbar gelingt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Stress am Immunsystem unabhängig vom klinischen Szenario – sei es Spitzensport, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Sepsis – eine ähnliche Pathophysiologie auslösen kann. Es kommt zu einer Reduktion des aeroben mitochondrialen Stoffwechsels, der notwendig ist, um NO zu produzieren. Störungen im Immunmetabolismus sind direkt am Krankenbett beobachtbar. Unabhängig von der kardialen Funktion kalte Akren sind mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert. Diese Beobachtung wird durch Daten gestützt, die zeigen, dass bei einer Störung der Mitochondrienfunktion, bei der die Energieproduktion eingestellt wird, die Wärmeproduktion ebenfalls beeinträchtigt ist. Mitochondrien produzieren normalerweise Wärme durch den Protonengradienten, der bei normaler Funktion für die ATP-Synthese genutzt wird. Wenn diese Funktion in der Sepsis heruntergefahren ist, kann keine Wärme mehr produziert werden, was sich in einer Hypothermie äußern kann. Ein weiteres markantes Phänomen ist die Abnahme des Phosphatspiegels im Blut. Dies ist auf die starke Aktivierung der Phosphatasen wie Glukose-6-Phosphatase und Fruktose-1,6-Bisphosphatase zurückzuführen, die den Phosphatgehalt im Blut senken. Eine signifikante Reduktion des Phosphatspiegels, teilweise <0,6 mmol/l, ist ein Indikator für die aktuelle Aktivität des Immunmetabolismus und den Grad der Inflammation.
Immunologische Targets in der Sepsistherapie
Die bisherigen Erfahrungen in der Sepsistherapie zeigen eine Vielzahl von gescheiterten Ansätzen, die man als „Friedhof der Sepsistherapie” bezeichnen könnte. Verschiedene pauschale immunmodulatorische Therapien wurden in zahlreichen klinischen Studien getestet, jedoch mit gemischten Ergebnissen. Hochdosis-Cortison, TNF-Blockade und Modulation von Toll-like-Rezeptoren wurden ausprobiert, ohne durchgängig erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Die mangelnde Wirksamkeit dieser Therapien kann auf die individuelle Variabilität des Immunsystems zurückgeführt werden. Das Immunsystem funktioniert nicht bei allen Menschen auf dieselbe Weise, sodass ein einheitlicher Therapieansatz nicht für alle Patientinnen und Patienten wirksam sein kann. In früheren Studien wurde nicht differenziert, welche individuellen Unterschiede bestehen. Folglich haben manche Patienten von bestimmten Behandlungen profitiert, während andere geschädigt wurden oder keine Wirkung festgestellt werden konnte. Variationen in den Studienpopulationen und den eingesetzten Therapieansätzen trugen zusätzlich zur Inkonsistenz der Ergebnisse bei. Für die Zukunft ist eine präzisere, individualisierte Medizin erforderlich, die auf immunologischen Clustern basiert. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz können diese Cluster besser bestimmt werden. In den nächsten fünf bis sechs Jahren wird es wahrscheinlich möglich sein, solche Cluster systemimmunologisch zu identifizieren und klinisch nutzbar zu machen. Infolgedessen könnten die bisherigen Studien, die nicht erfolgreich waren, mit neuen Erkenntnissen und einem besseren Verständnis wieder relevant werden. Der Cytomegalievirus-(CMV-)Serostatus stellt ein herausragendes Beispiel für die Relevanz personalisierter Aspekte in der Immuntherapie der Sepsis dar. Etwa 60 bis 70 % der deutschen Bevölkerung ist seropositiv für CMV-IgG. Diese Personen haben in der Vergangenheit eine Infektion durchlebt, doch das Immunsystem hält das Virus gegenwärtig unter Kontrolle, das Virus ist nicht replikativ und existiert latent in den Zellen des „Wirtes” weiter. Bei CMV-seropositiven Patienten ist jedoch im Rahmen einer Sepsis eine signifikant erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu CMV-seronegativen Individuen zu beobachten und dies, ohne dass eine Virusreaktivierung stattfand. Auch kann der CMV-Status die Interpretation von Entzündungsmarkern wie Procalcitonin erheblich beeinflussen. Diese Beobachtung verdeutlicht, dass auch eine latente Virusinfektion, beispielsweise mit CMV, erhebliche Auswirkungen auf das Immunsystem haben kann, wodurch sich zwei große Patientengruppen mit unterschiedlichen Immunantworten herausbilden. Eine Theorie besagt, dass sich die T-Zellen über Jahre hinweg an CMV angepasst haben und versuchen, das Virus zu kontrollieren. Diese Anpassung führt zu einer Polarisierung der T-Zellen, was ihre Fähigkeit zur Reaktion auf andere Pathogene, wie Bakterien, einschränkt und zu einer Art Immunparalyse führt. Ähnliche Phänomene können für anderen Viren wie das Epstein-Barr-Virus (EBV) erwartet werden. Ein Beispiel für eine therapeutische Strategie zur Modulation des Immunsystems ist die Blockade von Toll-like-Rezeptor 4 (TLR-4), einem wichtigen Rezeptor für die Aktivierung des angeborenen Immunsystems. Studien zur TLR-4-Blockade haben jedoch uneinheitliche Ergebnisse geliefert, da die Wirksamkeit der Blockade möglicherweise von der individuellen Aktivierung des Rezeptors bei den Patienten abhängt. Proximity-Ligation-Assay-Untersuchungen, die die Phosphorylierung des Rezeptors messen, zeigten, dass bei etwa 30 % der untersuchten Sepsispatienten der TLR-4-Rezeptor aktiviert war. Bei diesen Patienten war die Mortalität signifikant erhöht, was darauf hinweist, dass eine TLR-4-Blockade bei ihnen potenziell vorteilhaft sein könnte. Im Gegensatz dazu könnte die Blockade bei Patienten ohne aktivierten TLR-4-Rezeptor zu einer weiteren Immunparalyse führen und deren Überlebenschancen verschlechtern. Dies könnte die damaligen Studienergebnisse erklären. Für die Zukunft ist es entscheidend, Subgruppen und immunologische Cluster präzise zu identifizieren, um eine individualisierte Präzisionsmedizin zu ermöglichen. Durch sogenannte Enrichment-Strategien könnten in Zukunft theranostische Marker zur Optimierung der Behandlung eingesetzt werden. Beispielsweise kann ein Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (GM-CSF) verabreicht werden, um die Funktion von Immunzellen zu verbessern, insbesondere bei niedrigem HLA-DR-Spiegel. Die Messung von IL-6 kann zur Bestimmung einer Hyperinflammation dienen, und in einigen Fällen wurden auch Effekte von Anti-TNF-Antikörpern beschrieben. Ähnlich wie in der Tumortherapie könnten Checkpoint-Inhibitoren eingesetzt werden, um das Immunsystem zu reaktivieren, indem die Blockade zwischen PD-1 (Programmed cell death protein 1) und PD-1- Ligand aufgehoben wird. Obwohl diese Ansätze vielversprechend sind, befinden sie sich derzeit noch in der experimentellen Phase. Zukünftige Forschungen und neue Studiendesigns werden erforderlich sein, um diese Therapien zu etablieren. Das gleichzeitige Vorhandensein niedriger Konzentrationen der endogenen Immunglobuline IgG1, IgM und IgA im Plasma ist mit einer reduzierten Überlebensrate bei Patienten mit schwerer Sepsis oder septischem Schock verbunden. Die Bestimmung der Konzentrationen dieser Immunglobuline könnte die Wirksamkeit der Behandlung mit exogenen Immunglobulinen bei Sepsispatienten verbessern. Polyklonale intravenöse Immunglobuline (IVIG), die pleiotrope Wirkungen auf Entzündungs- und Immunmechanismen haben, wurden als adjuvante Therapie zur Modulation sowohl pro- als auch antiinflammatorischer Prozesse vorgeschlagen. Polyklonale IgM-angereicherte Immunglobuline (IVIgGM) könnten bei Sepsis als eine adjuvante immunmodulatorische Therapie von Nutzen sein. Eine Metaanalyse, die 19 Studien mit insgesamt 1.530 Patienten umfasste, zeigte, dass der Einsatz von IVIgGM das Mortalitätsrisiko bei septischen Patienten signifikant senkte (relatives Risiko 0,60; 95%-Konfidenzintervall 0,52–0,69). Zudem deutete die Metaanalyse darauf hin, dass die Anwendung von IVIgGM die Dauer der mechanischen Beatmung verkürzen könnte. Die derzeitige Evidenz ist noch nicht ausreichend, um den flächendeckenden Einsatz von IVIgGM in der Sepsistherapie zu empfehlen. Die Ergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass bestimmte Patientengruppen davon profitieren könnten, was die bessere Identifizierung dieser Gruppen für eine zukünftige personalisierte Sepsistherapie erfordert.
Fazit
- Das menschliche Immunsystem besteht aus einem angeborenen (innaten) und einem adaptiven Arm, die beide eng zusammenarbeiten und sowohl aktivierende als auch hemmende Mechanismen zur Regulation der Immunantwort besitzen.
- Sepsis ist ein komplexes, lebensbedrohliches Syndrom, das durch eine fehlregulierte Immunantwort auf eine Infektion gekennzeichnet.
- Der Verlauf und Ausgang einer Sepsis werden stark von individuellen Prädispositionen, äußeren Faktoren und spezifischen Merkmalen wie zum Beispiel dem Cytomegalievirus-(CMV-)Status oder der Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflusst.
- Bei Immunzellaktivierung, wie sie auch bei einer Sepsis auftritt, kommt es zu einer massiven Umstellung des Zellstoffwechsels hin zur anaeroben Glykolyse und Aktivierung des Pentosephosphatweges, während der mitochondriale Stoffwechsel reduziert wird.
- Zukünftige Sepsistherapien erfordern einen präzisionsmedizinischen, individualisierten Ansatz, der auf der Identifizierung spezifischer immunologischer Subgruppen oder Cluster basiert, um gezielte Interventionen zu ermöglichen.
Bildnachweis
Stocktrek Images – Alamy Stock Photo
Referenten
Dr. Matthias Unterberg Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH In der Schornau 23-25 44892 Bochum Prof. Markus A. Weigand Universitätsklinikum Heidelberg Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg Prof. Michael Adamzik Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH In der Schornau 23-25 44892 BochumInteressenkonflikte
Dr. Unterberg: Berater/Vortragshonorare von Biotest, CSL Behring, Astra Zeneca, Shionogi, MSD Sharp & Dohme. Prof. Markus A. Weigand: Vortragshonorare von GE-Healthcare, Gilead, Köhler Chemie, MSD Sharp & Dohme, Pfizer, Pharma, Boehringer Ingelheim; Advisory Boards: BBraun, Gilead, MSD Sharp & Dohme, Shionogi, Biomedica, Biotest und SedanaSponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 18.900,- durch die Biotest AG unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt