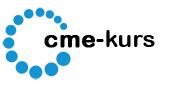Einführung
Eine weltweite Analyse der Erkrankungen und Ereignisse, die die Lebenserwartung der Menschen am deutlichsten beeinflussen, hat ergeben, dass die chronische Nierenerkrankung (CKD) im Jahr 2016 den 16. Platz noch hinter einem Typ-2-Diabetes einnimmt. In der Prognose für das Jahr 2040 stehen die ischämischen Herzerkrankungen und der Schlaganfall zwar immer noch auf den Plätzen eins und zwei, aber die CKD ist auf den fünften Platz direkt hinter der COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) vorgerückt. Trotz dieser dramatischen Entwicklung, die auch durch die starke Zunahme des Diabetes mellitus als der wichtigsten Ursache für die chronische Nierenerkrankung absehbar ist, ist die CKD als eine mögliche Todesursache in den Medien unterrepräsentiert. Terrorismus, Krieg, Pneumonie und Schlaganfall liegen hier auf den vorderen Plätzen. Die CKD wird in der Bevölkerung nicht als Problem wahrgenommen, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass diese Erkrankung über viele Jahre und Jahrzehnte völlig schmerzfrei verläuft. Lange war die Blockade des Renin-Angiotensin-Systems (RAS) die einzige Option, um die chronische Verschlechterung der Nierenfunktion bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu verzögern. Die Situation hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. In dieser Fortbildung wird der aktuelle Stand der Evidenz zur möglichst frühzeitigen Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes und einer Albuminurie dargestellt.
Chronische Nierenerkrankung als Risikofaktor
Die CKD ist als eigenständiger Risikofaktor anerkannt. Je schlechter die Nierenfunktion und je niedriger die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR), desto höher ist die kardiovaskuläre Mortalität. Die Bestimmung der Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR) zusätzlich zur eGFR ermöglicht eine präzisere Einschätzung des Risikos, weil bei einer CKD die Albuminurie bereits nachweisbar ist, wenn die eGFR noch normal ist. Das Ausmaß der Albuminurie zeigt an, wie schnell der renale Funktionsverlust fortschreitet. Der Zusammenhang zwischen beiden Parametern und dem Risiko wird in einer Darstellung als Heatmap besonders deutlich. Eine Einordnung von Patientenzahlen mit bekannter eGFR und UACR in die Risikokategorien der Heatmap ermöglicht die hypothetische Aussage, dass in Deutschland pro Hausarztpraxis etwa 64 Patienten mit einer CKD ein hohes oder sehr hohes Risiko haben könnten. Die Zahl der theoretisch behandlungspflichtigen CKD-Patienten könnte etwa 256 pro Praxis betragen. Es ist entscheidend, die Patienten in einem frühen Krankheitsstadium zu diagnostizieren, um rechtzeitig mit einer wirksamen Therapie beginnen zu können, die die Albuminurie reduziert, die Progression der Nierenerkrankung verlangsamt und damit das renale und kardiovaskuläre Risiko senkt. Ab dem 45. Lebensjahr beträgt der jährliche physiologische Verlust der glomerulären Filtrationsleistung 1 ml/min/1,73 m2. Patienten mit einer CKD verlieren in einem Jahr sechsmal so viel. Dieser Verlust kann mit wirksamen Therapieoptionen deutlich verkleinert werden. Der Gewinn für den Patienten ist umso größer, desto früher die Therapie beginnt.
Behandlungsstrategie und Werkzeuge zur Progressionshemmung
Die 2024 aktualisierte Leitlinie der Kidney Disease: Improving Global Outcome (KDIGO) enthält klare Angaben zum Monitoring und zur Behandlung von Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung. Risikofaktoren sollen regelmäßig alle drei bis sechs Monate beurteilt werden. An erster Stelle der Behandlungsempfehlungen steht ein gesunder Lebensstil mit gesunder Ernährung, körperlicher Aktivität, Raucherentwöhnung und Gewichtsmanagement. Zur medikamentösen Erstlinientherapie gehören die Einstellung eines erhöhten Blutdruckes auf systolisch <120 mmHg mit einem RAS-Inhibitor in der maximal verträglichen Dosis und die Gabe eines Sodium-Glukose-Transporter-(SGLT-)2-Inhibitors. Wenn die RAS-Inhibition zur Erreichung des Blutdruckzieles nicht ausreicht, kann ein Calciumantagonist und/oder ein Diuretikum ergänzt werden. Dass Blutdruckkontrolle und RAS-Inhibition das Risiko um durchschnittlich 20 % reduzieren, ist sehr gut dokumentiert. Die Empfehlung des SGLT-2-Inhibitors basiert ebenfalls auf einer Vielzahl von klinischen Studien, die eine zusätzliche durchschnittliche Risikoreduktion von 37 % belegen. Sie gilt für folgende Erkrankungen
- Diabetes mellitus, CKD, eGFR ≥20 ml/min/1,73 m2 (Empfehlungsgrad 1A)
- CKD und UACR ≥200 mg/g (Empfehlungsgrad 1A)
- CKD und Herzinsuffizienz bei jeglicher Albuminurie (Empfehlungsgrad 1A)
- CKD, eGFR 20 bis 45 ml/min/1,73 m2, UACR <200 mg/g (Empfehlungsgrad 2B)
Patienten mit einer Hypercholesterinämie und einer atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankung (ASCVD) sollen zusätzlich moderat bis hochdosiert mit einem Statin behandelt werden.
Restrisiko nach Hemmung von RAS und SGLT-2
Blutdruckkontrolle, RAS-Inhibition und SGLT-2-Inhibition haben bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD in klinischen Studien den kombinierten primären Endpunkt aus anhaltender Abnahme der eGFR, „end-stage renal diease” (ESRD) sowie aus renal oder kardiovaskulär bedingtem Tod zwar deutlich reduzieren können, dennoch bleibt ein beträchtliches Restrisiko bestehen. Ein Blick auf Einzeldaten von Patienten zeigt, dass es bei der Therapie mit einem SGLT-2-Inhibitor erhebliche Unterschiede bei den individuellen Ansprechraten gibt. Entscheidend ist, ob der Patient unter der Kombinationstherapie noch weiterhin eine Albuminurie hat. Analysen der DAPA-CKD-Studie haben gezeigt, dass, wenn es nicht gelingt, die Albuminurie auf ein Minimum zu reduzieren und bestenfalls komplett zu unterbinden, die Patienten trotz SGLT-2-Inhibition ein Residualrisiko mit einer nach wie vor erhöhten Mortalität haben. Die KDIGO-Leitlinie empfiehlt daher bei Patienten mit Diabetes und vorhandener Indikation auch die Gabe eines nicht steroidalen Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten (nsMRA).
Spironolacton oder Finerenon zur Nephroprotektion?
Das Wirkprinzip der Antagonisierung des Mineralokortikoid-Rezeptors ist in den Leitlinien zur Behandlung einer therapieresistenten Hypertonie oder einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) etabliert. Allerdings kommen hier steroidale MRA wie Spironolacton oder Eplerenon zur Anwendung. Eine aktuelle Studie an insgesamt 1372 älteren CKD-Patienten mit einem mittleren Alter von 75 Jahren und einer geringen Albuminurie hat gezeigt, dass niedrig dosiertes Spironolacton das kardiovaskuläre Outcome im Vergleich zu Placebo nicht senken kann. Finerenon ist ein neuartiger nicht steroidaler MRA, dessen Wirkspektrum und Nebenwirkungsprofil sich von dem der steroidalen MRA unterscheiden. Hämodynamische und metabolische Faktoren sind nicht die einzigen Progressionstreiber einer chronischen Nierenerkrankung. Inflammation und Fibrosierung schädigen Herz und Nieren zusätzlich und können durch Drucksenkung und verbesserte Blutzuckereinstellung nur indirekt beeinflusst werden. Hyperglykämie, hohe Salzlast und oxidativer Stress führen zu einer Überaktivierung des Mineralokortikoid-Rezeptors, der wiederum inflammatorische und fibrotische Prozesse triggert und über hämodynamische Mechanismen eine Verschlechterung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen vorantreibt. Finerenon ist ein hoch selektiver nicht steroidaler Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist (MR-Antagonist), der die überaktivierten Rezeptoren gezielt blockiert und dadurch seine protektive kardiale und renale Wirkung entfaltet. Wegen des eigenständigen Wirkungsmechanismus wirkt Finerenon zusätzlich zur RAS-Blockade und SGLT-2-Inhibition. Im Vergleich zu den bekannten steroidalen MR-Antagonisten Spironolacton und Eplerenon hat Finerenon ein günstigeres Nebenwirkungsprofil. Präklinische Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass Finerenon im Gegensatz zu Spironolacton und Eplerenon die Blut-Hirn-Schranke nicht durchdringen kann. Damit ist eine Voraussetzung für ein günstigeres Profil bei zentralnervösen Nebenwirkungen gegeben.
FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD und FIDELITY: Finerenon reduziert die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität
Mit dem Finerenon-Studienprogramm sollte dokumentiert werden, dass der neuartige nicht steroidale Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist in der Lage ist, dass renale und kardiovaskuläre Risiko von Patienten mit einem Typ-2-Diabetes und einer Albuminurie zusätzlich zu der bereits etablierten Therapie weiter zu verringern. Finerenon konnte sowohl den kombinierten renalen Endpunkt als auch den kombinierten kardiovaskulären Endpunkt reduzieren. Der Nachweis der Risikoreduktion wurde mit der präspezifizierten gepoolten FIDELITY-Analyse aus den beiden randomisierten klinischen Studien FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD mit einer Gesamtzahl von 13.026 Patienten erbracht, in denen Finerenon in Dosierungen von 10 oder 20 mg im Vergleich zu Placebo zusätzlich zu einer optimierten RAS-Blockade mit maximal tolerierten Dosierungen verabreicht wurde. 6,7 % der Patienten erhielten zum Zeitpunkt der Randomisierung zusätzlich einen SGLT-2-Inhibitor, bei weiteren 8,5 % der Patienten wurde während der Studie die Behandlung mit einem SGLT-2-Inhibitor initiiert. 72,2 % der Patienten waren zu Beginn der Studie mit einem Statin behandelt. Finerenon reduzierte bereits nach vier Monaten die UACR um 32 % im Vergleich zu Placebo. Dieser Effekt hielt über den gesamten Beobachtungszeitraum von bis zu vier Jahren an. Der kombinierte renale Endpunkt setzte sich zusammen aus der Zeit bis zum Nierenversagen, bis zur anhaltenden Abnahme der eGFR um ≥57 % – das entspricht etwa der Verdopplung des Serumkreatinins – gegenüber Baseline oder bis zum renal bedingten Tod. Finerenon reduzierte das relative Risiko für die Progression der Nierenerkrankung im Vergleich zu Placebo um 23 % (HR: 0.77; 95%-KI: 0.67–0.88; p = 0.0002). Der kombinierte kardiovaskuläre Endpunkt setzte sich zusammen aus der Zeit bis zum kardiovaskulären Tod, dem nicht tödlichen Myokardinfarkt, dem nicht tödlichen Schlaganfall oder der durch Herzinsuffizienz bedingten Hospitalisierung. Finerenon reduzierte das relative Risiko für die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität im Vergleich zu Placebo um 14 % (HR: 0.86; 95%-KI: 0.78–0.95; p = 0.0018). Das Risiko für eine durch Herzinsuffizienz bedingte Hospitalisierung wurde durch Finerenon im Vergleich zu Placebo um 22 % gesenkt (HR: 0.78; 95%-KI: 0.66–0.92; p = 0.0030).
Leitlinienempfehlungen zu Finerenon in den aktuellen KDIGO-Leitlinien
Die genannten Studienergebnisse haben dazu geführt, dass ein nsMRA in den aktuellen Leitlinien der KDIGO mit einem 2A-Level bei erwachsenen Patienten mit Typ-2-Diabetes empfohlen wird, wenn die eGFR >25 ml/min/1,73 m2 beträgt, der Serumkaliumspiegel im Normbereich ist und trotz einer RAS-Inhibition in maximal tolerabler Dosis die Urin-Albumin-Ausscheidung >30 mg/g (>3 mg/mmol) beträgt.
SGLT-2-Hemmung und Finerenon
Subgruppenanalysen im Rahmen von FIDELITY haben bereits gezeigt, dass eine SGLT-2-Inhibition die Wirksamkeit und Sicherheit von Finerenon nicht negativ beeinflusst. Es ergaben sich sogar Hinweise auf günstige additive Effekte. Um hierzu weitere prospektive Daten zu generieren, wurde die CONFIDENCE-Studie aufgesetzt, die die Kombination von Empagliflozin und Finerenon im Vergleich zu einer Monotherapie mit beiden Substanzen im Hinblick auf die Progressionshemmung einer chronischen Nierenerkrankung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes untersucht. Eine Analyse von Real-Life-Daten zum kombinierten Einsatz von SGLT-2- Inhibition und Finerenon unterstützt die Kombination beider Wirkstoffe. Die Dreifachkombination aus RAS-Inhibition, SGLT-2-Inhibition und Finerenon könnte dazu beitragen, den Filtrationsverlust bei Patienten mit Typ-2- Diabetes und einer CKD noch weiter zu verzögern und das Risiko von potenziell tödlichen kardiovaskulären Ereignissen noch weiter zu reduzieren.
GLP-1-Rezeptoragonisten als vierte Säule der Protektion
In den KDIGO-Leitlinien ist der GLP-1-Rezeptoragonist bereits im Rahmen des Hyperglykämie-Managements als wirksame Option aufgeführt. Das umfangreiche pharmakologische Wirkungsspektrum der GLP-1-Rezeptoragonisten lässt weitere additive Effekte zusätzlich zur genannten Dreifachtherapie erwarten. Diese Fragestellung wurde im Rahmen der FLOW-CKD-Studie mit Semaglutid untersucht. Insgesamt 3533 Patienten wurden 1 : 1 in einen Behandlungsarm mit 1 mg Semaglutid subkutan einmal wöchentlich und einen Placeboarm randomisiert. Nach einer mittleren Follow-up-Zeit von 3,4 Jahren wurde durch Semaglutid das Risiko für das Erreichen eines primären Outcome-Ereignisses im Vergleich zu Placebo um 24 % gesenkt (331 vs. 410 first events; HR: 0.76; 95%-KI: 0.66–0.88; p = 0.0003). Der eGFR-Verlust konnte im Vergleich zu Placebo durch Semaglutid konstant über den gesamten Beobachtungszeitraum reduziert werden. Die Gesamtsterblichkeit nahm um 20 % ab (HR: 0.80; 95%-KI: 0.67–0.95; p = 0.01). Für den GLP-1-Inhibitor Semaglutid konnte damit gezeigt werden, dass es mit der voraussichtlich 2025 zu erwartenden Zulassung in den nächsten Jahren mit den GLP-1-Rezeptoragonisten eine vierte Säule für die Nephroprotektion für Patienten mit Typ-2-Diabetes und mit Albuminurie geben wird.
Zukünftige Entwicklung der Behandlungsstrategie
Zusätzlich zu den bereits genannten vier Säulen der Nephroprotektion werden weitere Substanzen im Hinblick auf ihre progressionshemmenden Effekte bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD untersucht. Hierzu gehören Endothelin-Rezeptorantagonisten, Aldosteronsynthase-Inhibitoren, die Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase (sGC) und eine antiinflammatorische Therapie. Es bleibt abzuwarten, inwieweit zusätzliche additive oder synergistische Effekte möglich sind, ohne dass diese durch neue Sicherheitsrisiken belastet werden. Bei der Behandlung der Herzinsuffizienz mit einer reduzierten Ejektionsfraktion (HFrEF) ist mittlerweile eine Vierfachtherapie fest etabliert. Die anfangs schrittweise und langsame Kombination mit vorsichtiger Auftitration der einzelnen Wirkstoffe wird mittlerweile nicht mehr empfohlen. Damit die Patienten möglichst rasch von der Wirkung der Vierfachtherapie profitieren, wurden eine schnelle Kombination und Auftitration eingeführt. Können diese Erfahrungen bei der Herzinsuffizienz auch bei der Behandlung der chronischen Nierenerkrankung umgesetzt werden? Erste Überlegungen von einem schrittweisen traditionellen oder konservativen Vorgehen hin zu einer schnellen Vierfachkombination innerhalb von drei Monaten gefolgt von einer zwei- bis dreimonatigen Titrationsphase werden bereits diskutiert. Genau wie bei der Herzinsuffizienz wird es aber auch bei der CKD entscheidend sein, Kombinationsgeschwindigkeit und Dosierung an die individuelle Situation und das Alter der Patienten anzupassen.
Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes mit und ohne kardiovaskuläre Erkrankung
In der neuen Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) wurden die Empfehlungen zur Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes zusammengefasst. Die SCORE2-Risikostratifizierung war dabei von zentraler Bedeutung. Patienten mit Typ-2-Diabetes ab einem Alter von 40 Jahren und einer atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankung (ASCVD) oder einem schweren Endorganschaden (TOD) werden abhängig von ihrem Risiko, innerhalb der folgenden zehn Jahre einen nicht tödlichen Myokardinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden oder aufgrund einer kardiovaskulären Ursache zu versterben, in vier Risikokategorien klassifiziert:
- Niedriges Risiko <5 %
- Moderates Risiko 5 bis <10 %
- Hohes Risiko 10 bis <20 %
- Sehr hohes Risiko ≥20 %
Das kardiovaskuläre Risiko für einen Patienten mit einer atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankung (ASCVD) mit Typ-2-Diabetes ist ungefähr doppelt so hoch wie bei ASCVD-Patienten ohne Diabetes. Dieses Patientenkollektiv ist hoch vulnerabel und benötigt eine Therapie mit Medikamenten, deren kardiovaskulärer Nutzen und deren Sicherheit dokumentiert sind. Auf der Grundlage dieser Risikostrategie empfiehlt die ESC-Leitlinie verschiedene Wirkstoffe zur Blutzuckerkontrolle mit unterschiedlichem Evidenzgrad. Durch den erwiesenen kardiovaskulären Nutzen von SGLT-2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mit hohem oder sehr hohem Risiko sollen diese Medikamente unabhängig vom HbA1c-Wert (glykiertes Hämoglobin) und unabhängig von einer weiteren blutzuckersenkenden Therapie mit Priorität eingesetzt werden. Das 10-Jahres-Risiko von Patienten mit Typ-2-Diabetes, die noch keine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung haben, soll mit dem SCORE2-Diabetes eingeschätzt werden. Dazu wurde von der ESC eine validierte App veröffentlicht, die anhand von mehreren Parametern wie Herkunftsland, Alter, Geschlecht, Raucherstatus, Blutdruck und Cholesterinwerten eine Risikoprognose erlaubt. Für Patienten mit Typ-2-Diabetes ohne manifeste KHK gelten bei einem sehr hohen 10-Jahres-Risiko (≥20 %) die gleichen Therapieempfehlungen wie für Patienten mit KHK. Bei einem niedrigen oder moderaten Risiko, also Score-Werten unter 10 %, gibt es weniger gute Evidenz, deshalb bleibt hier Metformin der empfohlene Goldstandard.
Albuminurie als kardiovaskulärer Risikomarker
Der Stellenwert der Albuminurie oder UACR als Marker für die Geschwindigkeit des glomerulären Filtrationsverlustes bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und einer chronischen Nierenerkrankung wurde bereits erwähnt. Bei einer eGFR <75 ml/min/1,73 m2 und einer UACR von >5 mg/g steigt aber auch das kardiovaskuläre Risiko sehr deutlich an. Die Albuminurie ist nicht nur ein wichtiger Risikomarker für die Progression der CKD, sondern auch für den plötzlichen Herztod. Je höher die UACR, desto höher ist das Risiko. Erreichen die Patienten das Hämodialysestadium, liegt die Inzidenz für einen plötzlichen Herztod im ersten Jahr bei 7 %. Auswertungen des Framingham-Kollektivs über einen Zeitraum von zwölf Jahren haben gezeigt, dass die Inzidenz einer Herzinsuffizienz mit eingeschränkter oder erhaltener Ejektionsfraktion um das Zwei- bis Zweieinhalbfache ansteigt, wenn eine Albuminurie vorliegt. Aufgrund dieser Assoziationen wurde auch für das kardiovaskuläre Risiko in Abhängigkeit von eGFR und UACR eine Heatmap entwickelt, die den Stellenwert der Albuminurie als frühen Marker für das kardiovaskuläre Risiko verdeutlicht. Alle wichtigen Leitlinien empfehlen deshalb ein regelmäßiges Albuminurie-Screening, gemessen als UACR, bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD.
FIDELITY-Analyse: Finerenon reduziert den kardiovaskulären Endpunkt
Finerenon unterscheidet sich von den verfügbaren steroidalen Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten (MRA). Die Selektivität für den Mineralokortikoid-Rezeptor ist hoch, die Wirkung auf den Blutdruck moderat, es findet keine Anreicherung im Nierengewebe statt, und das Molekül penetriert nicht die Blut-Hirn-Schranke. Diese Punkte sind pharmakologische Voraussetzungen für ein günstiges Sicherheitsprofil. Betrachtet man die Ergebnisse der FIDELITY-Analyse aus der Blickrichtung des Kardiologen, fällt die signifikante Reduktion des kombinierten kardiovaskulären Endpunktes (kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, durch Herzinsuffizienz bedingte Hospitalisierung) auf (HR: 0.86; 95%-KI: 0.78–0.95; p = 0.0018). 7,7 % der Patienten hatten eine Herzinsuffizienz mit mild-reduzierter (HFmrEF) oder erhaltener (HFpEF) Pumpfunktion. Herzinsuffizienzpatienten mit reduzierter Pumpfunktion (HFrEF) waren ausgeschlossen, weil diese bereits eine Klasse-1A-Empfehlung für einen steroidalen MRA haben. Wenn nur die durch Herzinsuffizienz bedingten Hospitalisierungen analysiert werden, findet sich ebenfalls ein signifikanter Effekt zugunsten von Finerenon (HR: 0.78; 95%-KI: 0.66–0.92). Der kardiovaskuläre Tod als harter Endpunkt konnte zwar numerisch, aber nicht signifikant reduziert werden. Auch bei der Anwendungssicherheit konnten günstige Effekte dokumentiert werden. In der FIDELIO-DKD-Studie war der Blutdruck bei den meisten Patienten mit einer RAS-Blockade bereits gut kontrolliert, bevor Finerenon eindosiert wurde. Der mittlere systolische Blutdruck sank unter Finerenon im Vergleich zu Placebo um moderate 3,7 mmHg im Monat 4 und um 3,0 mmHg im Monat 12. Bei den Patienten, die zum Studienbeginn einen eher unkontrollierten Blutdruck hatten, war der drucksenkende Effekt von Finerenon deutlicher ausgeprägt. Bei einem systolischen Ausgangsdruck zwischen 140 und 150 mmHg betrug die mittlere Drucksenkung nach einem Monat 4,8 mmHg, lag der Ausgangsdruck zwischen 150 und 160 mmHg, lag die mittlere Drucksenkung bei 10,79 mmHg. Auch die rund 900 Studienteilnehmer, die zu Studienbeginn zusätzlich zur RAS-Hemmung einen SGLT-2-Hemmer einnahmen, profitierten hinsichtlich der kardiorenalen Protektion unter Finerenon mit ersten Hinweisen auf einen synergistischen Effekt. Ein weiterer bekannter Effekt der Blockade des Mineralokortikoid-Rezeptors mit steroidalen MRA ist ein Anstieg der Serumkaliumkonzentration. Der Serumkaliumspiegel durfte deshalb in den klinischen Studien vor Beginn der Therapie mit Finerenon höchstens 4,8 mmol/l betragen und wurde regelmäßig überwacht. Der mittlere Anstieg des Serumkaliums unter einer Behandlung mit Finerenon betrug in Studien allerdings nur etwa 0,2 mmol/l und war durch eine vorrübergehende Unterbrechung der Behandlung gut beherrschbar. Bei einer kombinierten Behandlung mit einem SGLT-2-Inhibitor war die Rate an Hyperkaliämien unter Finerenon deutlich geringer. Aufgrund dieser Daten empfiehlt die aktuelle ESC-Leitlinie den Einsatz von Finerenon für alle Patienten mit Typ-2-Diabetes, mit einer CKD mit Albuminurie (eGFR >60 ml/min/1,73 m2 mit einer UACR ≥30 mg/mmol (≥300 mg/g)) oder eGFR zwischen 25 und 60 ml/min/1,73 m2 mit einer UACR ≥3 mg/mmol (≥30 mg/g) und kardiovaskulären Erkrankungen.
FINEARTS-HF: Finerenon zur Therapie der Herzinsuffizienz ohne Diabetes
Als erste prognostisch relevante Therapie bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) ohne Diabetes mellitus konnten sich die SGLT-2-Inhibitoren etablieren. Die Behandlung sollte sehr früh eingeleitet werden. Finerenon wurde bei dieser Patientenklientel (HFmrEF und HFpEF) mit einer Ejektionsfraktion ≥40 % im Rahmen der FINEARTS-HF-Studie geprüft. Weitere Einschlusskriterien waren New York Heart Association (NYHA) Klasse II bis IV, linksatriale Dilatation und/oder linksventrikuläre Hypertrophie, Diuretika in den 30 Tagen vor der Randomisierung sowie N-terminales-pro Brain natriuretisches Peptid (NT-proBNP) ≥300 pg/ml bei Sinusrhythmus und ≥900 pg/ml bei Vorhofflimmern. Die Finerenon-Dosis war abhängig von der eGFR, bei Werten >60 ml/min/1,73 m2 lag die Zieldosis bei 40 mg. Bei Patienten mit einer eGFR von ≤60 ml/min/1,73 m2 betrug die Zieldosis 20 mg. Hauptausschlusskriterien waren eine eGFR von <25 ml/min/1,73 m2, ein Serumkaliumspiegel >5,0 mmol/l und ein systolischer Blutdruck ≥160 mmHg. Als kombinierter primärer Endpunkt wurde die Anzahl der kardiovaskulären Todesfälle und die Gesamtzahl der Herzinsuffizienzereignisse (erstmalig und wiederkehrend) festgelegt. Finerenon reduzierte den primären Endpunkt signifikant (RR: 0.84; 95%-KI: 0.74–0.95; p = 0.007). Als sekundäre Endpunkte wurden die Gesamtzahl der Herzinsuffizienzereignisse reduziert und die Lebensqualität verbessert. Die kardiovaskuläre Mortalität konnte durch Finerenon wie bei vergleichbaren Studien mit SGLT-2-Inhibitoren bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit LVEF ≥40 % nur numerisch reduziert werden. Während bei einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) der kardiovaskuläre Tod und auch der plötzliche Herztod sehr häufig auftreten, werden diese Ereignisse bei Patienten mit einer HFpEF deutlich seltener beobachtet. Nicht kardiovaskuläre Todesursachen sind bei Patienten mit einer HFpEF häufiger. Wie bereits bei der FIDELITY-Analyse zum renalen Endpunkt wurde auch bei FINEARTS-HF die Subgruppe der Patienten analysiert, die gleichzeitig zu Finerenon einen SGLT-2-Inhibitor erhielten. Der SGLT-2-Inhibitor beeinflusste nicht die Wirksamkeit von Finerenon. Auch im Hinblick auf einen gleichzeitig vorhandenen Typ-2-Diabetes oder den HbA1c-Wert zu Studienbeginn konnte keine signifikante Interaktion mit dem Effekt von Finerenon auf den primären Endpunkt festgestellt werden. Im Gegenteil, die Rate an neu auftretendem Typ-2-Diabetes konnte unter der Therapie mit Finerenon sogar signifikant reduziert werden. Die FINEHEARTS-Analyse, eine integrierte gepoolte Analyse aller 18.991 randomisierten Patienten aus den bisherigen klinischen Studien FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD und FINEARTS-HF, hat gezeigt, dass alle relevanten Endpunkte wie kardiovaskulärer Tod, neu aufgetretenes Vorhofflimmern, Gesamthospitalisierung und Gesamtmortalität signifikant zugunsten von Finerenon reduziert wurden. Finerenon ist noch nicht zur Behandlung einer Herzinsuffizienz mit einer LVEF von ≥40 % zugelassen. Die aktuelle Zulassung besteht für die Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (Stadium 3 und 4 mit Albuminurie) bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes.
FINEARTS-HF: Wirkung von Finerenon auf den Blutdruck und Serumkaliumspiegel
Bei 538 von insgesamt 2911 Patienten unter einer Behandlung mit Finerenon (18,5 %) wurde ein Abfall des systolischen Blutdruckes <100 mmHg berichtet. In der Placebogruppe war das bei 361 von insgesamt 2904 Patienten der Fall (12,4 %). Diese Beobachtung ist auch vor dem Hintergrund der höheren Dosierung von Finerenon im Vergleich zur FIDELIO-DKD- und FIGARO-DKD-Studie zu bewerten. Im Vergleich zu Placebo wurde unter Finerenon eine Verdoppelung der Hyperkaliämierate und eine Halbierung der Hypokaliämierate beobachtet. Dieser Aspekt verdient Beachtung, da Patienten mit Hypokaliämien ein mindestens ebenso hohes Mortalitätsrisiko haben wie Patienten mit Hyperkaliämie. Bei einer gleichzeitigen Gabe von Finerenon und einem SGLT-2-Inhibitor wurden in der FIDELIO-DKD-Studie im Vergleich zu einer Monotherapie mit Finerenon signifikant weniger Hyperkaliämien beobachtet.
Chronische Nierenerkrankung bei Typ-2-Diabetes – die unbekannte Krankheit
Die REVEAL-CKD-Studie untersucht Prävalenz und Folgen einer nicht diagnostizierten chronischen Nierenerkrankung. Dazu wurden 26.767 Patienten mit einer CKD im Stadium 3 untersucht. Bei 4460 von 6070, also bei drei von vier Patienten, war die Nierenerkrankung nicht diagnostiziert. Weltweit wissen neun von zehn Menschen nichts von ihrer Erkrankung. In Deutschland sieht die Situation nicht wesentlich besser aus, was vor allem an der unzureichend durchgeführten renalen Diagnostik liegt. Die InspeCKD-Studie untersuchte den Einsatz CKD-bezogener Labordiagnostik im hausärztlichen Bereich in einer Population von 448.837 Patienten. Bei 33.698 Patienten waren die Diagnosen Diabetes mellitus, Hypertonie und eine kardiovaskuläre Erkrankung dokumentiert. Bei nahezu der Hälfte dieser Hochrisikopatienten wurde im Beobachtungszeitraum von 1,7 Jahren kein Kreatininwert und bei 99 % keine UACR dokumentiert. Der wichtige Frühwarnparameter Albuminurie wird demnach in den meisten deutschen Hausarztpraxen nicht bestimmt. Eine relevante Ursache für dieses Defizit ist die nicht optimal geregelte Abrechnungsfähigkeit im hausärztlichen Bereich. Diese Situation erfordert gemeinsame Initiativen von Nephrologen und Hausärzten sowie mehr öffentliche Aufklärung, damit Patienten mit einer CKD frühzeitig erkannt und behandelt werden können und damit mehr Nierengewebe gerettet werden kann, bevor es zu spät ist.
CKD-Management in der Praxis – Schritt 2: Gezielt nach Nierenschäden suchen
Die verschiedenen Fachgesellschaften empfehlen ein gezieltes Screening, um bei Patienten mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko eine CKD frühzeitig zu erfassen. Im Fokus sind Patienten mit Diabetes mellitus, Hypertonie, Adipositas, einer kardiovaskulären Erkrankung, ältere Patienten und Patienten mit Nierenerkrankungen in der Familien- und Eigenanamnese. Neuere Daten zeigen, dass ein hohes viszerales Fettvolumen mit Diabetes und Albuminurie assoziiert ist. Ein vermehrtes Nierensinusfettvolumen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer diabetischen Nephropathie. Bei einem deutlich erhöhten Risiko soll das Screening regelmäßig erfolgen. Bei einem Typ-1-Diabetes jährlich, beginnend fünf Jahre nach der Diagnose, und bei Patienten mit Typ-2-Diabetes jährlich, beginnend mit der Diagnose. Beim Screening sind eGFR und UACR zu bestimmen. Werden nur Kreatinin oder eGFR untersucht, können viele Frühfälle einer CKD übersehen werden.
CKD-Management in der Praxis – Schritt 3: Leitliniengerecht diagnostizieren
Die Diagnose einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) kann dann gestellt werden, wenn eine Einschränkung der Nierenfunktion mit einer eGFR <60 ml/min/1,73 m2 und/oder eine Albuminurie mit einer UACR ≥30 mg/g oder ein pathologischer Urinstatus (z. B. Hämaturie oder Leukozyturie) vorliegen. Der Patient sollte dann zur einmaligen Abklärung an einen Nephrologen überwiesen werden, wenn die Untersuchung noch einmal wiederholt worden ist. Die Überweisung zum Facharzt ist spätestens dann indiziert, wenn die eGFR <45 ml/min/1,73 m2 und die UACR >30 bis 299 mg/g beträgt oder wenn die eGFR <30 ml/min/1,73 m2 oder eine Makroalbuminurie mit einer UACR >300 mg/g dokumentiert wurde. Im Konsensusbericht der Amerikanischen Diabetesgesellschaft (ADA) und der Kidney Disease: Improving Global Outcome (KDIGO) wurden die ursprünglich von der KDIGO aufgearbeiteten Erkenntnisse zur Entwicklung der chronischen Nierenerkrankung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes in einer Heatmap zusammengefasst. Sie erlaubt mit den Parametern eGFR und UACR eine eindeutige Einstufung der Patienten im Hinblick auf das Risiko für die Entwicklung einer terminalen Nierenerkrankung (ESDR) und enthält zusätzlich noch Hinweise zur Therapieeinleitung, zur fachärztlichen Konsultation und zur Frequenz von Kontrolluntersuchungen.
CKD-Management in der Praxis – Schritt 4: Evidenzbasiert behandeln
Ob die Behandlung der diagnostizierten CKD-Patienten vom Hausarzt oder Facharzt durchgeführt werden soll, hängt von der individuellen Risikoeinschätzung in der Heatmap ab. Die Behandlung sollte dann leitliniengerecht erfolgen mit einer optimalen Blutzucker- und Blutdruckeinstellung beginnend mit einer RAS-Blockade. Bei der Behandlung mit dem nicht steroidalen Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten Finerenon sollte das Serumkalium überwacht werden. Das Monitoring der Serumkaliumwerte ist in der Hausarztpraxis oft eine Herausforderung. Die zuverlässige Bestimmung gelingt oft nicht, weil die Blutproben nach der Entnahme bis zur Analyse im Labor oft zu lange unterwegs sind und dann falsch erhöhte Kaliumwerte übermittelt werden. Der mittlere Anstieg des Serumkaliums unter einer Behandlung mit 10 bis 20 mg Finerenon betrug in den Studien FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD nur etwa 0,2 mmol/l und war durch eine vorrübergehende Unterbrechung der Behandlung gut beherrschbar. Bei einer kombinierten Behandlung mit einem SGLT-2-Inhibitor war die Rate an Hyperkaliämien unter Finerenon deutlich geringer, was die Anwendung in der Hausarztpraxis ebenfalls erleichtern könnte. Die Einstellung des LDL-Cholesterins (Low density Lipoprotein) sollte nicht vergessen werden. Der Zielwert bei einer CKD liegt bei <70 mg/dl. Bei einer eGFR <30 ml/min/1,73 m2 liegt das LDL-Ziel wie bei einem Myokardinfarkt bei <55 mg/dl.
Fazit
- Eine Albuminurie (UACR) ist für Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD ein Marker für die Geschwindigkeit des renalen Filtrationsverlustes sowie für die kardiovaskuläre Mortalität. In der Hausarztpraxis sollte bei Risikopatienten frühzeitig und regelmäßig ein CKD-Screening durchgeführt werden. In der Praxis wird eine Albuminurie immer noch zu wenig gemessen.
- Die Diagnostik der CKD in der Praxis ist einfach, wobei stets die eGFR und die UACR bestimmt werden sollten, um das kardiovaskuläre und renale Risiko richtig einschätzen zu können. Die Bestimmung der eGFR reicht alleine nicht aus.
- Die KDIGO-Heatmap ermöglicht eine klare Risikoeinstufung der CKD-Patienten und enthält Empfehlungen für die Überweisung zum Nephrologen und zur Einleitung einer evidenzbasierten Therapie, die das renale und kardiovaskuläre Risiko senkt.
- Trotz RAS-Inhibition und SGLT-2-Hemmung als Standard zur Organprotektion bleibt ein relevantes renales und ein kardiovaskuläres Restrisiko, das durch den nsMRA Finerenon noch weiter gesenkt werden kann.
- Für Semaglutid konnte gezeigt werden, dass durch einen GLP-1-RA auch eine Risikoreduktion möglich ist.
- Die neue ESC-Leitlinie zur Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes und CVD empfiehlt orientiert an der SCORE2-Risikostratifizierung zur Blutzuckerkontrolle bei ASCVD SGLT-2-Inhibitoren und/oder GLP-1-RA.
- Finerenon wird von der ESC in einer Dosis von 10 bis 20 mg zusätzlich zur RAS-Hemmung empfohlen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und einer eGFR >60 ml/min/1,73 m2 mit einer UACR ≥30 mg/mmol (≥300 mg/g) oder einer eGFR zwischen 25 und 60 ml/min/1,73 m2 und einer UACR ≥3 mg/mmol (≥30 mg/g), um das kardiorenale Risiko zu reduzieren.
- In der FINEARTS-HF Studie konnte gezeigt werden, dass Finerenon bei Patienten mit symptomatischer Herzinsuffizienz und einer LVEF ≥40% die Anzahl der kardiovaskulären Todesfälle und die Gesamtzahl der Herzinsuffizienzereignisse reduziert. Hyperkaliämien stiegen unter Finerenon etwa auf das Doppelte an, waren aber gut kontrollierbar. Die Hypokaliämierate nahm signifikant ab.
Bildnachweis
Gerhard Seybert – stock.adobe.com