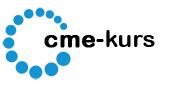Komplexität der Psoriasis
Psoriasis ist eine chronische, bislang unheilbare Erkrankung, deren Entstehung auf einem komplexen Zusammenspiel genetischer, immunologischer und umweltbedingter Faktoren beruht. Da der Entzündungsprozess nicht nur die Haut, sondern den gesamten Körper betrifft, ist Psoriasis mit einem erhöhten Risiko für eine Vielzahl an Begleiterkrankungen verbunden, insbesondere für das metabolische Syndrom. Darüber hinaus hat die Erkrankung erhebliche negative Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen sowie auf die Versorgungskosten. Psoriasis verläuft bei jedem Patienten unterschiedlich. Es existieren verschiedene Endotypen und Phänotypen der Erkrankung, die sich in Schweregrad, Verlauf und Ansprechen auf die Therapie unterscheiden. Ein Endotyp bezeichnet einen Subtyp einer Krankheit oder eine Untergruppe einer Population, die durch einen gemeinsamen zugrunde liegenden Krankheitsmechanismus definiert ist. Der Phänotyp hingegen beschreibt das äußere Erscheinungsbild der Krankheit, das durch das Zusammenspiel von Genotyp, epigenetischen Faktoren und Umwelteinflüssen bestimmt wird.
Pathogenetische Aspekte für eine individuelle Behandlung
Der Hauptauslöser der Psoriasis ist nach wie vor unbekannt. Neben einer genetischen Veranlagung sind in der Regel äußere Trigger wie Streptokokken-Infektionen oder Stress erforderlich, um die Entstehung eines entzündlichen Milieus in der Haut auszulösen. Hierbei spielen TH17-Zellen eine zentrale Rolle. Über Botenstoffe wie Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) fördern dendritische Zellen die Ausschüttung von Wachstumsfaktoren, die für das Überleben der TH17-Zellen notwendig sind, insbesondere Interleukin-(IL-)23. TH17-Zellen setzen verschiedene IL-17-Zytokine frei, die als Gefahrensignal für Keratinozyten dienen. Die IL-17-Familie umfasst mehrere Subtypen, die jeweils eine spezifische Rolle im Entzündungsprozess spielen, dazu gehören IL-17A, IL-17C, IL-17E und IL-17F. IL-17-Zytokine sind entscheidend für die Aktivierung der Keratinozyten, was zu ihrem verstärkten Wachstum und zu einer unzureichenden Differenzierung führt. Infolgedessen setzen sie vermehrt proentzündliche Botenstoffe frei, die Immunzellen, insbesondere neutrophile Granulozyten, anlocken. Das gesamte Entzündungsgeschehen bildet einen Kreislauf, der an verschiedenen Stellen durch Biologika unterbrochen werden kann. Diese gehören den Klassen Anti-TNF-α, Anti-IL-23 und Anti-IL-17 an. Bei der Auswahl der geeigneten Therapie für Psoriasis-Patienten müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Zu den objektiven Kriterien, die auch in Leitlinien verwendet werden, gehört die Schwere der Erkrankung, die mithilfe des „Psoriasis Area and Severity Index” (PASI) bewertet wird, sowie die betroffenen Hautareale. Besonders relevante Lokalisationen wie sichtbare Bereiche, die Kopfhaut oder die Fingernägel können ein zusätzliches Kriterium sein, das den Einsatz einer systemischen Therapie rechtfertigt. Daneben spielen patientenbezogene Faktoren eine wesentliche Rolle. Im Rahmen eines „shared decision making” wird gemeinsam mit dem Patienten die passende Therapie ausgewählt. Dabei werden frühere Behandlungsversuche, die Präferenzen des Patienten hinsichtlich der Applikationsform (z. B. orale Therapie oder Injektionen) sowie die gewünschten Behandlungsintervalle besprochen. Für den behandelnden Arzt sind zusätzlich therapiebezogene Faktoren entscheidend. Der Wirkeintritt, also wie schnell das Therapieziel erreicht werden kann, steht unter anderem im Vordergrund, ebenso wie die Sicherheit im Hinblick auf mögliche unerwünschte Ereignisse. Auch praktische Aspekte wie die Auswirkungen auf den Lebensstil und die Kosten der Therapie spielen eine Rolle. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf Komorbiditäten, insbesondere auf kardiometabolischen Störungen, da bekannt ist, dass Psoriasis-Patienten häufiger an diesen Begleiterkrankungen leiden. Eine besonders wichtige Begleiterkrankung ist die Adipositas, die in einem engen Zusammenhang mit Psoriasis auftreten kann.
Psoriasis und Komorbiditäten
Adipositas tritt häufig im Zusammenhang mit Psoriasis auf. Eine Umfrage in Deutschland mit fast 10.000 Psoriasis-Patienten zeigte, dass 66,9 % der Betroffenen übergewichtig (Body-Mass-Index [BMI] ≥25) oder adipös waren (BMI ≥30). Im Vergleich sind laut Selbstauskünften 53 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland übergewichtig oder adipös. Der Schweregrad der Adipositas wirkt sich auf den Verlauf der Psoriasis aus. Mit zunehmendem BMI nimmt die betroffene Körperoberfläche zu. Adipositas und Psoriasis sind chronisch entzündliche Erkrankungen, die sich wechselseitig negativ beeinflussen. Psoriasis kann die Ausübung körperlicher Aktivitäten beeinträchtigen und somit eine gesunde Lebensweise erschweren. Mit steigendem Schweregrad der Psoriasis erhöht sich das Risiko für Adipositas, die wiederum die Entzündung bei Psoriasis begünstigt. Ein erhöhtes Körpergewicht kann darüber hinaus negative Auswirkungen auf die klinische Wirksamkeit von Biologika haben. Es zeigt sich zudem, dass höhere BMI-Werte mit einem Anstieg von Angstzuständen, Depressionen, einer verminderten Lebensqualität, schlechter Schlafqualität, sexuellen Funktionsstörungen und anderen alltäglichen Problemen bei Psoriasis-Patienten assoziiert sind. Die zugrunde liegende systemische Entzündung kann objektiv gemessen werden. PET-CT-Aufnahmen decken die Entzündungsaktivität auf, die sich durch einen erhöhten Glukosemetabolismus äußert. Solche Untersuchungen zeigen, dass bei adipösen Patienten mit schwerer Psoriasis die Entzündung nicht allein auf die Haut beschränkt ist, sondern unter anderem auch die Gefäße, das Herz und die Leber betrifft. Mit steigendem Schweregrad der Psoriasis erhöht sich das Risiko für Komorbiditäten, insbesondere rheumatische Erkrankungen wie Psoriasis-Arthritis sowie die metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD), die zu einer Leberzirrhose führen kann und das Risiko für das hepatozelluläre Karzinom erhöht. Auch periphere Gefäßerkrankungen und Diabetes sowie deren Folgeerkrankungen wie Arteriosklerose und Myokardinfarkt treten vermehrt auf. Diese Komorbiditäten treten nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch bereits bei Kindern auf. Bei Kindern ist der Zusammenhang zwischen Adipositas und dem Auftreten von Arthritis besonders ausgeprägt, weshalb eine sorgfältige Beobachtung notwendig ist. Studien zeigen, dass die Lebenserwartung bei schwerer Psoriasis um drei bis vier Jahre verkürzt ist, was auf die Notwendigkeit frühzeitiger Therapiemaßnahmen verweist.
Entzündungsmodulierende Therapieansätze
Die zentrale Frage ist, ob verfügbare Therapieansätze neben der Haut auch die systemische Entzündung wirksam behandeln können. Bei der Betrachtung der Zytokine, die Psoriasis begünstigen, zeigt sich, dass dieselben Zytokine auch bei den Begleiterkrankungen eine Rolle spielen. IL-17 beispielsweise ist nicht nur an der Psoriasis beteiligt, sondern auch an der Entstehung der MASLD. Im Hinblick auf Arteriosklerose wird nicht mehr davon ausgegangen, dass sie lediglich eine Ablagerungserkrankung ist. Vielmehr handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung, an der Makrophagen und diverse Zytokine beteiligt sind, einschließlich IL-17. Eine wirksame Intervention bei kardiometabolischen Erkrankungen besteht in der Änderung des Lebensstils. Die Durchführung von Lebensstilinterventionen gestaltet sich allerdings als schwierig. Eine Umfrage zeigt, dass lediglich 36 % der Patienten jemals von einem Arzt auf die Notwendigkeit der Gewichtsreduktion angesprochen wurden. Dieses Thema kann im Arzt-Patienten-Verhältnis als unangenehm empfunden werden, da es oft wie ein Vorwurf wahrgenommen wird. Dennoch könnte häufigeres Ansprechen, mit z. B. Nennung von Unterstützungsmöglichkeiten, den Patienten bei der Lebensstilveränderung helfen. Nur 13 % der Befragten erhielten spezifische Angebote zur Unterstützung von Ärzten oder Krankenkassen. Es gibt zunehmend Angebote wie Sport- und Diätprogramme sowie digitale Gesundheitsanwendungen zur Gewichtsreduktion. Gleichzeitig berichten bis zu 41 % der Patienten, dass sie aufgrund ihrer Psoriasis den Sport eingestellt haben. Aktuell treiben nur 21 % der Psoriasis-Patienten Sport, und lediglich 13 % halten eine Diät zur Gewichtsreduktion ein. Diese Zahlen verdeutlichen die Grenzen der Lebensstilinterventionen, die bei korrekter Umsetzung jedoch sehr wirksam sind. Eine weitere wesentliche Frage ist, inwiefern moderne Biologika kardiometabolische Komorbiditäten beeinflussen können. In diesem Zusammenhang ist das Konzept des „psoriatischen Marsches” relevant. Dieses Modell orientiert sich am bekannten atopischen Marsch. Dieser beschreibt die sequenzielle Entwicklung verschiedener Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis im Lebensverlauf. Im Kontext der Psoriasis wird postuliert, dass die systemische Entzündung, die sowohl durch die Psoriasis als auch durch Adipositas bedingt ist, zur Entstehung einer Insulinresistenz führt. Dies kann weiter zu endothelialer Dysfunktion, zu Arteriosklerose sowie schließlich zu Myokardinfarkt oder Schlaganfall führen. Die kritische Frage lautet: Kann eine moderne Systemtherapie diese systemische Entzündung kontrollieren und somit das Fortschreiten des psoriatischen Marsches verhindern?
Systemtherapie mit Biologika
Fettgewebe fungiert als immunologisch aktives Gewebe und produziert proinflammatorische Mediatoren wie IL-6 und TNF-α. Diese Signale wirken auf zahlreiche Organe, darunter das kardiovaskuläre System, die Leber, die Muskulatur und die Gefäße. Bei adipösen Patienten zeigt sich ein schlechteres Ansprechen auf viele Biologika, darunter Adalimumab, Etanercept, Infliximab, Secukinumab und Ustekinumab, was in zahlreichen Zulassungsstudien sowie in einer dänischen Kohortenstudie zu Biologika beobachtet wurde. Ein höheres Körpergewicht korreliert mit einem schlechteren Therapieansprechen. IL-17-Zytokine spielen eine entscheidende Rolle sowohl bei Psoriasis als auch bei Adipositas und sind bei adipösen Patienten in erhöhten Plasmakonzentrationen nachweisbar. Der entzündliche Signalweg von IL-17 bei Adipositas bildet einen Kreislauf, in dem Haut- und Fettgewebe sich gegenseitig negativ beeinflussen. Ein erhöhter IL-17-Plasmaspiegel kann die Psoriasis verschärfen, während die entzündliche Aktivität der Psoriasis das Fettgewebe in einem chronisch entzündlichen Zustand hält. Diese Wechselwirkungen zwischen Haut- und Fettgewebe bieten potenzielle Ansatzpunkte für eine duale Therapie von Psoriasis und Adipositas. Neben IL-17A und IL-17F, die von T-Zellen produziert werden, findet sich auch IL-17E, das von Keratinozyten stammt, bei adipösen Patienten in erhöhten Konzentrationen. Ein Zusammenhang zwischen steigendem Körpergewicht und erhöhten Serumkonzentrationen dieser Zytokine deutet auf den Einfluss des Fettgewebes auf die Psoriasis-Entzündung hin. Zugelassene Systemtherapien ermöglichen die gezielte Blockade dieser Zytokine. IL-17A und IL-17F bilden sowohl Homodimere (zwei IL-17A-Zytokine) als auch Heterodimere (ein IL-17A- und ein IL-17F-Zytokin oder zwei IL-17F-Zytokine). Die Blockade von IL-17A-Dimeren erfolgt hauptsächlich durch Secukinumab und Ixekizumab, während Bimekizumab zusätzlich IL-17F-Dimere blockiert. Dies hat klinische Relevanz: Eine Head-to-Head-Studie belegt die überlegene Wirksamkeit von Bimekizumab im Vergleich zu Secukinumab. Brodalumab zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht die zirkulierenden IL-17-Zytokine blockiert, sondern die Untereinheit A des IL-17-Rezeptors, an dem diese binden. Dadurch werden nicht nur IL-17A-, IL-17A/F und IL-17F-Dimere gehemmt, sondern auch IL-17C und IL-17E. Die Blockade des Rezeptors unterbricht die Signalübertragung dieser Zytokine und führt zu einer umfassenderen Modulation der entzündlichen Prozesse.
Klinische Daten der IL-17-Biologika bei adipösen Patienten
Brodalumab
Unter Brodalumab zeigt sich ein hohes Ansprechen hinsichtlich PASI, insbesondere bei übergewichtigen Patienten. In einer Subanalyse wurde festgestellt, dass bei Patienten mit einem BMI >30 kg/m2 eine PASI-100-Ansprechrate von 65 % und eine PASI-90-Ansprechrate, die als allgemeines Therapieziel gilt, bei fast 90 % erreicht wird. Die Wirksamkeit ist demnach unabhängig vom Körpergewicht sehr gut. Eine Dosisanpassung bei übergewichtigen und adipösen Patienten ist daher nicht erforderlich. Die Abbruchrate zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gewichtsgruppen. Ebenso zeigen sich keine signifikanten gewichtsabhängigen Unterschiede im Hinblick auf das Sicherheitsprofil.
Secukinumab
Secukinumab wurde in einer Studie hinsichtlich des klinischen Ansprechens bei Patienten mit einem Körpergewicht ≥90 kg im Vergleich zu solchen <90 kg untersucht. In dieser randomisierten Studie wurden 82 Patienten entweder der Secukinumab-Gruppe oder einer Placebogruppe zugewiesen. Ab Woche 12 erhielten alle Patienten Secukinumab. Die placebokontrollierte Phase zeigte, dass die PASI-90-Ansprechrate bei einem Gewicht ≥90 kg schlechter war, was die Empfehlung einer Aufdosierung zur Erreichung der gleichen Wirksamkeit in dieser Gewichtsklasse begründet. Die Studie untersuchte auch zwei Behandlungsintervalle: die zugelassene Dosierung (fünfmal wöchentlich und dann monatlich) im Vergleich zu einer Gruppe, die alle zwei Wochen eine Verabreichung erhielt. Die Wirksamkeit erhöhte sich bei der zweiwöchentlichen Gabe, wodurch die Rate der Patienten mit einem PASI 90 bei übergewichtigen Patienten auf 76 % anstieg. Bei der vierwöchentlichen Dosierung war das PASI-90-Ansprechen um 25 % geringer. Das Sicherheitsprofil war vergleichbar.
Bimekizumab
Bimekizumab zeigt ebenfalls eine gewichtsabhängige Wirksamkeit. Die kritische Gewichtsschwelle liegt bei 120 kg. In klinischen Studien ergab eine Post-hoc-Analyse, dass das Ansprechen bei Patienten ≥120 kg im Hinblick auf den PASI 90 zwar leicht reduziert ist, der Unterscheid im PASI-100 Ansprechen jedoch an Woche 52 numerisch größer war und bei der vier- bzw. achtwöchentlichen Erhaltungsdosis 51,4 % bzw. 68,6 % betrug. Die Anpassung der Intervalle bedeutet praktisch, dass die doppelte Anzahl von Injektionen erforderlich ist, womit sich auch die Kosten und der Aufwand verdoppeln. Die Verdopplung der Dosis erhöht die Rate von Nebenwirkungen, wie eine orale Candidose, jedoch nicht signifikant.
Ixekizumab
Bei Ixekizumab zeigt sich ebenfalls eine Abhängigkeit der Wirksamkeit vom Körpergewicht. In einer Analyse über zwölf Wochen, die die vierwöchentliche mit der zweiwöchentlichen Gabe verglich, wurde eine Gewichtsschwelle bei 100 kg festgelegt. Die Ansprechraten bezüglich des PASI 90 und PASI 100 waren in der Gruppe der Patienten mit einem Körpergewicht ≥100 kg geringer. Beim zweiwöchigen Dosierungsintervall erreichte das PASI-90-Ansprechen bei Patienten <100 kg etwa
70,6 %, während es bei Patienten ≥100 kg bei 60,2 % lag. Bei einem vierwöchigen Dosierungsintervall lag das Ansprechen bei Patienten <100 kg noch bei 68,4 %, bei Patienten ≥100 kg hingegen nur noch bei 52,7 %. In Bezug auf die Sicherheit zeigen sich auch hier keine signifikanten Unterschiede zwischen der zweiwöchentlichen und der vierwöchentlichen Gabe. Eine Dosisanpassung ist bei Ixekizumab nicht in-label möglich.
Therapieanpassung der Biologikatherapie bei adipösen Patienten
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter der Therapie mit den genannten Biologika, ausgenommen mit Brodalumab, ein gewichtsabhängiges Wirkansprechen zu beobachten war. Bei diesen auf den IL-17-Signalweg abzielenden Therapien zeigte sich, sowohl bei Patienten mit höherem Körpergewicht als auch bei höherer Dosierung oder kürzerem Dosierintervall, ein konsistent günstiges Sicherheitsprofil. Dennoch wird die Therapieanpassung aufgrund der teils höheren Kosten in der klinischen Praxis nur selten umgesetzt. Laut den Fachinformationen der zur Verfügung stehenden Biologika für die Plaque-Psoriasis ist eine gewichtsabhängige Anpassung der Therapie zum Teil auch bei anderen modernen Systemtherapeutika empfohlen, einschließlich des Anti-IL-12/23 Ustekinumab, Anti-IL-23 Tildrakizumab sowie Anti-TNF-α.
Real-World-Daten
Klinische Studien untersuchen stets eine begrenzte Patientenpopulation mit spezifischen Einschlusskriterien. Daher ist es wichtig, die Wirksamkeit von Biologika in einer breiteren Population zu evaluieren, die den Bedingungen in der täglichen Praxis entspricht (Real-World-Daten). BIOREP ist ein multizentrisches, tschechisches Register, in dem Langzeitdaten zur Wirksamkeit und Sicherheit von IL-17-Inhibitoren bei der Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Psoriasis in der täglichen Patientenversorgung gesammelt werden. Eine aktuelle Studie wertete die Daten aus dem BIOREP Register aus, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Lebensqualität von Patienten zu bewerten, die mit IL-17-Inhibitoren behandelt wurden. Eingeschlossen wurden Patienten mit Psoriasis, die mindestens eine Dosis von Brodalumab, Ixekizumab oder Secukinumab erhielten. Die Baseline-Charakteristika
zeigen, dass der durchschnittliche BMI zu Studienbeginn bei 29,5 ± 5,9 lag. Übergewicht lag bei 36 % der Patienten vor, während 40,6 % adipös waren. Der PASI 90 wurde bei etwa 80 % und der PASI 100 bei 60 bis 65 % der Patienten unter Therapie mit Brodalumab erreicht. Dies entspricht den Ergebnissen klinischer Studien und weist auf ein sehr gutes Ansprechen hin. Bei Ixekizumab fiel das Ansprechen etwas geringer aus, und bei Secukinumab lag der PASI 90 bei etwa 60 %. Der durchschnittliche „Dermatology Life Quality Index” (DLQI) verbesserte sich signifikant bei allen Patienten, was auf eine gesteigerte Lebensqualität hinweist. LIBERO ist eine nichtinterventionelle, offene, multizentrische Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Brodalumab nach zwölf und 52 Wochen im klinischen Alltag in Deutschland untersucht. Hierbei wurden 628 Patienten aus 148
deutschen Studienzentren eingeschlossen, die mindestens eine Dosis von 210 mg Brodalumab erhielten und an Psoriasis litten. In einer Subgruppenanalyse der LIBERO-Studie wurde das Ansprechen von Patienten in Bezug auf das Körpergewicht näher untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ansprechraten bei Patienten >100 kg und ≤100 kg vergleichbar gut waren. Diese Erkenntnisse decken sich mit Beobachtungen aus randomisierten Studien. Bei Brodalumab besteht
keine Notwendigkeit zur Dosisanpassung oder zur Verordnung zusätzlicher Injektionen, da übergewichtige oder adipöse Patienten mit der Standarddosierung effektiv behandelt werden können. Die empfohlene Dosis Brodalumab beträgt 210 mg und wird als subkutane Injektion in Woche 0, 1 und 2, gefolgt von 210 mg alle 2 Wochen, verabreicht.
Überlegungen zur individualisierten Therapie
Das Ziel einer individuellen Behandlung besteht darin, Psoriasis-Patienten bereits mit der ersten Systemtherapie eine effektive Krankheitskontrolle zu ermöglichen und die Lebensqualität zu verbessern. Dabei soll nicht nur die Hautbeteiligung adressiert, sondern auch die systemische Inflammation kontrolliert werden. Verständnis für die Pathophysiologie der Psoriasis-Erkrankung ist grundlegend für die Entwicklung von zielgerichteten Behandlungen, die hochpräzise und wirksam
sind. Es besteht die Hoffnung, dass durch die Unterbrechung dieses Entzündungskreislaufes langfristig das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall gesenkt werden kann. Langzeitstudien und Register, wie das deutsche PsoBest-Register oder dänische Kohortenstudien, könnten künftig genauere Daten hierzu liefern. Die Heterogenität der Erkrankung ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Therapie. Die Wahl der Biologika hängt von den Erwartungen des Patienten ab: Ein schnelles Ansprechen wird durch IL-17-Inhibitoren erreicht, während bei weniger häufigen Injektionen die IL-23-Inhibitoren vorteilhafter sind. Dies sollte in Absprache mit dem Patienten entschieden werden. Moderne IL-17-Biologika zeichnen sich durch ein gutes Sicherheitsprofil aus. Dies gilt auch für übergewichtige und adipöse Patienten sowie beim Verdoppeln der Dosierung und Halbieren des Therapieintervalls. Eine langfristige Remission ist entscheidend für die Lebensqualität und die Arbeitsfähigkeit der Patienten. Das Erreichen der Remission senkt auch langfristig die Kosten für das Gesundheitssystem. Die Therapieadhärenz verbessert sich, wenn die Patienten einen schnellen Wirkeintritt und wenige Nebenwirkungen erfahren. Der Therapieerfolg könnte die Motivation erhöhen, aktiver zu werden und gesündere Lebensgewohnheiten wie Sport und eine ausgewogene Ernährung zu verfolgen, was wiederum die Prognose verbessern könnte.
Fazit
- Psoriasis betrifft nicht nur die Haut, sondern erhöht das Risiko für Begleiterkrankungen, insbesondere für das metabolische Syndrom.
- Psoriasis ist häufig mit Adipositas assoziiert; eine Umfrage ergab, dass 66,9 % der Betroffenen übergewichtig oder adipös sind.
- TH17-Zellen und die Interleukin-17-Familie spielen eine zentrale Rolle in der Pathogenese der Psoriasis.
- Bei der Therapieauswahl sind der Schweregrad der Erkrankung und patientenbezogene Faktoren entscheidend, die im Rahmen von „shared decision making” berücksichtigt werden.
- Lebensstilinterventionen sind effektiv zur Reduzierung kardiometabolischer Erkrankungen, jedoch oft schwer umzusetzen.
- Wechselwirkungen zwischen Haut- und Fettgewebe bieten Ansätze für eine duale Therapie von Psoriasis und Adipositas.
- Ein erhöhtes Körpergewicht kann die Wirksamkeit von Biologika beeinträchtigen, was bei manchen Wirkstoffen Anpassungen der Dosis oder des Behandlungsintervalls erforderlich machen kann.
- IL-17-Biologika weisen ein gutes Sicherheitsprofil auf, auch bei adipösen Patienten.
Bildnachweis
Mariia Korneeva – stock.adobe.com