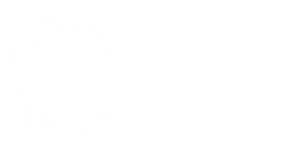Patientenversorgung bei nAMD im klinischen Alltag erleichtern
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
- aktuelle Herausforderungen der Patientenversorgung,
- von Patienten berichtete Behandlungsbarrieren,
- Effekte moderner Medikamente für die Krankheitskontrolle und Behandlungslast,
- Tipps zum Einsatz im Praxisalltag.
Einleitung
Die Einführung der intravitrealen operativen Medikamentengabe (IVOM) von Anti-VEGF-Medikamenten (VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor) vor 20 Jahren markierte den entscheidenden Durchbruch in der Behandlung der neovaskulären AMD (nAMD). Seither hat die Therapie Erfolge ermöglicht, die mit früheren Optionen nicht erzielbar waren. Während die Erkrankung unbehandelt zur Erblindung führt, kann das Sehvermögen bei der Mehrheit der Patienten unter einer Anti-VEGF-Therapie nicht nur erhalten, sondern auch wieder verbessert werden. So gelang es seit der Einführung der VEGF-Inhibitoren, die Wahrscheinlichkeit für eine Sehverschlechterung als Folge einer nAMD bis hin zur Erblindung um 41 % zu reduzieren. Wesentliche Entwicklungen der letzten Jahre zielten darauf ab, die Praktikabilität der Anti-VEGF-Behandlung zu verbessern. Dazu zählen die Erforschung und Implementierung individualisierter Therapieregime ebenso wie die Entwicklung von Medikamenten mit verlängerter Wirkdauer. Übergreifende Ziele sind es, Behandlungsintervalle besser planbar zu machen und längere Behandlungsintervalle sowie eine an den individuellen Bedarf angepasste Behandlung und eine gute Erkrankungskontrolle zu ermöglichen.
Längere Behandlungsintervalle gewünscht
Das entspricht auch den Wünschen und Erwartungen von Ärzten und Patienten. Zwar erzielt die Anti-VEGF-Therapie seit Jahren in randomisierten kontrollierten Studien bei der Mehrheit der Patienten sehr gute Ergebnisse und führt zu einer Verbesserung der Sehschärfe und der morphologischen Parameter. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist allerdings eine konsequente Einhaltung der Therapie, um langfristig ein gutes Sehvermögen zu erhalten. Dies geht mit einer hohen Behandlungslast für die Patienten (und die behandelnden Zentren) einher, wie eine retrospektive Fallserie aus dem klinischen Alltag zeigt. Diese verglich die 10-Jahres-Egebnisse einer Kohorte unter vorwiegender pro re nata (PRN-)Behandlung mit denen einer Kohorte unter überwiegender Behandlung im „Treat-and-Extend”-(T&E-)Regime. Während die PRN-Kohorte im Verlauf der zehnjährigen Behandlung etwa 15 Buchstaben gegenüber dem Ausgangswert verlor, wurde in der T&E-Kohorte das Sehvermögen über zehn Jahre auf einem recht hohen Niveau von durchschnittlich etwa 60 ETDRS-Buchstaben weitgehend stabil erhalten. Allerdings erhielten die Patienten im T&E-Regime zwischen den Jahren 3 und 7 etwa doppelt so viele Injektionen wie die Kohorte im PRN-Regime. Die Autoren schlussfolgerten, dass bei konsequenter Anwendung der Anti-VEGF-Therapie auch im klinischen Alltag langfristig eine Visusstabilisierung möglich sei, die Patienten dafür allerdings einen entsprechenden Behandlungsaufwand in Kauf nehmen müssten. Dieser belastet sowohl Patienten als auch Ärzte und geht mit dem Risiko von Nichtadhärenz einher, die wiederum zu einer suboptimalen Kontrolle der Erkrankung und zu Sehkraftverlusten führen kann. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass sich sowohl Patienten als auch Ärzte neue Lösungen wünschen, um die Behandlungslast zu reduzieren. So gaben in der globalen Barometer-Befragung zur Versorgungssituation von Patienten mit Netzhauterkrankungen 73 % der befragten nAMD-Patienten an, ihnen seien längere Zeiträume zwischen den Behandlungen ohne Sehkraftverluste wichtig. Gleichzeitig gaben auch 88 % der Augenärzte an, dass die Häufigkeit der Behandlung zu viel sein kann.
Augenärztliche Versorgung unter Druck
Hinzu kommt, dass schon heute steigende Patientenzahlen bei gleichzeitig zunehmendem Fachärztemangel die augenärztliche Versorgung vor große Herausforderungen stellen: Immer mehr Patienten stehen immer weniger Ärzten gegenüber – und eine weitere Zuspitzung der Situation ist zu erwarten. Grund dafür ist der demografische Wandel, der die Problematik gleich von zwei Seiten befeuert: So ist in Deutschland bereits jede fünfte Person mittlerweile älter als 66 Jahre. Damit treten die starken Jahrgänge der „Babyboomer-Generation” in das Alter ein, in dem sie zunehmend von altersbedingten Erkrankungen wie der nAMD betroffen sein werden. Europaweit wird aufgrund der alternden Bevölkerung bis 2050 ein Anstieg der nAMD-Prävalenz auf 77 Millionen erwartet. Demgegenüber steht eine immer kleiner werdende Ärzteschaft: Fast 60 % der Augenärzte sind heute bereits 50 Jahre oder älter und werden innerhalb der nächsten Jahre aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden. Daher sind innovative Lösungen gefragt, die zukünftig eine adäquate ausgenärztliche Versorgung ermöglichen. Auch in diesem Zusammenhang sind Therapieoptionen wünschenswert, die bei vergleichbarem Visusgewinn verlängerte Behandlungsintervalle ermöglichen, für gute Planbarkeit und eine reduzierte Behandlungslast sorgen und so dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern und eine adäquate Versorgung aufrechtzuerhalten.
Verschiedene Anti-VEGF-Medikamente verfügbar
Heute steht in Deutschland mit Ranibizumab, Aflibercept, Brolucizumab und Faricimab eine breite Palette verschiedener, von der EMA zugelassener Originalpräparate sowie auch Biosimilars zur Behandlung der nAMD zur Verfügung. Die Wirkstoffe unterscheiden sich u. a. hinsichtlich ihrer Dosis, Halbwertzeit und Bindungsaffinität sowie im Hinblick auf die adressierten Bindungsziele. Während Ranibizumab und Brolucizumab ausschließlich gegen VEGF-A gerichtet sind, bindet der bispezifische Antikörper Faricimab zusätzlich zu VEGF-A auch Angiopoetin-2. Dies zielt darauf ab, die Gefäßpermeabilität und Entzündung zu reduzieren sowie die Angiogenese zu hemmen und eine Gefäßstabilität zu fördern. Im Vergleich zu den anderen Anti-VEGF-Medikamenten ist Aflibercept der einzige breit zugelassene Wirkstoff, der alle VEGFR-1-Liganden sowie den zentralen VEGFR-2-Liganden hemmt und zusätzlich zu VEGF-A auch den Plazentawachstumsfaktor („placenta growth factor”, PlGF) neutralisiert. Wird der PlGF nicht abgefangen, so bleiben die über diesen Signaltransduktionsweg vermittelte Entzündungsreaktion und Leckage weiter bestehen. Studien zum Einsatz der Originalpräparate haben unterschiedliche Behandlungsintervalle untersucht: So haben etwa die Studien TENAYA und LUCERNE gezeigt, dass Patienten mit nAMD unter Faricimab mit Injektionsintervallen von zwölf oder 16 Wochen ähnlich gute Ergebnisse erzielen konnten wie mit Aflibercept 2 mg in achtwöchigen Intervallen. Allerdings durften in diesen Studien die Behandlungsintervalle in dem Vergleichsarm mit Aflibercept 2 mg nicht verlängert werden. Die ergänzende Stellungnahme der Fachgesellschaften hält dazu fest: „Hierbei ist aufgrund des Studiendesigns kein direkter Wirksamkeitsvergleich mit den anderen Wirkstoffen für die üblichen Behandlungsstrategien möglich. Auch die klinische Relevanz unterschiedlicher Therapieintervalle ist in zukünftigen Studien noch weiter zu klären. Für die Therapieentscheidung soll zudem das Sicherheitsprofil des jeweiligen Medikaments miteinbezogen werden, da besonders bei Brolucizumab intraokulare Entzündungen beobachtet wurden und für Faricimab noch keine längerfristigen Sicherheitsdaten vorliegen.”
Dosiserhöhung eines etablierten Wirkstoffs
Aktuelle Weiterentwicklungen zielen darauf ab, den Wirkeffekt bei gleichzeitigem Erhalt der bekannten Wirkstärke zu verlängern. Dadurch können längere Behandlungsintervalle erreicht und so die Behandlungslast reduziert werden. Eine wichtige Stellschraube zur Verlängerung des Wirkeffektes im Auge ist eine hohe molare Dosis. Denn vereinfacht ausgedrückt dauert es bei einer initial höheren Dosis länger, bis die Anti-VEGF-Konzentration im Auge wieder soweit abgesunken ist, dass der Schwellenwert der VEGF-Suppression unterschritten wird – und demensprechend verlängert sich die Wirkdauer. Ziel der Entwicklung von Aflibercept 8 mg war es, durch die im Vergleich zu Aflibercept 2 mg vierfache Dosis eine Verlängerung der wirksamen Konzentration des Medikamentes im Glaskörper zu erreichen und so den Anteil an Patienten mit verlängerten Behandlungsintervallen von 16 Wochen oder mehr noch weiter zu steigern.
Vergleichbare Wirksamkeit bei weniger Injektionen
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Aflibercept 8 mg in zwölf- und 16-wöchigen Intervallen wurde in der randomisierten, doppeltmaskierten, 96-wöchigen Phase-III-Studie PULSAR bei über 1000 therapienaiven Patienten mit nAMD im Vergleich zu Aflibercept 2 mg in festen achtwöchigen Intervallen untersucht. Direkt zu Beginn der Studie wurden die Patienten auf drei Behandlungsarme randomisiert: 2q8: Aflibercept 2 mg alle acht Wochen; 8q12: Aflibercept 8 mg alle zwölf Wochen, 8q16: Aflibercept 8 mg alle 16 Wochen. In allen drei Behandlungsarmen erhielten die Patienten zunächst drei initiale monatliche Uploadinjektionen. Direkt im Anschluss wurden die Patienten in den beiden Armen mit dem hochdosierten Präparat mit zwölfwöchigen oder 16-wöchigen Intervallen weiterbehandelt. Im ersten Jahr konnten die Intervalle in diesen beiden Armen je nach Krankheitsaktivität gemäß vorab festgelegten Kriterien lediglich verkürzt werden. Erst im zweiten Behandlungsjahr war eine Intervallverlängerung möglich. Voraussetzung war, dass der Visus im Vergleich zu Woche 12 weniger als fünf Buchstaben verringert war und keine neuen Blutungen in der Makula oder Neovaskularisationen vorlagen. Zudem durfte keine intra- oder subretinale Flüssigkeit im zentralen Teilfeld der Netzhaut vorhanden sein. Die 2-Jahres-Daten (96 Wochen) bestätigen eine lang anhaltende Wirksamkeit der höheren Dosierung: Der primäre Endpunkt der Nichtunterlegenheit zwischen Aflibercept 2 mg und 8 mg bezüglich der Sehschärfe zu Woche 48 wurde erreicht. In beiden Behandlungsregimen mit dem hochdosierten Präparat erzielten die Patienten anhaltende Visusgewinne, die mit denen unter Aflibercept 2 mg in festen achtwöchigen Intervallen vergleichbar waren und bis Woche 96 aufrechterhalten wurden – und dies mit geringerer Injektionszahl.
Zugewiesene Behandlungsintervalle beibehalten
Zum Ende der Studie erreichten 88 % der Patienten unter dem hochdosierten Präparat ein zuletzt zugewiesenes Behandlungsintervall von zwölf Wochen oder länger, fast die Hälfte erreichte sogar 20-wöchige Intervalle. Zudem zeigte sich, dass die große Mehrheit der Patienten beider 8-mg-Arme trotz der frühen Intervallverlängerung nach dem initialen Upload (von vierwöchig direkt auf zwölf- oder 16-wöchig) über den gesamten Verlauf der Studie stabil mit diesen verlängerten Intervallen weiterbehandelt werden konnte. Insgesamt legen die Daten nahe, dass Aflibercept 8 mg die Option bietet, die Mehrheit der Patienten mit nAMD mit einem Intervall von mindestens zwölf Wochen behandeln zu können. Zudem kann ein großer Teil der Patienten auch mit noch längeren Intervallen von bis zu 24 Wochen behandelt werden. Dieser unterschiedliche Behandlungsbedarf spiegelt auch die Erfahrungen aus dem klinischen Alltag wider: Das Sicherheitsprofil des hochdosierten Präparates entsprach dem bekannten Sicherheitsprofil von Aflibercept 2 mg. Neue unerwünschte Ereignisse traten nicht auf. Auch die Rate an Augeninnendruckanstieg oder intraokularen Entzündungen war nicht erhöht. Endophthalmitis, ischämische optische Neuropathie, okklusive Retinitis oder retinale Vaskulitis wurden unter dem hochdosierten Präparat gar nicht beobachtet.
Über drei Jahre stabil
Aktuelle Daten einer Verlängerungsstudie zeigen, dass die Ergebnisse unter der hohen Dosierung auch bis zu drei Jahren stabil aufrechterhalten werden können. Dabei wurden im Rahmen dieser Extensionsstudie auch die Patienten des 2-mg-Behandlungsarmes nach Woche 96 ohne vorherigen Upload auf eine Behandlung mit 8 mg Aflibercept in einem zwölfwöchigen Intervall umgestellt. Auch in dieser Gruppe konnte der Visus bis zu Woche 156 auf einem hohen Niveau bei reduzierter Behandlungslast erhalten werden: Acht von zehn dieser unter 2 mg vorbehandelten Patienten erreichten mit dem hochdosierten Präparat ein Intervall von zwölf Wochen oder länger. Zudem wurde bei allen Patienten – in Übereinstimmung mit der Visusentwicklung – auch eine zügige und länger anhaltende Abnahme der zentralen Netzhautdicke beobachtet, die über den gesamten dreijährigen Verlauf beibehalten wurde.
Rasche Trocknung – Hinweis für lange Intervalle
Dabei ist insbesondere der Blick auf die Flüssigkeitskontrolle im frühen Behandlungszeitraum interessant: So wurde unter dem hochdosierten Präparat im Vergleich zu Aflibercept 2 mg eine signifikant raschere und überlegene Trocknung der Makula erzielt. Dies zeigt die Analyse zum Anteil der Patienten ohne Flüssigkeit im zentralen Teilfeld der Netzhaut („center subfield”, CSF): Nach der Uploadphase (zu Woche 16), in der alle Patienten dreimal monatlich behandelt worden waren, erreichten 63 % der Patienten unter dem hochdosierten Präparat eine trockene Makula, signifikant mehr als unter Aflibercept 2 mg (52 %; p = 0,0002). Dieser Anteil konnte weiter gehalten werden. Auch zu Woche 48 erreichten 69 % der Patienten mit dem hochdosierten Präparat eine trockene Makula (vs. 59 % unter Aflibercept 2 mg) bei weniger Injektionen. Zudem zeigt eine Post-hoc-Analyse, dass eine schnellere Trocknung der Makula während der initialen Behandlungsphase als ein potenzieller Biomarker für die Vorhersage dienen kann, dass Patienten mit nAMD verlängerte Behandlungsintervalle unter Aflibercept 8 mg erreichen. So behielten rund 80 % der Patienten, die bereits in Woche 4 keine Flüssigkeit mehr in der Netzhaut aufwiesen, ein 16-wöchiges Intervall bis Woche 48 bei, gegenüber einem Anteil von 66 % bei Patienten, die in der ersten Behandlungsphase nie ohne Flüssigkeit waren. Patienten mit Restflüssigkeit in der initialen Behandlungsphase konnten dennoch zu einem erheblichen Anteil ein 16-Wochenintervall erreichen.
Mögliche Gründe für unterschiedliches Ansprechen
Derzeit versuchen verschiedene Forschungsvorhaben das unterschiedliche Ansprechen der Patienten mit nAMD auf eine Anti-VEGF-Therapie genauer zu untersuchen. Auch wenn Alter und genetische Faktoren als stärkste – allerdings nicht beeinflussbare – Risikofaktoren für das Auftreten von Spätstadien der AMD gelten, gibt es doch zuverlässige experimentelle und klinische Hinweise darauf, dass auch modifizierbare Faktoren wie z. B. körperliche Aktivität oder Rauchen sowie systemische Einflüsse über pro- und antiangiogene Faktoren im Blut die Erkrankung und deren Verlauf beeinflussen können. Mehrere Studien haben den Einfluss der Ernährung in diesem Zusammenhang beschrieben, wobei bestimmte Antioxidantien, Fischöle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und eine verminderte Vitamin-D-Zufuhr im Fokus stehen. Nun legen tierexperimentelle Untersuchungen sowie Blutanalysen von Patienten mit nAMD unter Anti-VEGF-Behandlung nahe, dass Saccharin eine schützende Rolle zu spielen und zu einer besseren Kontrolle der pathologischen Läsionen und einer Verringerung der Narbenbildung beizutragen scheint. Möglicherweise hat Saccharin das Potenzial, pathologische VEGFR-1-induzierte Immunreaktionen über das RPE (retinales Pigmentepithel), das Saccharin im Blutkreislauf wahrnimmt, abzuschwächen.
Einsatz im klinischen Alltag – Barrieren adressieren
Im klinischen Alltag kann der Einsatz von Anti-VEGF-Medikamenten mit verlängerter Wirkdauer dazu beitragen, die Versorgung nun noch individueller auf die Bedürfnisse der Patienten abzustimmen und mögliche Hürden gegenüber der Behandlung zu überwinden. Diese können sehr unterschiedlich sein, wie die Barometer-Studie zeigt, die neue Evidenz zur Versorgungssituation von Patienten mit chronischen Netzhauterkrankungen liefert. So ist etwa die Behandlungslast im klinischen Alltag auch in der deutschen Kohorte bei vielen Patienten mit nAMD hoch: Die Diagnose „nAMD” bestand bei der überwiegenden Mehrheit (70 %) der befragten Patienten seit mindestens zwei Jahren, in der Hälfte der Fälle lag die Erkrankung bilateral vor. Viele dieser Patienten (44,5 %) waren bereits intensiv behandelt worden und hatten zwischen elf und 60 Anti-VEGF-Injektionen erhalten, etwas mehr als ein Fünftel sogar schon über 60 Injektionen. In der globalen Barometer-Studie gab fast jeder zweite Patient an, die Belastung durch die Behandlung sei zu hoch. Zudem nehmen viele der meist älteren und nur eingeschränkt mobilen Patienten auch den mit der Behandlung einhergehenden logistischen Aufwand durch An- und Abreise sowie die damit verbundenen Kosten als belastend wahr. Auch die Sorge, Familie oder Freunden zur Last zu fallen, lange Wartezeiten während der Termine oder die Angst vor der Behandlung werden von etwa einem Viertel bis einem Drittel der Patienten in Deutschland als Behandlungshürde beschrieben.
Behandlung maßschneidern – Belastung reduzieren
Grundsätzlich kann eine längere Wirkdauer bei guten Visusergebnissen und einem vergleichbaren Sicherheitsprofil den Bedürfnissen aller Patienten mit nAMD entgegenkommen. So ergab eine Subgruppenanalyse, dass alle Patienten der PULSAR-Studie im Hinblick auf ihre Visusentwicklung und Behandlungslast gleichermaßen von einer Behandlung mit dem hochdosierten Präparat mit längerer Wirkdauer profitierten – unabhängig von ihrer Ethnie, von ihrem Visus oder der Netzhautdicke zu Baseline und ebenso unabhängig von Typ und Größe der vorliegenden makulären Neovaskularisationen. Daraus ergeben sich für den klinischen Alltag flexible Möglichkeiten zur Therapieoptimierung, um so sowohl bei therapienaiven als auch bei vorbehandelten Patienten unabhängig von ihren individuellen Krankheitscharakteristika eine gute Erkrankungskontrolle und/oder reduzierter Behandlungslast zu erreichen. Auch im klinischen Alltag sind dazu direkt nach dem Upload Intervallverlängerung basierend auf dem funktionellen und/oder morphologischen Befund auf bis zu 16 Wochen möglich. Im Anschluss daran ist bei stabilem Befund auch eine weitere Intervallverlängerung auf bis zu fünf Monate möglich, wobei Kontrolluntersuchungen nach Ermessen des behandelnden Arztes erfolgen sollten.
Fallbeispiel: therapienaive Patientin
Die Möglichkeit, durch den Einsatz des hochdosierten Präparates bei Patienten mit nAMD eine rasche Trocknung der Netzhaut und eine gute Erkrankungskontrolle zu erreichen, zeigt der Fall einer 73-jährigen, therapienaiven Patientin mit nAMD (CB). Diese hatte seit vier Wochen eine Sehverschlechterung am linken Auge (Visus dezimal: 0,2) einhergehend mit erheblichen Metamorphospien wahrgenommen. Die Diagnostik mittels Fluoreszenzangiografie und optischer Kohärenztomografie (OCT) ergab das Vorliegen makulärer Neovaskularisationen sowie intraretinaler Flüssigkeit im Bereich der Makula. Zudem ergaben die Untersuchungen auch Hinweise auf das Vorliegen einer polypoidalen choroidalen Vaskulopathie, die möglicherweise eine intensivere Therapie erfordert. Die hier getroffenen Handlungsentscheidungen orientieren sich im Wesentlichen an der Stellungnahme der Fachgesellschaften DOG, RG und BVA. Bereits nach dem Upload mit drei monatlichen Injektionen war die intraretinale Flüssigkeit vollständig abgetrocknet. Auch funktionell zeigte sich ein schnelles Ansprechen: Der Visus war auf 0,4 dezimal angestiegen, zudem nahm die Patientin keinerlei Metamorphopsien mehr war. In der Kontrolluntersuchung nach acht Wochen zeigte sich – bei weiterhin stabilem Visus – allerdings erneut eine geringe Menge intraretinaler Flüssigkeit und somit weiterhin Krankheitsaktivität. Das Behandlungsintervall wurde daher zu diesem Zeitpunkt nicht über acht Wochen hinaus verlängert. Die Patientin befindet sich nun in kontrollierter Behandlung im „Treat-and-Extend”-Regime und hat wieder eine vollständige Abtrocknung der Makula bei weiterhin stabilem Visus erreicht.
Anwendung bei vorbehandelten Patienten
Eine weitere Gruppe stellen Patienten dar, die auf bislang verfügbare Standardtherapien nur unzureichend ansprechen und nicht über achtwöchige Intervalle hinauskommen. Hier bietet eine Umstellung auf Aflibercept 8 mg die Chance auf eine bessere Kontrolle der Krankheitsaktivität und auf längere Behandlungsintervalle, wie auch das folgende Fallbeispiel aus unserer Praxis zeigt (CB). Bei einem 85-jährigen Patienten mit nAMD und bestehender Pigmentepithelabhebung war auch nach zehn Anti-VEGF-Injektionen mit einem Off-Label-Präparat keine ausreichende Erkrankungskontrolle eingetreten. Unter achtwöchigen Intervallen kam es regelmäßig zu erneuter Krankheitsaktivität einhergehend mit einer Verschlechterung des Sehvermögens. Zudem hatte der Patient eine weite, umständliche Anreise und wünschte eine geringere Behandlungsbelastung. Nach Umstellung auf Aflibercept 8 mg war nach dreimaligem Upload die intraretinale Flüssigkeit vollständig abgetrocknet. Mittlerweile kann der Patient bei stabilem Visus auf hohem Niveau und trockener Makula mit zwölfwöchigen Intervallen behandelt werden. Ein weiteres Fallbeispiel zeigt, dass es wichtig ist, die Verlängerung der Behandlungsintervalle nach dem Upload auf die bestehende Krankheitsaktivität abzustimmen und diese auch entsprechend zu kontrollieren. Langfristige Stabilität liegt erst vor, wenn eine vollständige Krankheitskontrolle erreicht ist, d. h. keine intraretinale Flüssigkeit mehr vorliegt. Insbesondere große Läsionen und eine chronische Aktivität, angezeigt durch bestehende Exsudate trotz regelmäßiger Anti-VEGF-Injektionen, sind Hinweise für einen hohen individuellen Behandlungsbedarf. In diesen Fällen können auch mit einem hochdosierten Präparat kürzere, an die Krankheitsaktivität und den Behandlungsbedarf angepasste Intervalle beibehalten werden, um zu einer besseren Erkrankungskontrolle beizutragen.
Fazit
- Die nAMD ist eine chronische Erkrankung, die eine langfristige Therapie und konsequente Adhärenz der Patienten erfordert.
- Strukturelle, regionale, logistische Herausforderungen erschweren eine adäquate augenärztliche Versorgung.
- Länger wirksame und sichere Medikamente können helfen, diese Herausforderungen zu meistern.
- Länger wirksame Medikamente können den Anteil der Patienten mit geringerer Behandlungslast erhöhen und zu einer langfristig erfolgreichen Therapie beitragen.
- Beispiele aus dem klinischen Alltag zeigen, dass dies heute bereits möglich ist.
Bildnachweis
dobok – Adobe Stock
Autoren
Interessenkonflikte
Dr. Christian Karl Brinkmann: AbbVie, Afidera, Alimera, Apellis, Bayer, Novartis, Roche, Santen; Studien: AbbVie, Alexion, Annexon, Afidera, Bayer, BoehringerIngelheim, Novartis, Roche, SandozHexal, Santen, Santhera, TeleonSponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 14.900,- durch die Bayer Vital GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt