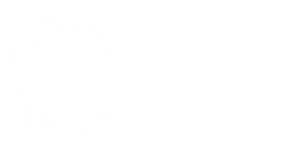Pathophysiologie und Therapie von Harnwegsinfektionen
Am Ende dieser Fortbildung wissen Sie ...
- welche mikrobiellen Erreger am häufigsten Harnwegsinfektionen verursachen,
- wie uropathogene Bakterien und Pilze den Harntrakt besiedeln,
- welche Abwehrmöglichkeiten der menschliche Körper besitzt,
- welche Risiken Antibiotika mit sich bringen können,
- welche nicht antibiotischen Therapien ergänzend zu Antibiotika genutzt werden können.
Einleitung
Jedes Jahr erkranken Millionen Menschen an Harnwegsinfektionen (HWI, Zystitis), meist ausgelöst durch das coliforme Bakterium Escherichia coli. Schätzungen zufolge erleiden 40 % der Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens eine meist unkomplizierte HWI, wobei es bei etwa 20 bis 30 % von ihnen innerhalb von drei bis vier Monaten zu einem Rezidiv kommt. Pathogene E. coli-Varianten sind für komplexe und dynamische Infektionszyklen verantwortlich, und die von ihnen verursachten HWI zählen zu den häufigsten Infektionen des Menschen überhaupt. Ob eine HWI asymptomatisch verläuft oder sich sogar eine Pyelonephritis bzw. rezidivierende Infekte entwickeln, wird dabei maßgeblich durch die genetische Ausstattung des Erregers, aber auch durch spezifische Zytokin- und Zellrezeptorvarianten des Menschen bestimmt. Die gramnegativen E. coli-Stäbchenbakterien sind generell Bestandteil des natürlichen menschlichen Darmmikrobioms, mit ca. 107 bis 109 koloniebildenden Einheiten pro Gramm Fäzes. Als eine Hauptquelle für bakterielle HWI kommen somit die eigenen Darmbakterien infrage. Neben apathogenen Kommensalen gibt es auch Pathotypen, die viele Infektionen verursachen – darunter auch HWI, die in ihrer unkomplizierten Ausprägung mit typischen Symptomen wie häufigem Wasserlassen, Druckgefühl, flockigem oder trübem Urin und gelegentlich Fieber einhergehen. Als Hauptverursacher einer HWI bei Frauen gelten uropathogene E. coli (UPEC), die trotz wiederholter Antibiotikatherapien im Harntrakt persistieren und Rezidive verursachen können. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika – auch zur HWI-Behandlung – trägt zum weltweiten Anstieg antimikrobieller Multiresistenzen (AMR) bei. So gab es im Jahr 2019, berechnet auf Basis von 471 Millionen einzelnen Datensätzen oder Isolaten, etwa 4,9 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit bakterieller AMR, darunter 1,27 Millionen Todesfälle, die auf bakterielle AMR zurückzuführen sind. Hinzu kommen indirekte AMR-bedingte psychische Auswirkungen durch Depressionen und Schlafstörungen bei den von anhaltenden HWI-Rezidiven Betroffenen, denen Antibiotika nicht mehr dauerhaft helfen können.
Molekulare und zelluläre Determinanten bakterieller Harnwegsinfektionen
Genetische Variationen und Modifikationen bedingen maßgeblich Unterschiede zwischen apathogenen E. coli und UPEC. Die Gesamtheit der Gene, die bei allen E. coli zu finden sind, wird auf ca. 2000 Gene geschätzt. Dagegen besitzen UPEC im Schnitt 4700 Gene und sind somit verglichen mit apathogenen E. coli-Spezies Träger einer Vielzahl zusätzlicher genetischer Informationen, die über Virulenz und Fitness entscheiden. Diese Plastizität ermöglicht eine Adaption an verschiedenste biologische, extraintestinale Nischen. Zur erfolgreichen Besiedelung des Harntraktes nutzen UPEC unterschiedliche molekulare Oberflächenstrukturen, um sich an zelluläre Strukturen des Harnwegsepithels (Urothel) anzuheften. Mithilfe seiner Flagellen kann das Bakterium verschiedene Loci innerhalb des Harntraktes erreichen. So wandern UPEC durch die Urethra und finden dabei vorzugsweise über Typ-1-Pili, der wichtigsten von etwa einem Dutzend E. coli-eigenen Anheftungsstrukturen (Adhäsine), Kontakt an Mannose-Verbindungen des Uroplakins, dem häufigsten Adhäsionsprotein des Urothels. Auf diesem Weg können UPEC bis in den oberen Harntrakt gelangen und dort Pyelonephritiden auslösen, bis hin zu einer Urosepsis. Schließlich können UPEC mithilfe der Typ-1-Pili auch die Zellwände der Harnblase durchdringen, einen der relevantesten Virulenzfaktoren für eine Zystitis. Dabei können UPEC tiefere Urothel-Schichten erreichen, dort persistieren und Rezidive verursachen. Die Membranbarriere des Urothels, die einen solchen direkten Zugang pathogener Bakterien zunächst verhindern soll, wird durch Uroplakine und Glykosaminoglykane gebildet. Zudem können pathogene Bakterien über den Mechanismus einer Exfoliation bzw. über apoptotische Prozesse vom Epithel wieder abgestoßen werden. Durch weitere bakterielle Komplexbildungen können biofilmähnliche Verbindungen am Urothel oder an Fremdkörpern (z. B. Blasenkathetern) entstehen. Ein Virulenzfaktor, der u. a. auch an der Biofilmbildung beteiligt ist, ist das Lipopolysacharid-Endotoxin (LPS). Das aus Zucker- und Lipideinheiten bestehende LPS besetzt einen Großteil der Membranoberfläche gramnegativer Bakterien und ist für deren Membranintegrität mitverantwortlich. Bei einer HWI wird LPS vom Immunsystem des Wirtes erkannt und kann starke Immunantworten auslösen, bis hin zu einem endotoxischen Schock mit septischen Krankheitsbildern.
Antimikrobielle Strategien und Immunsystem
Neben den schützenden Barrieremechanismen des Urothels können antimikrobielle Peptide des Harntraktes UPEC auch direkt angreifen. Dazu gehören das Pilibindende Uromodulin, Lipocalin 2 und Lactoferrin. Diese Peptide unterstützen die Abwehr von Erregern und sind an der Initiierung der Immunantwort des Wirtes beteiligt. Zur Einleitung einer Immunantwort werden zunächst Abwehrzellen des angeborenen Immunsystems aktiviert, die im Harntrakt oder innerhalb des Urothels patrouillieren. Die Wirtszellen erkennen bakterienspezifische molekulare Muster maßgeblich über Toll-like-Rezeptoren (TLR). Dadurch werden zelluläre Signalkaskaden stimuliert und die Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine für eine rasche Immunantwort veranlasst. Dazu nehmen im frühen Verlauf einer HWI phagozytotische Immunzellen, wie Dendritische Zellen oder Makrophagen, Bakterienfragmente auf, prozessieren diese und präsentieren sie spezialisierten Zellen des adaptiven Immunsystems. Schließlich sezernieren B-Lymphozyten Antikörper gegen die bakteriellen Strukturen. Weitere Zellen des Immunsystems, darunter T-Helferzellen, zytotoxische und regulatorische T-Zellen, komplettieren die Immunabwehr.
Die besondere Rolle der Siderophore als Virulenzfaktor
Ein weiterer entscheidender Faktor für eine HWI ist die Verfügbarkeit von Eisen. So beruht ein Abwehrmechanismus des Körpers darauf, die Spiegel von freiem Eisen, das für das Überleben pathogener Mikroorganismen essenziell ist, lokal niedrig zu halten. Als Adaptationsmechanismus können diese infektiösen Erreger nieder-molekulare bakterielle Verbindungen nutzen, die Siderophore (z. B. Enterobactin, Salmochelin, Yersiniabactin oder Aerobactin). Siderophore bilden mit höchster Affinität Komplexe mit Eisen(III)-Ionen, die anschließend rezeptorvermittelt über spezifische membranassoziierte Transportsysteme der Bakterienzelle zugeführt werden und so für deren Stoffwechsel nutzbar sind. Neu entwickelte antimikrobielle Wirkstoffe machen sich diese eisenbindende Strategie der Siderophore zunutze und bilden die Basis innovativer neuer Medikamente wie dem Cefiderocol, einer synthetischen Verbindung aus Cephalosporin und einem Siderophor. So bindet Cefiderocol zunächst Eisen(III)-Ionen, wird dann von der bakteriellen Zelle als vermeintlicher Siderophor-Komplex gebunden und in die Zellzwischenräume des Urothels eingeschleust. Dort bindet der Cephalosporin-Anteil an seine Zielstruktur, das Penicillin-bindende Protein (PBP) und kann so seine antimikrobielle Aktivität entfalten.
Therapie von Harnwegsinfektionen
Die weltweite AMR-Problematik und eine Vielzahl inzwischen verfügbarer nicht antibiotischer Ansätze zur Behandlung einer unkomplizierten HWI unterstützen ein optimiertes HWI-Management, das hilft, Antibiotikaverschreibungen möglichst zu reduzieren. Dieses Konzept greift auch die neue Leitlinie zur Therapie der akuten unkomplizierten Zystitis auf. Einerseits empfiehlt diese die in der Erstlinie vorzugsweise einzusetzenden Antibiotika Fosfomycin, Nitrofurantoin, Nitroxolin oder Pivmecillinam, andererseits weist sie auch auf nicht antibiotikabasierte, symptomorientierte Vorgehensweisen bei einer unkomplizierten Zystitis hin. Zu möglichen Optionen gehören grundsätzlich:
- Verhaltensschulungen
- Hormontherapien
- Immunstimulation
- Phytopharmaka
- Probiotika
- Antimikrobielle Ansätze
- Sonstige (z. B. D-Mannose)
Ibuprofen
In einer Vergleichsstudie mit Ibuprofen vs. Fosfomycin benötigte nur ein Drittel der mit Ibuprofen behandelten Patienten anschließend noch ein Antibiotikum, allerdings um den Preis einer höheren Symptomrate und Pyelonephritis-Inzidenz.
Phytopharmaka
Die Einmalgabe einer Kombination aus Tausendgüldenkraut, Liebstöckel und Rosmarinextrakt erfüllte die Kriterien einer Nichtunterlegenheit gegenüber Fosfomycin.
D-Mannose
Oral verabreichte D-Mannose eignet sich zur Therapie oder Prophylaxe einer unkomplizierten Zystitis nach einer UPEC-Infektion aufgrund der Adhäsionsspezifität der bakteriellen Typ-1-Pili. In Head-to-Head-Vergleichen einer niedrig dosierten D-Mannose-Dauerprophylaxe mit dem Antibiotikum Nitrofurantoin zeigte sich zwischen beiden kein signifikanter Unterschied vs. keine Prophylaxe.
Immunstimulanzien
Die Arzneimittel OM-89 (Uro-Vaxom®) und StroVac® sollen das Immunsystem trainieren, damit es Harnwegserreger schneller erkennt und effektiver bekämpfen kann. OM-89 ist eine oral verabreichte, lysierte immunaktive Fraktion ausgewählter E. coli-Stämme. Eine Studie aus dem Jahr 2005 zeigte eine gute Verträglichkeit und einen signifikanten Rückgang rezidivierender HWI. Nach einer dreimonatigen Grundimmunisierung und Auffrischung konnte ein Abfall der Rezidivrate von bis zu 43 % beobachtet werden. StroVac® ist ein inaktiviertes Enterobakteriengemisch unterschiedlicher HWI-Erreger, das im Abstand von einer Woche dreimal intramuskulär injiziert wird. In einer Vergleichsstudie mit Nitrofurantoin ergab sich auch bei den mit StroVac® geimpften Patienten eine reduzierte HWI-Rezidivrate. StroVac® rief bei Nierentransplantatempfängern keine Sicherheitsbedenken hervor. Auch hier sank die Rezidivrate symptomatischer HWI bei Geimpften. Weiterhin löste exponiertes LPS in Form eines E. coli-Polysaccharid-Konjugat-impfstoffes (ExPEC4) in ersten Evaluierungen vielversprechende Immunantworten aus. Einen immunstimulierenden Ansatz stellt UM-140 (Uromune®) dar. Das sub-lingual verabreichte inaktivierte Gemisch aus E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis und Proteus vulgaris senkte bei postmenopausalen Frauen nach den ersten sechs Monaten der Immunisierung die Rezidivrate um >60 %.
Probiotische Ansätze
Probiotische Ansätze, in denen die apathogenen Bakterien Lactobacillus rhamnosus GR-1, L. reuteri RC-14 oder L. crispatus lokal appliziert wurden, ergaben ein klinisches Ansprechen vs. Placebo. Deren Wirksamkeit war aber geringer als die eines Antibiotikums. Weiterhin können E. coli-Stämme, die eine asymptomatische Bakteriurie (ABU) auslösen, protektiv angewendet werden. Die ABU-Bakterien sind bzgl. ihrer Virulenzeigenschaften geschwächt und können den Harntrakt besiedeln, ohne dabei eine starke Immunantwort auszulösen. Eine Mischung, bestehend aus dem eine ABU auslösenden E. coli-Stamm 83972 und UPEC wurde für Instillationen bei Patienten mit HWI bzw. Rezidiven verwendet. Dabei verdrängten die ABU-Stämme die UPEC, wobei erfolgreich kolonisierte Patienten in der Zeit der Besiedlung signifikant weniger HWI als die Kontrollgruppe entwickelten. Weitere alternative Therapieansätze
- Eine vaginale Östrogenisierung, z. B. durch Cremes, kann bei postmenopausalen Frauen die Rate von HWI und Rezidiven senken.
- Oral aufgenommenes Methenamin-Hippurat wird im Harntrakt durch sauren Urin zu einem bakteriziden Formaldehyd-Derivat umgewandelt. Durch die veränderte Zusammensetzung des Urins werden Rezidive unterbunden. In einer Studie war Methenamin-Hippurat einer niedrig dosierten antibiotischen Dauerprophylaxe nicht unterlegen.
- Eine endovesikale Instillationstherapie mit einer Kombination aus Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat resultierte in einer HWI-Rate <10 % pro Patient und Jahr vs. knapp 90 % bei einer Instillation mit einem Placebo – bei Verbesserung des „Quality of Life”-Scores und guter Verträglichkeit. Eine Reduktion von rezidivierenden HWI wurde auch nach einem alleinigen Einsatz von Hyaluronsäure erreicht.
Erreger von Mykosen des Harnwegstraktes
Durch Pilze verursachte HWI betreffen meist ältere hospitalisierte Patienten. Eine durch den virulenten Sprosspilz Candida albicans verursachte Candidurie steht dabei an erster Stelle der Ursachen. Typischerweise ist die Candidurie eine opportunistische sekundäre Infektion, die häufig asymptomatisch verläuft und als Kolonisierung bezeichnet wird. Risikofaktoren sind ein Diabetes, hohes Alter, die Behandlung bakterieller Infektionen mit Breitspektrumantibiotika, lange stationäre Aufenthalte speziell auf Intensivstationen, Harnstau bzw. eine Obstruktion, Fremdkörper wie Harnkatheter oder Blasensteine, operative Eingriffe oder eine Nierentransplantation.
Bestimmung und Differenzierung Uropathogener Pilze
Uropathogene Pilze können auf Blutagar oder Chromagar kultiviert werden. Eine initiale Bestimmung und Differenzierung kann dabei über den Geruch und die Kulturmorphologie erfolgen. Auf Chromagar lassen sich Pilze aufgrund der unterschiedlichen Koloniefärbungen unterscheiden. Schneller ist die Diagnostik durch „matrix-assisted laser desorption ionisation time-of-flight“-Massenspektrometrie (MALDI-TOF), die auch eine Differenzialdiagnostik erlaubt. Eine Bestimmung ist auch mittels PCR oder kommerziellen biochemischen Tests möglich.
Virulenz und Abwehr pathogene Candida
Pathogene Candida-Stämme zeichnen sich u. a. durch die für eine HWI-relevanten Phospholipasen sowie das zytolytische Exotoxin Candidalysin aus. Zudem bestimmen Polysaccharid-Strukturen der Zellwandoberfläche von C. albicans – Mannane, Glucane und Chitin – das inflammatorische Potenzial des Pilzes. Ein früher Schritt im Infektionsgeschehen ist die Adhäsion des Erregers an das Uroepithel über Mannan und Glucane. Dabei erfolgt die Invasion in Epithelzellen sowohl durch induzierte Endozytose als auch durch aktives Eindringen. Das Candidalysin zerstört zudem die Epithelbarriere der Harnblase; dieser Invasionsprozess kann durch Proteasen verstärkt werden. Die anatomische Barriere des Uroepithels wird zusätzlich durch besiedelnde Bakterien unterstützt, die dabei helfen, pathogene Keime zu verdrängen. Zudem beinhaltet der menschliche Urin >100 verschiedene antimikrobielle Peptide, z. B. das Lactoferrin. Lactoferrin senkt u. a. lokal die Eisenkonzentration und verhindert so die Proliferation uropathogener Mikroorganismen. Weiterhin spielen kationische Oligopeptide, darunter das Defensin, eine wichtige Rolle. Während einer Infektion wird die Produktion von β-Defensin stimuliert. Es induziert eine Porenbildung in der Candida-Zellwand und bewirkt so die Abtötung des Pilzes. Mannane, Glucane und Chitin werden als „pathogen-associated molecular pattern” (PAMP) auch von Makrophagen-Rezeptoren erkannt. Dies leitet eine das Immunsystem stimulierende Freisetzung von Zytokinen ein. Zudem können Makrophagen C. albicans phagozytieren. So in das Zellinnere gelangte virulente C. albicans-Spezies können die Wirtszelle jedoch durch die Bildung von Keimschläuchen gezielt zerstören. Interessanterweise verfügt der apathogene Pilz C. krusei nicht über diesen Mechanismus – er wird innerhalb weniger Stunden phagozytiert und intrazellulär eliminiert und ist daher weniger aggressiv als C. albicans.
Bildung von Biofilm
Nach der Adhäsion von Mikroorganismen, die innerhalb von Minuten stattfindet, können sich innerhalb weniger Stunden bis Tage Biofilme und Mikrokolonien bilden, bevorzugt an Grenzflächen zwischen fester und flüssiger Phase, z. B. an Fremdkörpern. In den Folgetagen schließen sich die Pilze in einer extrazellulären Matrix aus Kohlenhydraten, Dextranen, Proteinen und Lipiden ein, in die nur wenige Wirkstoffe hineindiffundieren können. Die Bildung von Biofilmen variiert stark mit der jeweiligen Unterlage. So entstehen an kostengünstigen Latexkathetern schneller Biofilme als an Materialien, die zu 100 % aus Silikon bestehen. Auch Rost bietet eine Oberfläche, an der sich Pilze massiv vermehren können. Die Ausprägung eines Biofilmes wird zudem durch Veränderungen des Umgebungsmilieus beeinflusst, z. B. der Temperatur, dem pH-Wert, der Fließgeschwindigkeit und dem Nährstoffwandel (hoher Glucose-, Lactose- oder Saccharosegehalt). Antimykotika verlieren an Wirkkraft, da die Erreger in einem Biofilm eng beieinanderliegen, nicht mehr proliferieren und daher durch Antimykotika schlechter angreifbar sind.
Klinische Bedeutung der Candidurie
Keime können durch Aszension aus dem Mikrobiom des Darmes oder durch hämatogene Streuung (selten) in die Blase gelangen. Werden sowohl im Darm als auch im Urin viele Pilze nachgewiesen, hat wahrscheinlich auch an anderen Körperstellen eine massive Besiedelung stattgefunden. Dabei ist es nicht immer einfach, eine Unterscheidung zwischen einer „einfachen”, eher unproblematischen Kolonisierung und einer therapiebedürftigen Infektion zu treffen. Entzündungsparameter sind häufig nicht aussagekräftig, und auch die klinischen Symptome lassen oft keinen eindeutigen Rückschluss auf eine Infektion zu. Im Vergleich zu einer symptomatischen bakteriellen Zystitis ist Fieber bei einer Candidurie weniger stark ausgeprägt. Auch wird das C-reaktive Protein (CRP) durch diese Pilze kaum stimuliert, und eine Leukozytose im Blut ist oftmals nicht nachweisbar. Oft wird die Quantität der Pilze zur Beurteilung einer Infektion bestimmt (z. B. Nachweis von >105 Candida-Keimen pro ml Mittelstrahlurin). In diesem Zusammenhang sind ältere Leitlinien nicht eindeutig. Bis 2015 wurde eine Candidurie in der damals gültigen Richtlinie als Kolonisierung und nicht als Infektion dargestellt. In der neuen Auflage dieser S3-Leitlinie wird dies nicht mehr kommentiert, wobei die aktuelle S1-Leitlinie möglicherweise mehr Hinweise gibt. Diese besagt, dass der alleinige Nachweis von Pilzen im Urin keinen Beweis für ein Infektionsgeschehen darstellt. Derzeit werden der kombinierte Nachweis einer HWI, hoher Erregerzahlen, einer Leukozyturie und entsprechender klinischer Symptome als aussagekräftigste Indizien angesehen. Eine kürzlich veröffentlichte Global Guideline für das Management von Candida-Infektionen gibt zudem aktuelle Empfehlungen für Antimykotika. Noch sind keine festen Kriterien definiert, ob eine Candidurie eine gezielte Therapie notwendig macht. Bei intensivmedizinisch betreuten oder nierentransplantierten Patienten wird eine recht hohe Candidurie-Inzidenz von 11 % beobachtet, die eine separate Therapiebewertung erfordern kann. Andere Quellen berichten, dass im Falle eines Nachweises von Candida spp. im Urin von Nierentransplantierten keine antifungale Therapie nötig sei, da sich daraus noch nie eine Candidämie entwickelt habe. Da es nur wenige wirksame Antimykotika gibt, ist eine Entscheidung über deren Einsatz grundsätzlich einfacher als bei einer antibakteriellen Therapie. So greift das Antimykotikum Amphotericin B direkt das Ergosterin an und bildet Poren. Wirkstoffe aus der Gruppe der Azole, z. B. Fluconazol, behindern die Biosynthese des Ergosterins. Dieses Steroid ist für die normale Funktion der Pilzzellmembran wichtig, ähnlich wie das Cholesterin in der Zellwand menschlicher Zellen. Konventionelles Amphotericin B wird jedoch nur langsam ausgeschieden, und somit ist die Konzentration im Urin recht gering. Die parenterale Gabe von konventionellem Amphotericin B verursacht zudem starke Nebenwirkungen, und die besser verträgliche liposomale Amphotericin-B-Formulierung zeigt aufgrund noch geringerer Urinkonzentrationen kaum Wirkung gegen Candida. Eine Blasenspülung mit konventionellem Amphotericin B erreicht lokal zwar eine hohe Konzentration, ist aber wenig effizient. Die Anwendung von Fluconazol ist bei einer Infektion mit entsprechend empfindlichen Pilzen angezeigt. Im Allgemeinen ist Fluconazol gegen C. albicans wirksam, jedoch weniger gegen C. glabrata, C. krusei oder Trichosporon asahii. Allerdings ist Fluconazol nur wenig aktiv gegen Keime, die einen Biofilm gebildet haben. Andere Azole sind nicht geeignet, da sie nur geringe Wirkspiegel im Urin erreichen. Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine hemmen wiederum die Produktion von 1,3-β-Glucan und destabilisieren damit die Pilzzellwand. Zwar zeigen sie eine gute Wirksamkeit gegen die meisten askomyzetischen Sprosspilze, erreichen aber nur geringe Konzentrationen im Urin und sind daher für die Therapie einer Sprosspilzinfektion der Harnwege ungeeignet. Zudem müssen sie intravenös verabreicht werden. In Deutschland besteht nun die Möglichkeit, das 8-Hydroxychinolin-Derivat Nitroxolin einzusetzen, ein Antibiotikum und Antimykotikum, das überwiegend renal ausgeschieden wird. Es wirkt gegen fast alle Coli-Bakterien, hemmt auch Keime in Biofilmen und zeigt zudem eine gute Wirksamkeit gegen Fluconazol-resistente Candida-Spezies wie C. glabrata oder C. krusei. Nitroxolin ist gut verträglich und wird daher nicht nur zur Therapie von HWI mit Sprosspilzen, sondern auch zur Prophylaxe empfohlen, was für andere Antimykotika nicht der Fall ist. Auch gegen mehrere klinische C. auris-Isolate zeigte Nitroxolin eine ausgezeichnete In-vitro-Aktivität. Therapieempfehlungen bei symptomatischer Candida-Zystitis:
- Eine symptomatische Fungurie mit Zystitis (Keimzahl, Leukozyturie oder sogar Pyelonephritis) sollte therapiert werden;
- Wenn möglich Entfernung von Blasenkathetern, Stents oder anderen Fremdkörpern;
- Bei Fluconazol-sensiblen Sprosspilzen: Gabe von Fluconazol 200 mg/Tag oral für zwei Wochen; bei Fluconazol-resistenten Formen: Gabe von Nitroxolin dreimal 250 mg/Tag oral für zwei Wochen (speziell bei den Fluconazol-resistenten Sprosspilzen C. glabrata, C. krusei, Trichosporon asahii; wirkt auch bei Biofilmbildung); oder Flucytosin viermal täglich 25 mg/kg oral für zehn Tage; oder konventionelles Amphotericin B (Desoxycholat) 0,3 bis 0,6 mg/kg intravenös pro Tag für sieben Tage (Vorsicht Nephrotoxizität: Eine Irrigation sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen, z. B. bei Personen >65 Jahre.);
- Bei bestehender Neutropenie kann eine prophylaktische antimykotische Therapie indiziert sein.
Fazit
- Harnwegsinfektionen zählen zu den häufigsten Infektionen des Menschen und werden meist von hochspezialisierten UPEC ausgelöst.
- Durch die Adaptationsfähigkeit der UPEC sind Infektionszyklen mehrschichtig und sehr dynamisch.
- Genetische Prädispositionen des Wirtes tragen zu einer vermehrten HWI-Anfälligkeit bei.
- Resistenzentwicklungen von bakteriellen Erregern gegenüber Antibiotika sind hochproblematisch.
- Um den Antibiotikaeinsatz zu senken, sollten multimodale Interventionsansätze bei akuter unkomplizierter Zystitis in Betracht gezogen werden.
- Virulente Formen des Sprosspilzes Candida albicans sind die häufigste Ursache für eine Fungurie.
- Die Behandlung bei einer Fungurie bedarf sorgfältiger Abwägung und sollte nur bei symptomatischer Infektion oder bei Risikopatienten durchgeführt werden.
Bildnachweis
220 Selfmade studio – Adobe Stock
Referenten
PD Dr. med. Guiseppe Magistro (FEBU) Chefarzt Klinik für Urologie Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der Christian-Albrechts-Universität-zu-Kiel Suurheid 20 22559 Hamburg Prof. Dr. med. Herbert Hof MVZ Heidelberg Im Breitspiel 16 69126 HeidelbergInteressenkonflikte
PD Dr. med. Guiseppe Magistro: Bezahlter Referent / Berater: Bionorica SE, Desitin, Merck-Serono, Lilly Deutschland, MIP-Pharma, Medical Park, Experts in Stone Disease, International Urolithiasis Society, European Urolithiasis Society Prof. Dr. med. Herbert Hof hat keine Interessenkonflikte angegeben.Sponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit 14.900 EUR durch die Firma MIP Pharma Holding GmbH unterstützt
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt