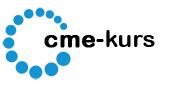Teil 1: Prävalenz, Inzidenz und sozioökonomische Daten aus Deutschland
Weltweit hat der Opioid-Verbrauch seit den 1990er-Jahren stark zugenommen. Von 1997 bis 2007 stieg die Zahl der Opiatverordnungen in den USA um 149 %, sodass dort inzwischen 80 % aller Opiate weltweit verbraucht werden. Dabei sind vor allem nicht tumorbedingte Schmerzen die Hauptindikation. Gerade der Einsatz von Opioiden in diesen Bereichen mehrt international die Sorge um eine zunehmende Zahl von Patienten, die über eine langfristige Behandlung mit Analgetika und vornehmlich Opioiden in eine Schmerzmittelabha¨ngigkeit geraten. Als Hinweis auf einen nicht sachgemäßen Einsatz von Opioiden mehren sich die Publikationen vor allem aus dem angloamerikanischen Raum, die einen Zusammenhang zwischen der zunehmenden Opioid-Verordnung und Todesfällen durch Überdosierungen sehen.1,2,3
In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Todesfälle infolge einer unbeabsichtigten Opioid-Überdosierung in den USA dramatisch angestiegen. Metaanalysen, die zu 90 % auf amerikanischen Daten basieren, kommen zu dem Ergebnis, dass 5–10 % der Patienten, die Opioide bekommen, einen Missbrauch betreiben.4
Für Deutschland zeigen Auswertungen einer Versichertenstichprobe der AOK Hessen/KV Hessen für die Jahre 2000 bis 2010 einen Anstieg der Opioid-Verordnungen um 37 % sowie eine Zunahme der Tagesdosen um 109%. Opioide wurden überwiegend zur Behandlung des Nichttumorschmerzes eingesetzt. Im Jahr 2010 waren es 77 % der Opioid-Empfänger. Auch nahm der Anteil der Langzeitbehandlungen im Untersuchungszeitraum deutlich zu.5
Obwohl wesentliche Unterschiede in der Verschreibungspraxis von Opioiden in Deutschland zu den USA bestehen, gibt es bislang nur wenige Daten zur Prävalenz der Opioid-Schmerzmittel-Abhängigkeit bei Nichttumorschmerzpatienten hierzulande.
Opioid-Abusus – Situation in Deutschland
Erste Hinweise ermittelten Prof. Häuser und Dr. Marshall. Die Forscher haben Daten aus dem Jahr 2012 von rund 870.000 Versicherten der Barmer GEK ausgewertet und die Einjahresprävalenz für die, wie sie es genannt haben, „Abuse/Addiction of Prescribed Opioids“, bestimmt. Einen Abusus schrieb man Patienten zu, die mentale Verhaltensstörungen infolge der Einnahme von Alkohol, Opioiden oder Tranquilizern zeigten oder Narkotika-Intoxikationen erlitten. Die Untersuchung ergab, dass lediglich 0,008 % der Patienten aus solchen Gründen hospitalisiert wurden.6
Analyse der GKV-Datenbank 2014
Neue Daten liefert nun die Studiengruppe von Prof. Tölle und Kollegen. Diese hat insgesamt 4 Millionen Datensätze aus der GKV-Datenbank 2014 untersucht.
Zunächst wurde festgestellt, wie viele der 4 Millionen Versicherten eine Opioid-Verordnung in 2014 erhalten hatten. Das waren 169.000.
In den weiteren Untersuchungsschritten wurden insgesamt vier Schärfungskriterien angewendet:
- Patienten mit voller Beobachtungszeit
- Patienten mit mindestens einer Opioid-Verordnung in drei aufeinanderfolgenden Quartalen
- Nur Patienten ohne Krebserkrankung
- Nur Patienten ohne Substitutionstherapie
Im weiteren Verlauf der Analyse wurden diese Daten auf die Gesamtpopulation in Deutschland hochgerechnet. In 2014 lag die deutsche Bevölkerung bei etwa 81 Millionen. Bei Anwendung der oben genannten Schärfungskriterien ergeben sich dann:
- 3 Millionen Patienten mit mindestens einer Opioid-Verordnung,
- 1 Million mit der vollen Beobachtungszeit, das heißt jeweils mindestens eine Opioid-Verordnung in drei aufeinanderfolgenden Quartalen,
- 695.000 Patienten ohne Krebserkrankung und
- 640.000 Patienten ohne Substitutionstherapie.
Demnach gelten annähernd 640.000 Menschen in Deutschland als Langzeit-Opioid-Patienten.
Definition einer Risikopatietengruppe
Welche Patienten sind besonders gefährdet? Um potenzielle Risikopatienten besser beschreiben zu können, wurden auf Basis von Einzelinterviews, nach Literatursichtung, Expertenkreis und Expertenmeinungen die nachfolgenden Kriterien definiert:
- Höhe der Opiat-Dosis – als Grenzwert wurde 120 mg Morphinäquivalenz pro Tag angesetzt
- Kombination mit einer Benzodiazepin-Therapie
- Zeigen diese Patienten ein Doctor-Hopping?
- Vorliegen spezifischer, auf eine Abhängigkeit hinweisende Diagnosen.
Da die untersuchten Patienten sowohl starke (z. B. Morphin) als auch schwache (z. B. Tilidin) Opioide erhielten, wurden Morphinäquivalenzen (MÄ) gebildet. Eine Überschreitung war gegeben, wenn der Tagesmittelwert an MÄ oberhalb des MÄ-Schwellenwertes von 120 mg MÄ/Tag lag. Der Tagesmittelwert errechnete sich aus der Morphinäquivalenz-Gesamtsumme aller innerhalb eines Jahres verordneten Opioid-Präparate dividiert durch 365 Tage.
Nach Anwendung dieses ersten von vier Risikokriterien zeigten 63.000 Langzeit-Opioid-Patienten eine auffällig erhöhte Opiat-Dosierung. Insgesamt 9,91 % der Versicherten erhielten eine Dosierung über dem Schwellenwert.
Die parallele Einnahme von Benzodiazepinen wird auch in Deutschland häufig praktiziert. Auf die damit verbundenen Risiken für eine Abhängigkeit weist die Internationale Gesellschaft zur Erforschung des Schmerzes (IASP) immer wieder hin.
Die Datenanalyse hinsichtlich dieses Risikofaktors zeigte, dass fast jeder zehnte Langzeit-Opioid-Patient seine Therapie mit einem Benzodiazepin kombiniert.
Hochgerechtet ergibt das für das Jahr 2014 eine Zahl von 54.000 Patienten, die ein Opioid und ein Benzodiazepin gleichzeitig dauerhaft einnehmen. Angemerkt sei, dass die Dosierung der Benzodiazepin-Therapie keine Berücksichtigung fand.
Von wie vielen Ärzten erhalten die Patienten ihre Opioid-Verordnungen? Oder anders ausgedrückt: Wie verbreitet ist Doctor-Hopping bei Schmerzpatienten in Deutschland? Auch dieses Kriterium wurde untersucht und ergab folgende Verteilung:
- 100 % der Versicherten erhalten ihre Medikation von einem Arzt,
- bei zwei unterschiedlichen Ärzten sind 56 % in Behandlung
- bei drei unterschiedlichen Ärzten 21 %
- und bei vier unterschiedlichen Ärzte immerhin 6,48 % der Patienten.
41.000 Patienten, die ihre Schmerzmittel von vier verschiedenen Ärzten erhalten. Diese Patienten sind bereits in einem sehr kritischen Bereich des Konsums von Opiaten.
Fast 37.000 Langzeit-Opioid-Patienten wiesen bereits eine diagnostizierte Abhängigkeit auf, wie z. B. psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol, Opioide, Sedativa/Hypnotika, multiplen Substanzgebrauch oder Konsum psychotroper Substanzen, Vergiftung durch Betäubungsmittel oder Psychodysleptika. Die Diagnosen wurden stationär oder ambulant über zwei Quartale gesichert.
Diese Patienten benötigen eine besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Führung der Therapie und des Einsatzes von Opioiden.
Baseline Parameter – Soziodemografie
Ein weiterer Untersuchungsgegenstand war die soziodemografische Verteilung der Patienten mit dem oben beschriebenen Risikoprofil. Die Altersverteilung der Versicherten mit Risikoprofil ist zweigipflig, mit einem ersten Peak im Alter von 55–59 Jahren und einem deutlicheren Peak im Alter von 75–79 Jahren.
Die Patienten mit Risikoprofil sind durchschnittlich 2–3 Jahre jünger. Dieses Kollektiv erhält besonders hohe und häufige Verschreibungen.
Komorbiditäten
Ein weiteres Augenmerk galt der Analyse der spezifischen Komorbiditäten. Die Liste der 15 häufigsten spezifischen Komorbiditäten bei Patienten mit und ohne Risikoprofil wird angeführt von der Diagnose „Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert“, gefolgt von „Rückenschmerzen“, „sonstige chronische Schmerzen“ und „depressive Episoden“.
Betrachtet man Komorbiditäten mit dem größten absoluten Unterschied, dann nehmen erneut dieselben Diagnosen die vorderen Ränge ein:
- Schmerz anderenorts nicht klassifiziert,
- depressive Episoden,
- sonstige chronische Schmerzen,
- somatoforme Störungen,
- psychische Verhaltensstörungen,
- Alkohol,
- andere Angststörungen.
Welche Fachgruppe verordnet Opiate am häufigsten? Es sind die Hausärzte, gefolgt von den Anästhesiologen und Orthopäden.
Es ist daher insbesondere der hausärztliche Bereich, der hinsichtlich der Langzeitverordnung von Opioiden sensibilisiert werden muss.
Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld
Unterschiede zeigten Patienten mit und ohne Risikoprofil auch bei der Arbeitsunfähigkeit (AU) und dem Krankengeld. Rund 6 % der Versicherten, unabhängig vom Risikoprofil, hatten mindestens einen Arbeitsunfähigkeitsfall im Jahr 2014.
Wer das Risikoprofil besitzt, hatte doppelt so viele AU-Tage. Die Länge der Ausfallzeiten war unter Risiko demnach deutlich länger.
Die häufigste AU-Diagnose stellen Schmerzen und Schäden des Rückens dar.
Die Wahrscheinlichkeit, bei Versicherten mit einer Langzeit-Opioid-Therapie im Jahr 2014 einen Krankengeldfall auszulösen, war insgesamt jedoch gering. Allerdings bezogen die Versicherten mit einem Risikoprofil 30 Tage länger Krankengeld im Vergleich zu Versicherten ohne dieses Risikoprofil.
Schließlich sind auch die Kosten, die Langzeit-Opioid-Patienten verursachen deutlich unterschiedlich. Die Gesamtkosten liegen bei Versicherten mit Risikoprofil um 30 % höher als in der Vergleichsgruppe ohne ein Risikoprofil (10.866,65 € vs. 7.581,28 €).
Die größte Kostendifferenz zwischen den Gruppen besitzen die Arzneimittelkosten, mit einem Unterschied von 1.545,12 €. Der Kostenunterschied dieser Kostenart hat einen Anteil von 50 % am Gesamtkostenunterschied von 3.015,37 €.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Deutschland annähernd 640.000 Personen eine Langzeittherapie mit Opiaten erhalten. Hiervon weist etwa jeder vierte Patient mindestens einen der beschriebenen Risikofaktoren auf.
Der häufigste Risikoindikator ist die Höhe der Opioid-Therapie. Vier von fünf Versicherten mit Risikoprofil weisen einen Risikofaktor, 14 % zwei von vier Risikofaktoren auf.
Die Altersverteilung ist zweigipflig, mit einer ersten Spitze bei den 60-Jährigen und dann noch einmal bei den über 75- bis 79-Jährigen.
Der Großteil der Versicherten mit einer Langzeit-Opioid-Therapie hat den Versicherungsstatus „Rentner“.
Verschiedene Arten von Schmerzen nehmen die Top 3 der spezifischen Komorbiditäten der Versicherten mit Risikoprofil ein, darunter Schmerz andernorts nicht klassifiziert, Rückenschmerzen und sonstiger chronischer Schmerz.
Der wichtigste Verordner ist der Hausarzt.
Versicherte mit einem Risikoprofil haben im Vergleich doppelt so viele AU-Tage im Jahr 2014, erhalten durchschnittlich 30 Tage länger Krankengeld und verursachen Arzneimittelkosten, die ca. 1.500 € über der Vergleichsgruppe liegen.
Die vorliegende Auswertung der GKV-Daten von 2014 ist repräsentativ für alle GKV-Versicherten in Deutschland. Die Daten bestätigen, dass sich die Situation hierzulande sehr viel besser darstellt als anderenorts, insbesondere den angelsächsischen Ländern.
Teil 2: Kontrollierter Entzug als Baustein der Therapieoptimierung
Beim kontrollierten Entzug als Baustein der Therapieoptimierung stellt sich zunächst die Frage nach der genauen Indikation:
- Kann und darf man bei Patienten, die sogar unter Opioiden noch Schmerzen haben, diese Therapie absetzen?
- Welche Prognose hat eine solche Entzugsbehandlung?
- Wie wird der Entzug in der klinischen Praxis vollzogen und welche Gefahren bzw. Konsequenzen leiten sich daraus ab?
Ursachen von Schmerzen unter einer Opioid-Therapie
Schmerzen unter einer Opioid-Therapie können verschiedene Ursachen haben. Ein in der Praxis zu beobachtendes Phänomen ist, dass Patienten unter Opioid-Gabe im Verlauf von 2–5 Jahren, selten schneller, eine Überempfindlichkeit entwickeln können, die sich klinisch als sogenannter Widespread Pain manifestiert. Man spricht in diesem Zusammenhang von Opioid-induzierter Hyperalgesie (OiH). Wenn also ein Patient trotz Opioid-Therapie keine Besserung seiner Schmerzen verspürt und dann die Dosis steigert, entwickelt sich ein neuer Schmerz, auch jenseits des vorbestehenden Schmerzareals.
Die Hyperalgesie kann mit einer Opioid-induzierten Toleranz einhergehen. Charakteristisch für die Toleranz ist eine allmählich beginnende Wirkabnahme ohne Dosissteigerung.
Die Lokalisation des Schmerzes ändert sich nicht.
Beide Phänomene treten häufiger bei einer höheren Dosierung, z. B. über 100 mg Morphinäquivalenz, und längerer Behandlungsdauer auf.
Schließlich gibt es eine verschwindend kleine Gruppe von Patienten, die die Schmerztherapie als Einstieg in eine Suchtkarriere genutzt haben. Am Klinikum Bochum schätzt man deren Anteil auf unter 5 % der dort behandelten Entzugspatienten.
Abbildung 1 klassifiziert unterschiedliche Leitsymptome einer Fehlentwicklung bei der Langzeittherapie mit Opioiden.7
Im blauen Kreis werden Hinweise auf psychotrope Nebenwirkungen zusammengefasst, die meistens auf Therapiefehlern beruhen, wie etwa eine zunehmende Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, eine Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit; alles Hinweise auf relative Unverträglichkeit. Ursächlich ist hier nicht die Opiat-Auswahl per se.
Eine weitere Gruppe, hier grün dargestellt, die sich mit der blauen Gruppe überlappt, beschreibt die
bereits genannten Hinweise auf eine Hyperalgesie. In der Praxis zeigt sich dieses Leitsymptom als Zustand, bei dem alle Therapiemaßnahmen einschließlich der Psychotherapie weitgehen wirkungslos werden.
Hinweise auf Fehlgebrauch entsprechend dem ICD 11.1 werden im orangefarbenen Kreis dargestellt.
Die rote Gruppe beschreibt Patienten mit eindeutigen Hinweisen auf eine Suchterkrankung. Hier steht die Fokussierung des Denkens und des Handels auf die Beschaffung im Vordergrund, gleichgültig ob legal oder
illegal.
Die vorliegende Klassifizierung erlaubt einen differenzierten Umgang mit den entsprechenden Patientengruppen. Nicht bei jedem Patienten ist eine Entzugsbehandlung indiziert.
Wichtig ist es zu erkennen, in welcher Gruppe sich ein Patient befindet und welche Gefahr für ihn besteht, in die orange oder rote Gruppe abzurutschen.
Die Downhill-Spirale
Wie behandelt man einen Patienten, der sich bereits in der sogenannten Downhill-Spirale befindet? Charakteristisch für diese Patienten ist eine Vielzahl psychotroper Nebenwirkungen oder Folgen der Überdosierung, zunehmende oder transformierte Schmerzen, eine Druckhyperalgesie, die sich bereits zur Unberührbarkeit entwickelt hat. Diesen Patienten stehen Ärzte mitunter hilflos gegenüber.
Die Abbildung 2 zeigt einen Entscheidungsbaum mit zwei Handlungsoptionen für Patienten, die sich in einer Downhill-Spirale befinden. Dabei wird unterschieden zwischen Patienten mit hohem Risikopotenzial und solchen ohne.7
Bei Patienten mit hohem Risikopotenzial ist das primäre therapeutische Ziel der komplette Entzug. Sofern weiterhin Bedarf an einer Schmerztherapie besteht, sollte diese zunächst ohne Opioide optimiert und der Verlauf engmaschig kontrolliert werden. Ist dieses nicht möglich, ist es auch am Klinikum Bochum üblich, Patienten auf ein niedrigdosiertes Opioid einzustellen, beispielsweise Buprenorphin, aber auch andere Substanzen. Ziel bleibt eine 80%ige Dosisreduktion.
Patienten mit wenigen Risikofaktoren stellen die größere Gruppe dar. Hier wird das Therapieziel zu Behandlungsbeginn nicht immer festgelegt. Vorrangiges Ziel ist es, mit so wenigen Opiaten wie möglich auszukommen, idealerweise sogar ganz ohne selbige. Die weitere Prozedur verläuft dann analog.
Dass dieses Vorgehen erfolgreich ist, zeigt eine im Jahr 2013 publizierte Studie der Forschungsgruppe von Prof. Maier am Klinikum Bochum. Die Arbeit beschreibt 106 konsekutive Patienten. Nur in vier Fällen haben die Patienten den Entzug aufgrund von Nebenwirkungen abgebrochen.
102 Patienten wurden in das Protokoll aufgenommen. Hiervon haben 78 Teilnehmer komplett entzogen. 24 Patienten haben sich gemäß dem oben beschriebenen Entscheidungsbaum zu einer 80%igen Dosisreduktion entschlossen.8
In einem Follow-up nach einem Jahr und nach zwei Jahren haben etwa 60 % diese Entscheidung genauso beibehalten, 40 % haben die Dosis wieder gesteigert oder neu angefangen.
Die Hälfte dieser 40 % ist jedoch nicht als Rückfälle zu werten, da hier der erneute Einsatz von Opiaten eine
therapeutische Entscheidung darstellte.
Dennoch müssen 20 % als Misserfolg gewertet werden. Vergleicht man diesen Wert jedoch mit den Erfahrungen aus dem kontrollieren Heroinentzug mit gerade einmal 10 % Langzeiterfolg, dann zeigt sich, dass der Entzug auch bei durchaus problematischen Patienten eine exzellente Prognose hat.
Welche Gründe führten zur Entzugsbehandlung? Etwa 32 % der Patienten befanden sich in der Downhill-Spirale mit Dosiseskalation. Ca. 25 % zeigten Hinweise auf Fehlgebrauch. Bei weiteren 25 % hatten die Opiate nie gewirkt und bei 20 % waren Nebenwirkungen der Hauptgrund, überwiegend kognitive Einschränkungen, Libidoverlust, hormonelle Störungen, selten Obstipation.
Stationäre Entzugsbehandlung in der Schmerzklinik Bochum
Am Klinikum Bergmannsheil liegen mittlerweile gut dokumentierte Erfahrungen aus über 700 Entzugsbehandlungen vor. In dieser Zeit gab es lediglich 30 Fälle mit vorzeitigem
Abbruch.
Das Kollektiv enthält auch solche Fälle, in denen Patienten extrem hohe Opiat-Dosen über einen längeren
Zeitraum eingenommen haben, wie die mitgebrachten „Medikamententaschen“ belegen.
Die Liste der eingenommenen Arzneimittel ist ein Spiegel der hierzulande meistverordneten Opioide einschließlich Tapentadol.
Die Abbildung 3 zeigt, welche Opioide in welcher Dosierung entzogen wurden. Zum besseren Vergleich wurden Morphinäquivalenzdosen gebildet. Etwa die Hälfte der Patienten war vor dem Entzug unterhalb der 100-mg-Marke, die heute üblicherweise als Startdosis einer Entzugsbehandlung eingesetzt wird.
Anders ausgedrückt: Es ist nicht nur die Hochdosisgruppe, die entzogen werden will. Die Streuung reicht im Einzelfall von einer Tagesdosierung von umgerechnet 2,4 g bis zu 5 g Morphin.
Es sind zwei Kollektive zu beobachten, die sich auf alle Medikamente, die bis 2014 üblich in Deutschland waren, verteilen.
Management der kontrollierten Entzugsbehandlung
Wie erfolgt der Entzug in der klinischen Praxis? Das wichtigste Erfolgskriterium ist eine gute Vorbereitung und die Nachbehandlung. Vorbereitung bedeutet, dass die Indikation gesichert werden muss, warum der Patient entziehen will.
Es reicht nicht aus, wenn lediglich der Hausarzt der Meinung ist. Und es reicht ebenfalls nicht aus, wenn die Ehefrau das möchte. Es muss eine intrinsische Motivation geben. Die Entzugsbehandlung fordert dem Patienten einiges ab. Wer diese Motivation nicht aufweist, wird vorläufig nicht entzogen.
Aus diesem Grund nehmen am Klinikum Bochum immer ein Psychologe und ein Arzt am Eingangsgespräch teil. Außerdem erfolgt grundsätzlich ein Drug Monitoring, im Einzelfall sogar mehrfach. Das Einverständnis hierzu erteilt der Patient schriftlich in einem Behandlungsvertrag. Zusätzlich nimmt der Patient an einem dreistufigen Edukationsprogramm teil.
Im Motivationsgespräch erfolgt diese Unterweisung zunächst mündlich. Im Vertrag wird alles noch einmal schriftlich festgehalten. Die Patienten müssen diesen ausnahmslos zu Hause durchlesen und unterschreiben.
Durch ihre Unterschrift stimmen die Patienten unangekündigten Blutkontrollen und der Einsichtnahme in ihre Kulturtaschen zu. Dieses harte Vorgehen ist unbedingt notwendig und vergleichbar mit Maßnahmen aus der Suchtmedizin.
Verstößt der Patient gegen die Vereinbarungen, erhält er zunächst eine gelbe Karte. Gelb-rot bedeutet dann einen sofortigen Therapieabbruch. Eine Wiederaufnahme nach Ablauf einer vier Wochen Frist ist jedoch möglich.
Ziele des Entzugs
Im Rahmen des Motivationsgesprächs werden dem Patienten beide Behandlungspfade gleichwertig kommuniziert: kompletter Entzug oder signifikante Dosisreduktion.
Wenn der Schmerz unter dem Entzug jedoch nicht abfällt oder sogar ansteigt, trotz intermittierender Therapie, wenn eine Escape-Medikation nicht wirkt, die psychologische Intervention auch nicht, oder ein Patient unbedingt wieder möchte, dann wird ein anderes Opiat in Erwägung gezogen, jedoch nicht vor Ablauf der ersten Behandlungswoche.
Am Klinikum Bochum entscheiden sich 89 % der Patienten zu einem Totalentzug, 11 % präferieren einen 80-%-Entzug.
Der eigentliche Entzug erfolgt seit 2015 nach dem folgenden, neuen Regime: jeder Patient beginnt mit einer Initialdosis von 100 mg Morphin, unabhängig davon, welches Opiat er vorher eingenommen hat. Einzige Ausnahmen: Patienten, die vorher bereits eine geringere Äquivalenzdosis genommen haben oder Patienten mit einer Morphinäquivalenz über 1 g.
In den ersten Tagen wird die Dosis sehr schnell reduziert, gegen Ende der Behandlung dann deutlich langsamer. Die eigentlichen Symptome treten in den ersten zwei Tagen und in den letzten zwei Tagen auf.
Im Rahmen des Entzugsmanagements erhält jeder Patient eine Begleitkarte. Bewährt hat sich die initiale Komedikation mit Clonidin. Mit Dosierungen zwischen 175 und 300 mg pro Tag können 80–90 % der Patienten gut abgedeckt werden. Sobald kardiovaskuläre Reaktionen auftreten, sollte die Dosis gesteigert werden. Zur Vermeidung von Entzugssymptomen sollte die Clonidin-Behandlung noch mindestens 14 Tage nach Entlassung fortgesetzt werden.
Andere Bedarfsmedikationen können situativ verabreicht werden.
Es kommt immer wieder vor, dass Patienten Angst vor einem „qualvollen Entzug“ haben. Es ist ein beliebter Mythos von Süchtigen, dass der Entzug „die Hölle“ ist. Unter dem dargestellten Entzugsmanagement gibt es in der Praxis, insbesondere bei Schmerzpatienten, keinerlei Probleme.
Die Auswertung von SOWS-Fragebögen veranschaulicht dies noch einmal. Die gelben Balken in der Abbildung 4 bedeuten Erster Tag, weiß heißt Zweiter Tag und so weiter. Die am häufigsten beschriebenen
Symptome sind Schlafprobleme, unruhige Beine, Muskelschmerz und sich insgesamt schlecht fühlen. Alle diese Symptome lassen aber schon nach wenigen Tagen deutlich nach.
Bedrohliche Risiken
Eine Entzugsbehandlung ist durchaus mit einigen, auch bedrohlichen, Risiken verbunden:
- Herzversagen, Herzinsuffizienz
- Angina pectoris, Herzinfarkt
- Epileptische Anfälle
- Hypothalmische Störung (Diabetes insipidus)
- Delir
- Atemdepression
Es ist wichtig, sich nicht auf den Anfangserfolgen auszuruhen. Die Therapie muss ambulant weitergeführt werden.
Abbildung 5 zeigt die Beweglichkeit des Rückens eines Patienten nach
Opiat-Entzug: Rot bedeutet „extrem eingeschränkt“, grau heißt „eben
grade so“, grün bedeutet „im Normbereich“.
Nach vier Monaten multimodaler Therapie war dieser Patient wieder im Alltag angekommen. Einem Opiat-Entzug muss immer auch eine Schmerztherapie folgen.
Teil 3: Substitutionstherapie bei behandlungsbedürftiger
Opioid-Schmerzmittel-Abhängigkeit
Opioide sind aus der Schmerztherapie nicht mehr wegzudenken. Ihr Einsatz geht allerdings auch mit einem Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial einher. Während bei korrekter Indikationsstellung und Anwendung retardierter Opioide dieses Risiko sehr gering ist, begünstigen Opioide mit schnellem Wirkeintritt und kurz wirksame Darreichungsformen die Entwicklung einer Abhängigkeit. Der differenzierte Einsatz von Opioiden zur Prävention der behandlungsinduzierten Opioid-Abhängigkeit ist daher von entschei¬dender Bedeutung.
Das wichtigste Ziel einer angemessen und verantwortungsvoll durchgeführten Therapie mit Opioid-Analgetika ist das Erreichen der „4 S“:
- Schmerzlinderung
- Sicherheit der Therapie
- Soziale Teilhabe
- Substanzproblematik vermeiden
Psychiatrische Konsultation bei Opioid-Langzeittherapie
In der Schmerzklinik am Klinikum Klagenfurt werden jedes Jahr 3.000 Patienten erstmals behandelt. Insgesamt finden 40.000 Patientenkontakte statt. In Zusammenarbeit mit der österreichischen Schmerzgesellschaft und dem Suchtexperten Prof. Lesch wurde ein Positionspapier zum Einsatz von Opioiden bei tumor- und nicht tumorbedingten Schmerzen erarbeitet.9
Wird beim Erstgespräch mindestens eines der vier nachfolgenden Symptome diagnostiziert, sollte der Patient weiter psychologisch oder psychiatrisch evaluiert werden:
- psychiatrische Komorbidität
- regelmäßiger Drogenkonsum
- Heavy Smoking Index >4
- CAGE-Fragebogen >2
Dieser Algorithmus findet sowohl bei Neueinstellungen als auch bei einer länger als drei Monate andauernden Opioid-Therapie Anwendung.
Evaluation der Abhängigkeitsgefahr
Abbildung 6 zeigt den Fragebogen zur Einschätzung der Abhängigkeitsgefahr, wie er am Klinikum Klagenfurt regelmäßig eingesetzt wird. Im ersten Teil wird nach der Nikotinabhängigkeit gefragt, es folgen die Fragen zum Alkoholkonsum – also der CAGE-Teil. Weiterhin wird die psychiatrische Vorgeschichte der Patienten erfasst und schließlich die Einstellung der Patienten zu Medikamenten eruiert.9
Bei starken Hinweisen auf das Bestehen einer Abhängigkeitsproblematik sollte das Gespräch mit dem betroffenen Patienten gesucht werden. Wesentlich ist hierbei eine Zusammenarbeit
mit Schmerz- und Suchtspezialisten.
Für das Erstgespräch zu diesem Thema hat sich die BRENDA-Methode bewährt.10 Diese beinhaltet die folgenden Ebenen:
- die biopsychosoziale Auswertung,
- den Report, Bericht für den Patienten,
- die Empathie,
- die Auswertung der Bedürfnisse,
- den direkten Rat und
- die Auswertung der Reaktion.
Hinweise auf eine Substanzproblematik
Im Klinikalltag können folgende Verhaltensweisen oder Anzeichen auf eine Substanzproblematik hinweisen:
- Patienten beziehen Opioid-Analgetika von mehreren Verordnern,
- häufige Visiten in Notfallambulanzen,
- Notfalltermine und telefonische Kontaktaufnahme, vorgezogene Termine,
- häufige und nicht abgesprochene Dosiseskalation und Widerstand wenn Dosis reduziert werden soll,
- frühzeitige Rezeptforderung, angebliche Rezeptverluste,
- Patienten beharren auf Opiat-Therapie und lehnen andere Therapieoptionen ab.
Beendigung der Opiat-Therapie
Die Therapie chronischer nicht tumorbedingter Schmerzen mit Opioid-Analgetika sollte ausgeleitet werden bei:
- Erreichen des Therapiezieles durch andere medizinische Maßnahmen,
- Unwirksamkeit der Therapie,
- starker Toleranzentwicklung,
- Opioid-induzierter Hyperalgesie,
- Hinweisen auf eine Substanzproblematik oder
- Abhängigkeitssymptomen.
Behandlungsziele
Die Behandlung der Abhängigkeit sollte durch Suchtspezialisten erfolgen, die abwägen, welche Therapiestrategie im individuellen Fall angezeigt ist. Diese orientiert sich an der Schmerzdiagnostik und an der Art der Abhängigkeit.
Primäres Ziel der Therapie der Abhängigkeit ist nicht notwendigerweise die Abstinenz, sondern die Verbesserung des psychosozialen Funktionsniveaus.11,12,13
Buprenorphin/Naloxon
Die Behandlung der Opioid-Schmerzmittel-Abhängigkeit kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Im zweiten
Teil dieser Fortbildung haben Sie bereits das Konzept der Entgiftung kennen gelernt. Eine weitere Therapieoption stellt die Opioid-Substitutionstherapie dar. Hierzu gibt es neuere Erfahrungen mit einer Fixkombination Buprenorphin/Naloxon.
Buprenorphin wird seit etwa 20 Jahren zur Behandlung der Opioid-Abhängigkeit eingesetzt. Bei der Substanz handelt es sich um einen partiellen Opioid-Agonisten mit hoher Affinität und niedriger intrinsischer Aktivität am µ-Opioid-Rezeptor. Buprenorphin wirkt zusätzlich auf dem Natriumkanal.
Die langsame, reversible Bindung an die µ-Opioid-Rezeptoren minimiert das Bedürfnis des abhängigen Patienten nach Opioiden über einen längeren Zeitraum.
Der partialagonistische Effekt von Buprenorphin bedeutet u. a., dass die agonistische Wirkung von Buprenorphin auf den µ-Rezeptor (klinisch erkennbar z. B. an der potenziell vitalbedrohlichen Nebenwirkung Atemdepression) nicht linear ansteigt.
Naloxon ist ein Opioid-Antagonist. Die Substanz wird nur bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Fixkombination wirksam (z. B. bei intravenöser oder nasaler Einnahme). Dadurch verbessert sich das Sicherheitsprofil der Medikation wesentlich, indem es u.a. die Weitergabe und den Missbrauch erschwert.
Die klinische Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von Buprenorphin/ Naloxon ist durch zahlreiche Studien belegt.
Die Fixkombination wird in einer Zusammensetzung von 4:1 verabreicht.
Buprenorphin in der Substitution
Abbildung 7 veranschaulicht noch einmal die klinische Wirkung von Buprenorphin in der Substitution.14
- Keine tödliche Atemdepression
- Keine Sedierung
- Keine Dysphorie
Dieses spezielle pharmakologische Profil von Buprenorphin hat dazu geführt, dass die Substanz in einigen Ländern als First-choice-Medikation gilt. Vor allem in Skandinavien, aber auch in der australischen Leitlinie wird empfohlen, in der Substitution zunächst Buprenorphin zu verwenden.
Die Behandlung mit Buprenorphin sollte erst dann begonnen werden, wenn der Patient bereits Entzugserscheinungen hat. Dies wird durch eine Opioid-Pause erreicht. Die Behandlungsunterbrechung vor Therapiebeginn ist notwendig, damit möglichst viele Rezeptoren frei sind. Anderenfalls würden die Patienten Entzug verspüren, wenn die Opiat-Rezeptoren durch einen Vollagonisten belegt sind und letzterer vom Partialagonisten Buprenorphin verdrängt wird.15,16
Wenn der Rezeptor hingegen leer ist, verspürt der Patient eine deutliche Besserung, sobald der Partialagonist andockt. Je schlechter es dem Patienten zunächst geht, umso besser verläuft die Einstellung.
In der Einstellungsphase werden zunächst 2–4 mg Buprenorphin verabreicht und dann innerhalb von 24 Stunden auf bis zu 8 mg aufdosiert, je nach klinischem Bild des Patienten.
Die meisten Schmerzmittelabhängigen benötigen eine Zieldosis von 16 mg. Diese wird i.d.R. am zweiten Tag erreicht.
Die Kombinationstherapie mit Buprenorphin/Naloxon stellt eine neue Therapieoption bei Patienten mit Opioid-Schmerzmittel-Abhängigkeit dar. Vorteile der Medikation sind:
- Weniger körperliche Abhängigkeiten als unter Opioid-Vollagonisten
- Hohe Vigilanz und Alltagstauglichkeit
- Hohe Dosierbarkeit – mit großer therapeutischer Breite
- i.d.R. keine kardialen Komplikationen
- i.d.R. keine Atemdepressionen
- Bei ausreichender Dosierung (16 mg) werden die µ-Rezeptoren zu bis zu 95 % belegt. Dadurch keine zusätzliche Wirkung bei Einnahme weiterer Opioide.
- Antidepressive Wirkung wurde beschrieben
- Gute Nierenverträglichkeit von Buprenorphin
- Buprenorphin ist aufgrund der analgetischen Wirkung bereits in der Schmerztherapie bekannt
Fallbericht
Wir stellen Ihnen nun einen Fall aus der Schmerzambulanz des Klinikums Klagenfurt vor. Dort stellte sich im Dezember 2014 ein Patient, männlich, geboren 1961, vor.
Zur Vorgeschichte:
Der Patient hatte im November 2011 aufgrund einer posttraumatischen Gonarthrose eine Knietotalendoprothese rechts erhalten. Der Patient wurde anschließend mit folgender Medikation entlassen:
- Alprazolam
- Pantoprazol
- Hydromorphon sowie
- Hydromorphonkapseln für Durchbruchschmerzen
Was war in der Zwischenzeit passiert? Der Patient litt zusätzlich an einer Discusprotrusion im Bereich der LWS L5/S1. Er war bei niedergelassenen Ärzten in Behandlung und dort auf Oxycodon retard 45 mg eingestellt worden. Er erhielt weiterhin das Benzodiazepin und Pregabalin.
Aus der Vorgeschichte ist bekannt, dass er nach der Scheidung von seiner Ehefrau einen chronischen OH-Abusus hatte. Der Alkoholentzug war erfolgreich. Aus dieser Zeit rührt jedoch noch ein Benzodiazepinabusus mit 3 x 1 mg Alprazolam oral.
Die Schmerzen sind zurückzuführen auf die generalisierte Arthrose nach der Operation. Im Laufe der Zeit kam es zur exzessiven Steigerung von Oxycodon. Der Patient nahm nach eigenen Angaben inzwischen täglich 6 x 80 mg Oxycodon und 2 x 75 mg Pregabalin ein.
Der Patient wurde schließlich für eine Dauer von 5 Tagen stationär aufgenommen. Da das Klinikum keine eigene Station zur Opiat-Rotation und Schmerzmitteleinstellung betreibt, werden die Patienten hilfsweise auf der Palliativstation versorgt.
Die Diagnose bei Aufnahme lautete: chronisch-neuropathische Schmerzen nach Knie-TEP, Discusprotrusion, Tranquilizer- und Opioid-Abusus, zur Opioid-Rotation.
Der Patient wurde erfolgreich umgestellt auf die Fixkombination Buprenorphin/Naloxon.
Vorgehen bei der Umstellung
Am Vorabend der Umstellung erhielt der Patient noch ein letztes Mal Oxycodon. Am nächsten Tag wurde dann gegen Mittag die Behandlung mit Buprenorphin/Naloxon begonnen. Hierbei wurden in den ersten 24 Stunden 3 x 2 mg verabreicht. Zudem wurde der Patient am ersten Tag der Umstellung intensiv überwacht.
Es traten keine schweren Komplikationen infolge der Umstellung auf. Im Bedarfsfall konnte dem Patienten zusätzlich Chlonidin gegeben werden.
Der Schmerz bei der Entlassung war VAS 4. Als Entlassungsmedikation erhielt der Patient Buprenorphin/Nalaxon 8 mg sublinugal 1 x täglich. Die Begleitmedikation mit Pregabalin und Benzodiazepin wurde beibehalten. Zusätzlich wurde Quetiapin zum Schlafen verordnet.
Ein Jahr nach der Umstellung soll die Dosis auf 4 mg reduziert werden.