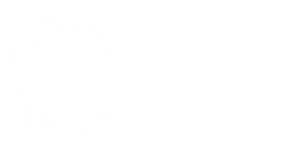Management der spastischen Bewegungsstörung der unteren Extremität
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
- die Definition und Pathophysiologie der spastischen Bewegungsstörung (SMD),
- die Prinzipien der topografischen Klassifikation der SMD und deren Relevanz für die Therapieplanung,
- die evidenzbasierte Rolle von Botulinumtoxin Typ A bei SMD der unteren Extremität,
- den Stellenwert technischer Injektionshilfen und multimodaler Begleittherapien zur Steigerung der Therapieeffektivität.
Einleitung
Die spastische Bewegungsstörung („spastic movement disorder”, SMD) tritt als Folge unterschiedlicher neurologischer Grunderkrankungen mit Schädigung des sensomotorischen zentralen Nervensystems (ZNS) auf. Besonders häufig ist sie im Rahmen der postakuten Versorgung nach Schlaganfall zu beobachten. In der klinischen Praxis zeigt sich, dass >20 % der Schlaganfallbetroffenen bereits in den ersten Wochen nach dem Ereignis eine geschwindigkeitsabhängige Zunahme des Muskeltonus entwickeln im Sinne einer Spastizität sensu stricto, der sogenannten Spastizität definiert nach Lance. Die SMD stellt eine typische Komplikation einer Läsion des oberen Motoneurons („upper motor neuron syndrome”, UMNS) dar. Nach Schädigung des zentralen sensomotorischen Nervensystems manifestiert sich typischerweise zunächst eine schlaffe Lähmung mit Immobilität. In der Folge treten zunehmend sogenannte Plusphänomene auf, die durch eine pathologische Muskelaktivität gekennzeichnet sind. Zu diesen zählen unter anderem gesteigerte Muskeleigenreflexe, Kloni, eine geschwindigkeitsabhängige Tonuserhöhung sowie die spastische Dystonie. SMD kann sich in spastischen Haltungs- und Bewegungsmustern sowie in einer erhöhten Steifigkeit in den betroffenen Gelenken und Körperabschnitten äußern. Im Verlauf kann es zur Entwicklung fixierter Kontrakturen kommen. Diese gehen mit bindegewebigen Umbauvorgängen im Muskel- und Weichteilgewebe einher, die schnell irreversibel werden. Mit der Zunahme der Schlaganfallinzidenz infolge des demografischen Wandels nimmt auch die Inzidenz der SMD zu. Die Lebenszeitprävalenz des Schlaganfalles liegt bei etwa 3 % und nimmt mit steigendem Lebensalter deutlich zu. In der Altersgruppe >70 Jahre ist nahezu jede zehnte Person betroffen. Für Deutschland wird eine jährliche absolute Inzidenz von >250.000 Schlaganfällen angenommen, bis zu 13 % der Betroffenen entwickeln eine SMD mit behandlungsbedürftiger funktioneller Beeinträchtigung.
Pathophysiologie
Die SMD tritt infolge von ZNS-Läsionen auf, insbesondere bei Beteiligung sensomotorischer kortikospinaler Zell- und Leitungsbahnen. Im aktuellen Begriffsverständnis umfasst der Terminus SMD ausschließlich die sogenannten Plusphänomene des Pyramidenbahnsyndroms, die unter UMNS fallen. Die dabei auftretenden muskulären Veränderungen werden unter dem Begriff der spastischen Myopathie zusammengefasst. Bereits in der ersten Woche nach einer Immobilisation lassen sich bei >20 % der Patienten Veränderungen der spinalen und supraspinalen sensomotorischen Regulation im Sinne einer Spastizität sensu striktu nachweisen. Die gestörte sensomotorische Regulation führt also zu einer pathologischen Überaktivität der Dehnungsreflexe. Grundsätzlich sind sogenannte phasische und tonische Komponenten zu unterschieden. Typische klinische Phänomene sind als phasische Phänomene gesteigerte Muskeleigenreflexe und Kloni und als tonische Komponenten die unwillkürliche Kokontraktion und die spastische Dystonie einzuordnen. Es wird als wesentlicher pathophysiologischer Mechanismus der SMD angenommen, dass z. B. bei ausgedehnten subkortikalen Schädigungen im Versorgungsgebiet der medialen zerebralen Hirnarterie (MCA, Arteria cerebri media) sowohl kortikospinale (Pyramidentrakt) als auch kortikoretikulospinale Bahnsysteme betroffen sind und es daher durch eine Reduktion inhibitorischer kortikaler Einflüsse über das dorsale retikulospinale Bahnsystems auf die kontralateralen spinalen Regelkreise zu schwerer SMD kontralateral kommen kann. Dies wird noch verstärkt, da zusätzlich exzitatorische Projektionen aus der anderen, ipsilateral zur Lähmung liegenden Hirnhälfte Überhand nehmen und Einfluss über den medialen retikulospinalen und den vestibulospinalen Trakt auf die betroffenen spinalen Regelkreise ausüben. Dies führt in der Konsequenz zu einem Ungleichgewicht in der Steuerung des spinalen Netzwerkes und der Alpha-Motoneurone und wird als kombinierter pathophysiologischer Mechanismus angenommen, der häufig zu einer schweren behindernden kontralateral zur Schädigung liegenden SMD führt. Diese Verschiebung der Erregungsbalance zugunsten exzitatorischer Bahnsysteme äußert sich klinisch, z. B. mit variabler Latenz zum auslösenden MCA-Infarkt, in den bekannten spastischen Bewegungsmustern kontralateral. Neben den zentralnervösen Aspekten sind strukturelle Veränderungen der betroffenen Muskulatur von Bedeutung. Insbesondere die extrazelluläre Matrix („extracellular matrix”, ECM), einschließlich Perimysium und Faszien, erfährt Umbauprozesse, die die Gleitfähigkeit von Muskelfasern und die Kraftübertragung beeinträchtigen. Als Folge treten eine Verdichtung der ECM, verkürzte Muskelfasern sowie eine muskuläre Degeneration auf, die für die spastische Myopathie charakteristisch sind. Tierexperimentelle Daten belegen, dass Immobilisation jedweder Ursache schnell zu degenerativen histologischen Veränderungen und bindegewebigem Umbau im Muskelgewebe führt. Hierbei spielt die Hyaluronsäure in der ECM eine wichtige Rolle. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass eine gestörte Balance zwischen Produktion und Abbau von Hyaluronsäure wesentlich schneller zur Entwicklung einer Muskelsteifigkeit und im chronischen Verlauf zu einer Muskelfibrose beiträgt. Eine fortgeschrittene Muskelfibrose ist meist nicht mehr vollständig reversibel. Häufig entwickelt sich ein Teufelskreis aus zunehmender Immobilität und Kontrakturen, die sich wechselseitig verstärken. Dieser pathophysiologischen Spirale kann jedoch durch eine frühzeitige und gezielte Mobilisation effektiv entgegengewirkt werden. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung früher Interventionen bei ZNS-Läsionen mit hohem Risiko für SMD. Es wird angenommen, dass frühzeitige und gezielte Therapiemaßnahmen dadurch eine Invalidität verhindern und die Lebensqualität erhalten können. Eine verzögerte Diagnosestellung und ein verspäteter Therapiebeginn hingegen verschlechtern die Prognose.
SMD und Schmerz
Schmerzen sind eine häufige und besonders belastende Folge der SMD. In der aktuellen nosologischen Einordnung wird Schmerz nicht als direktes SMD-Symptom, sondern als Folgekomplikation gewertet. Kohortenstudien zeigen, dass etwa 75 % der Patienten mit anhaltender SMD nach Schlaganfall über Schmerzen klagen. Etwa 10 % der Betroffenen berichten über eine hohe Schmerzintensität (numerische Rating-Skala [NRS] ≥8). Die Schmerzen sind häufig sowohl im Bereich der oberen als auch der unteren Extremität vorhanden und wirken sich deutlich negativ auf Alltagsfunktion und Lebensqualität aus. Für viele Patienten mit SMD ist daher die Schmerzlinderung ein wichtiges Ziel im Rahmen der partizipativen Behandlungsplanung.
Therapieansatz
Die Behandlung von SMD ist eine komplexe interdisziplinäre Herausforderung. Nach der S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) soll die Behandlung unter ärztlicher Aufsicht und durch speziell geschultes Fachpersonal erfolgen. Dabei kommt es auf einen multiprofessionellen, multimodalen Ansatz in einem interdisziplinären Team an. Der Schweregrad der SMD zeigt eine große interindividuelle Variabilität. Das Spektrum reicht von milden Tonuserhöhungen ohne relevante funktionelle Beeinträchtigung bis hin zu ausgeprägten motorischen Defiziten mit vollständiger Immobilität. Der Nachweis einer Spastizität allein indiziert noch nicht notwendigerweise eine spezielle Behandlung. Für die Indikationsstellung ist die funktionelle Relevanz entscheidend. In manchen Fällen, etwa bei SMD der Kniestrecker, kann die spastische Muskelsteifigkeit sogar helfen, andere Funktionsdefizite zu kompensieren und die Standsicherheit, z. B. beim Transfer, zu verbessern. Vor Einleitung aller therapeutischen Maßnahmen muss daher kritisch geprüft werden, ob diese sinnvollen und erreichbaren funktionellen Zielen dienen. Dazu können u. a. Verbesserung der Mobilität, Schmerzlinderung, Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Erleichterung der Pflege gehören. Die Therapieentscheidung basiert stets auf einer individuellen und partizipativen Zieldefinition, bei der Patienten und gegebenenfalls pflegende Angehörige mit einbezogen werden sollen. Bereits in der Frühphase des Behandlungsprozesses ist eine strukturierte Aufklärung über mögliche Verläufe und langfristige Folgen der SMD essenziell. Die Behandlung ist in diesem Zusammenhang im Sinne eines umfassenden, personenzentrierten Ansatzes zu gestalten. Für Indikationsstellung und Therapieplanung können standardisierte Instrumente herangezogen werden. Ein in diesem Zusammenhang bewährtes Instrument ist die „Disability Assessment Scale” (DAS), die die vier relevanten Domänen der passiven Funktionen erfasst: Einschränkung der passiven Beweglichkeit, Selbstversorgungsfähigkeit (z. B. Ankleiden), Schmerzen sowie kosmetisch-ästhetische Auswirkungen der SMD. Hinsichtlich ihrer anatomischen Verteilung kann die SMD in fokale, multifokale, segmentale, multisegmentale, und generalisierte Formen unterteilt werden. Mehr deskriptive Beschreibungen, wie hemispastisch, para- und tetraspastische SMD, haben im klinischen Alltag weiter ihre Berechtigung, finden sich aber in der benannten Nomenklatur der anatomischen Formen wieder. Diese topografische Einordnung ist zentraler Bestandteil eines europäischen Konsensusdokumentes; sie dient der systematischen Zuordnung und ermöglicht eine Therapiezuordnung und -planung nach einheitlichem Standard. Insbesondere nach einem Schlaganfall sind häufig mehrere Körperregionen von SMD betroffen. Bei 65 % der Patienten ist die obere Extremität beeinträchtigt, bei 67 % ist die untere Extremität betroffen. Eine isolierte Beeinträchtigung nur einer Extremität ist vergleichsweise selten. Zur Behandlung der SMD stehen eine Vielzahl physikalischer, apparativer, physio- und ergotherapeutischer sowie pharmakologischer Verfahren zur Verfügung. Grundlage des therapeutischen Vorgehens bildet stets die physikalische, physio- und ergotherapeutische Intervention. Neben allgemeinen Maßnahmen wie Lagerung, Hilfsmittelversorgung und Training mit unterstützender Technik kommen auf lokaler Ebene Schienen, Orthesen sowie elektrophysikalische Verfahren (z. B. funktionelle Elektrostimulation, transkranielle Magnetstimulation) zum Einsatz. Funktionelle Elektrostimulation (FES) hat sich insbesondere zur Unterstützung der Gangfunktion (z. B. Gangzyklus-angepasste Fußheberstimulation) bewährt. Empfohlen wird von der Leitlinie auch der Einsatz von synergistisch wirkenden Verfahren in einem schrittweisen Modus um die wirksamen Verfahren integriert zum Einsatz zu bringen. Die Auswahl zusätzlicher Maßnahmen orientiert sich insbesondere an der Verteilung, der Lokalisation und den beteiligten Strukturen (neurogene oder nicht neurogene, muskuläre Beteiligung) der SMD. Zu den verfügbaren pharmakologischen und interventionellen Therapieoptionen zählen:
- Orale Antispastika (z. B. Baclofen, Tizanidin, Tolperison, Dantrolen)
- Lokale pharmakologische Maßnahmen (z. B. Injektionen mit Botulinumtoxin A)
- Intrathekale Therapieformen (z. B. intrathekale Baclofen-Therapie)
- Neuromodulative Verfahren (z. B. elektrische oder magnetische Stimulation)
- Chirurgische Interventionen (z. B. Fasziotomie, Tenotomie, Neurotomie)
Die AboLiSh-Studie
Design und Studienpopulation
Eine SMD der unteren Extremität („lower limb spasticity”, LLS) geht mit besonderen Herausforderungen einher. Bis zu 40 % aller Schlaganfallüberlebenden sind von einer LLS betroffen. Zu den schwersten Komplikationen der LLS gehören die Ausbildung eines spastischen Spitzfußes (Pes equinus) oder Klumpfußes (Pes equinovarus), die meist zu einer Reduktion oder sogar zum Verlust der Mobilität mit beschleunigter Beeinträchtigung des allgemeinen Gesundheitszustandes führen, zudem besteht eine erhöhte Sturzgefahr. Die Wirksamkeit und Sicherheit von BoNT-A in der Behandlung der LSS konnte auch für Abobotulinumtoxin A (AboBoNT-A) durch eine große randomisierte kontrollierte Studie (RCT) gut belegt werden. Solche RCT spiegeln jedoch nicht immer die komplexe Versorgungsrealität im klinischen Alltag wider. Sogenannte Beobachtungsstudien im realen Versorgungsalltag, wie die AboLiSh-Studie („Abo-BoNT-A injections for adult LLS in a reallife cohort”), stellen daher eine wichtige Ergänzung dar. In einem prospektiven, longitudinalen Design konnten über einen Zeitraum von 16 Monaten in 46 spezialisierten neurorehabilitativen Zentren aus neun Ländern (Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Russland und USA) solche wertvollen Daten gesammelt werden. Insgesamt wurden zwischen November 2019 und März 2021 430 Patienten eingeschlossen, von denen 416 mindestens eine AboBoNT-A-Injektion erhielten. Das Durchschnittsalter der Patientengruppe lag bei 53,9 Jahren, nur 44 % der Betroffenen waren weiblich. Es wurden nur erwachsene gehfähige Patienten (≥18 Jahre) mit einer einseitigen LLS (mindestens fünf Schritte mit oder ohne Gehhilfe gehfähig) in die Studie eingeschlossen. Zudem wurde gefordert, dass die Entscheidung zur Behandlung mit AboBoNT-A unabhängig von der Studienteilnahme und vor Einschluss in die Studie erfolgt ist. Von der Teilnahme ausgeschlossen waren Personen mit einer BoNT-A-Behandlung in den letzten zwölf Wochen, starken Bewegungseinschränkungen durch Kontrakturen („Modified Ashworth Scale” ≥4 in einem Gelenk der unteren Extremität), einem operativen Eingriff an den Extremitäten oder einer Baclofen-Pumpe in den letzten drei Monaten, einer bekannten fortschreitenden neurologischen Erkrankung oder Zerebralparese. Die Mehrzahl der eingeschlossenen Patienten wiesen erworbene Hirnläsionen auf, v. a. infolge von zerebralen Ischämien oder Blutungen sowie Traumata. Viele Betroffene zeigten ein sogenanntes Wernicke-Mann-Gangbild mit spastischem Klumpfuß mit Plantarflexion, Inversion und Zehenfehlstellungen. Die Patienten wiesen zahlreiche neurologische Beeinträchtigungen auf. Vor allem eine motorische Einschränkung war nahezu bei allen Patienten vorhanden. Die Zielerreichungsmessung mit der Goal Attainment Scaling (GAS) gilt als etabliertes, personenzentriertes Instrument zur Bewertung des Behandlungserfolges in der neurorehabilitativen Versorgung. Es eignet sich zur Bewertung funktioneller Veränderungen unter einer Behandlung der SMD mit BoNT-A. Speziell zur klinischen Beurteilung der LLS wurde ein neues, für die spastische Gangstörung entwickeltes Tool in der AboLiSh-Studie vorgestellt, das GAS-Leg-Tool. Dieses Tool berücksichtigt die Grundlagen der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der Weltgesundheitsorganisation World Health Organization (WHO) und soll der erleichterten Erarbeitung von Zielkategorien bei LLS dienen. Beim ersten Termin erarbeitete das Behandlungsteam gemeinsam mit den Patienten bis zu drei individuelle, alltagsrelevante Therapieziele auf Grundlage des GAS-Leg-Instrumentes. Dieses Instrument bewertet die Zielerreichung graduell auf einer fünfstufigen Skala von –2 bis +2. Jede teilnehmende Person musste ein vorrangiges Therapieziel definieren und konnte bis zu zwei zusätzliche Ziele benennen, die durch eine Behandlung der unteren Extremität mit AboBoNT-A potenziell beeinflussbar sein sollten. Alle Ziele mussten nach dem SMART-Prinzip (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert) formuliert werden. Vor Therapiebeginn wurde die Zielerreichung in der Regel mit –1 bewertet, es sei denn, es lag eine sehr schwere Beeinträchtigung durch die LLS vor, was mit –2 dokumentiert wurde. Eine Zielerreichung im vordefinierten Ausmaß wurde mit 0 bewertet, während +1 für eine bessere und +2 für eine deutlich bessere Zielerreichung als erwartet standen. Für die Auswertung lagen Daten von 384 Personen vor, die sowohl mindestens eine Injektion als auch mindestens eine GAS-Evaluation durchliefen.
Wesentliche Ergebnisse
Die umfangreichen Ergebnisse wurden in mehreren Teilpublikationen veröffentlicht. Eine der Auswertungen befasste sich speziell mit den Behandlungsparametern und -ergebnissen bei LLS. Die AboLiSh-Studie lieferte wichtige Daten zur Versorgungspraxis bei komplexen Patienten mit SMD/LLS durch Behandler, die über Expertise und eine große Erfahrung verfügen. Die Studie zeigte, dass in der Praxis zusätzlich zu den zugelassenen Zielmuskeln (v. a. Musculus gastrocnemius, Musculus soleus, Musculus tibialis posterior, Musculus flexor hallucis longus und Musculus flexor digitorum longus) auch bislang nicht zugelassene Muskeln behandelt wurden, insbesondere die ischiocrurale Muskulatur und der Musculus rectus femoris, die für die bessere Gangkontrolle bei spastisch versteiftem Kniegelenk (sogenanntes „stiff knee pattern”) entscheidend sind. Weiterhin lag in 85 % der Fälle zusätzlich eine SMD des Armes der gleichen Seite wie die LLS vor. Die mittlere Zeit zwischen dem auslösenden Ereignis und dem Therapiebeginn mit AboBoNT-A betrug in der AboLiSh-Studie 1,3 Jahre; 76 % der Patienten hatten bereits zuvor (Abstand >12 Wochen) eine BoNT-A-Therapie erhalten. Es erfolgten bis zu fünf Therapiezyklen. Das mittlere Injektionsintervall betrug 18,3 Wochen und lag somit deutlich über dem zugelassenen Intervall von mindestens zwölf Wochen. Pro Zyklus wurden im Mittel vier Muskeln der unteren Extremität behandelt, mit durchschnittlich 6,7 Injektionsstellen. Zu Behandlungsbeginn wurden im Median 600 Einheiten (im Mittel 665 Einheiten) AboBoNT-A pro Behandlungssitzung in verschiedene Muskeln verabreicht. In 71 % der Fälle erfolgte zusätzlich eine Injektion im Bereich der oberen Extremität. Der Einsatz bildgebender oder technischer Injektionshilfen wie Ultraschall, EMG oder elektrische Stimulation erfolgte bei 77 % der Behandlungssitzungen. Am häufigsten (83,6 %) injiziert wurden die Gastrocnemius-Muskeln (caput laterale und caput mediale), gefolgt vom Musculus soleus (67 %). Der mittlere GAS-T-Score im ersten Therapiezyklus betrug 38 Punkte. Ein Score von 50 entspricht hierbei einer vollständigen Zielerreichung durch alle Patienten. Über alle Behandlungszyklen hinweg stieg der T-Score signifikant auf durchschnittlich 48,2 an, was eine deutliche Effektivität der AboBoNT-A-Therapie bezüglich der individuellen Zielerreichung anzeigt. In lediglich ca. 23 % der ersten Injektionszyklen wurden keine Injektionshilfen verwendet. Deren Einsatz ist in der Regel mit einer erhöhten Präzision verbunden. Die Therapie erwies sich insgesamt als sicher, es traten keine neuen Sicherheitsrisiken der BoNT-A-Therapie auf. Bei 13,5 % der Teilnehmenden wurden unerwünschte Ereignisse berichtet, darunter waren Dysphagie, Mundtrockenheit, Muskelschwäche, Hämatome an den Injektionsstellen und Parästhesien. Zudem wurde ein Fall von Makuladegeneration mit unklarem Zusammenhang zur Therapie dokumentiert. Darüber hinaus traten drei Todesfälle infolge schwerwiegender Ereignisse wie Aspirationspneumonie, septischer Schock und respiratorisches Versagen auf, die jedoch nicht in Zusammenhang mit der Studienmedikation standen. Als ein wichtiges Ergebnis der Studie zeigten sich in der multivariaten Analyse die folgenden Prädiktoren für ein günstiges Therapieansprechen: Einsatz von Injektionshilfen (Injektionskontrolle bei der Injektion verbessert das Ergebnis), eine höhere Anzahl injizierter Muskeln, jüngeres Alter und männliches Geschlecht. Wie bereits dargestellt, überschritt die berichtete Wirkdauer von AboBoNT-A in vielen Fällen das in der Fachinformation empfohlene Standardintervall von zwölf Wochen. Dies hebt die Bedeutung individuell angepasster Therapieintervalle hervor. Das starre Festhalten an einheitlichen Zeitintervallen erscheint bei LLS hingegen nicht sinnvoll. Hierbei sind auch das Setting und die verfügbaren Ressourcen relevant. Insbesondere in Regionen mit längeren Anfahrtswegen oder limitiertem Zugang zu Versorgungseinrichtungen könnten längere Injektionsintervalle sinnvoll sein. Die Studienergebnisse belegen, dass dies nicht unbedingt mit einem Kompromiss hinsichtlich der Wirksamkeit verbunden sein muss. Die medianen Dosierungen für die Behandlung der unteren Extremität lagen mit im Median 600 Einheiten (im Mittel 665 Einheiten) deutlich unterhalb der zugelassenen Höchstdosis von 1500 Einheiten. Bei Personen, die ausschließlich eine SMD der unteren Extremität aufwiesen (LLS), waren die Dosen über die Injektionszyklen hinweg tendenziell höher. Die hohe Erfolgsrate in der Zielerreichung in der AboLiSh-Studie zeigt, dass auch nicht maximale Dosierungen pro Injektionssitzung wirksam sein können. In der Zulassungsstudie für AboBoNT-A wurde zuvor allerdings eine positive Korrelation zwischen Injektionsdosis und Gehgeschwindigkeit beobachtet. Dies könnte implizieren, dass eine Dosiseskalation bei unzureichendem Therapieansprechen eine sinnvolle Strategie sein könnte.
Zusammenfassende Bewertung und Limitationen
Es lässt sich festhalten, dass die AboLiSh-Studie als prospektive Beobachtungsstudie wichtige praxisrelevante Erkenntnisse zur Auswahl von Zielmuskeln und Dosierungen bei der Behandlung der SMD der unteren Extremität mit AboBoNT-A im ambulanten Versorgungsalltag lieferte. Sie bestätigte den klinischen Nutzen wiederholter Behandlungszyklen bei gehfähigen Patienten mit LLS, einschließlich spastischer Spitz- oder Klumpfußstellung. In den meisten Fällen konnten individuelle Therapieziele innerhalb von bis zu fünf Zyklen erreicht werden. Die Studie bestätigte das günstige Sicherheitsprofil der AboBoNT-A-Injektionstherapie. Eine wichtige Erkenntnis war, dass der Einsatz von Injektionshilfen im Sinne einer Injektionskontrolle mit einer überlegenen Zielerreichung assoziiert ist. Der positive Einfluss der Behandlung der begleitenden Armspastizität auf das Behandlungsergebnis, das Ansprechen der unteren Extremität auf BoNT-A, bleibt unzureichend geklärt. Die eingeschlossenen Patienten waren, wie so häufig in Studien, vergleichsweise zur klinischen Routine der ambulanten Schlaganfallbehandlung jung. Dies unterstreicht aber auch die bekannte Problematik, dass der Zugang zu BoNT-A-Therapien für ältere Menschen erschwert ist. Auch der relativ geringe Anteil an Frauen spiegelt nicht unbedingt die epidemiologische Verteilung wider, sondern ist eher Ausdruck der bekannten mangelhaften Versorgungsgerechtigkeit. Künftige Anstrengungen sollten darauf abzielen, diese Versorgungslücken weiter zu schließen.
Fazit
- Die spastische Bewegungsstörung (SMD) ist eine häufige Komplikation nach zentralmotorischen Läsionen, insbesondere nach Schlaganfällen, und führt zu erheblichen Einschränkungen der Motilität von betroffenen Gelenken, der Mobilität und der Lebensqualität.
- Die Pathophysiologie der SMD umfasst neuronale und muskuläre Veränderungen, wobei ein Ungleichgewicht zwischen exzitatorischen und inhibitorischen Einflüssen auf das spinale neuronale Netzwerk sowie strukturelle Muskelveränderungen die zentralen Rollen spielen.
- Die Behandlung der SMD erfordert ein individuelles, multiprofessionelles und interdisziplinäres therapeutisches Herangehen, wobei die funktionelle Relevanz der SMD im Vordergrund steht.
- Botulinumtoxin Typ A (BoNT-A) ist die Therapie der ersten Wahl bei fokalen, multifokalen oder segmentalen SMD-Formen und zeigt in Studien eine signifikante Wirksamkeit, insbesondere bei spastischer Gangstörung bei Spitz- oder Klumpfußstellungen.
- Technische Injektionshilfen wie Ultraschall, Elektrostimulation oder Elektromyografie verbessern die Wirksamkeit der BoNT-A-Therapie und sollten standardmäßig eingesetzt werden.
- Die AboLiSh-Studie bestätigt den klinischen Nutzen von Abobotulinumtoxin A (AboBoNT-A) in der Behandlungspraxis der LLS mit einer stabilen Verbesserung der Gehfähigkeit und einer guten Verträglichkeit über mehrere Behandlungszyklen hinweg.
- Begleitende Maßnahmen zu einer medikamentösen Behandlung der SMD, wie Trainings- und Physiotherapie, Laufbandtraining, eine Orthesenversorgung und auch eine Gangphasengerechte funktionelle Elektrostimulation sind in Kombination mit und ohne BoNT-A multimodal einzusetzende andere Therapien, die essenziell für einen nachhaltigen Behandlungserfolg sein können
- Die Therapieintervalle und Dosierungen von BoNT-A sollten in der Regel an der Zulassung der eingesetzten BoNT-A Produkte orientiert eingesetzt werden. Wobei hier auch eine individuelle Anpassung der Parameter empfohlen werden kann.
- In zahlreichen Fällen der AboLiSh-Studie wurden längere Therapieintervalle verwendet als die üblicherweise diskutierten zwölfwöchigen Intervalle. Dabei wurde eine niedrigere mittlere Behandlungsdosis pro Sitzung mit AboBoNT-A eingesetzt im Vergleich zur zugelassenen Behandlungsdosis von AboBoNT-A.
Bildnachweis
contrastwerkstatt – stock.adobe.com
Referenten
Prof. Dr. med. Jörg Wissel Neurologie am Wittenbergplatz Ansbacher Str. 17 10787 Berlin Prof. Dr. med. Chi Wang Ip Stellvertretender Klinikdirektor Neurologische Klinik und Poliklinik Josef-Schneider-Straße 2 97080 Würzburg
Interessenkonflikte
Prof. Dr. med. Jörg Wissel gibt folgende Interessenkonflikte an: Allergan, Merz, Ipsen, Medtronic, Shionogi, Ipsen, Sintetica
Sponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 14.900,- durch die IPSEN PHARMA GmbH GmbH unterstützt.

Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt