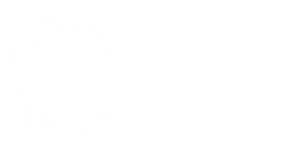KI in der Diagnose seltener Erkrankungen
Am Ende dieser Fortbildung wissen Sie,...
- wichtige Datenbanken, die auch von KI-gestützten Systemen als Quelle genutzt werden,
- häufig genutzte Symptom-Checker für die Suche nach seltenen Erkrankungen,
- Praxiserfahrungen mit dem KI-gestützten Anamnese-Tool Bingli,
- rechtliche Aspekte und Leitlinien für die Anwendung von KI in der Medizin,
- Anwendungsbeispiele und Praxistipps zu Symptoma.de, SAMS und ChatGPT.
Einführung
Seltene Erkrankungen betreffen weltweit rund 300 Millionen Menschen, wobei es über 7000 verschiedene Krankheitsbilder gibt, von denen viele genetischen Ursprungs sind. Die Diagnosestellung ist in diesen Fällen häufig mit erheblichen Herausforderungen verbunden mit der Konsequenz, dass Patienten oft eine jahrelange Odyssee durch das Gesundheitssystem durchlaufen, bis eine korrekte Diagnose gestellt wird. In Deutschland vergehen durchschnittlich etwa fünf Jahre, bis die Betroffenen überhaupt eine Diagnose haben. Angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit medizinischer Daten und der rasanten Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens eröffnen sich neue Perspektiven durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). KI-Systeme, insbesondere solche auf Basis tiefer neuronaler Netze, zeigen vielversprechende Ansätze zur Unterstützung bei der Diagnose seltener Erkrankungen. Die Anwendungen reichen von automatisierter Bildanalyse in der Radiologie und Dermatologie bis hin zur algorithmischen Auswertung genetischer Sequenzdaten. Insbesondere Entscheidungsunterstützungssysteme auf Basis von Natural Language Processing (NLP) und multimodaler Datenintegration spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Fortbildung gibt einen Einblick in den praktischen Einsatz von Symptom-Checkern, Fragebögen, Phänotypisierungsplattformen und dem KI-Chatbot ChatGPT, um seltene Erkrankungen zu diagnostizieren.
Einsatzgebiete von KI in der Praxis
Trotz der häufig geäußerten datenschutzrechtlichen Vorbehalte gegen den Einsatz von KI-Tools in der ärztlichen Praxis werden diese zunehmend genutzt, weil sie Ärzte und Praxisteams bei der täglich anfallenden Verwaltungsarbeit deutlich entlasten können und Zeit sparen. Was KI im Rahmen der Diagnostik leisten kann und welches Potenzial in dieser Technologie steckt, verdeutlicht eine Studie aus der Zeit der Coronapandemie: Mit einer „convolutional neural network”-(CNN-)basierten Architektur bestehend aus einem „poisson biomarker layer” und drei vortrainierten parallel geschalteten ResNet50 („residual neural network”, tiefe neuronale Netzwerke mit 50 Schichten) zur Bildverarbeitung und Audioanalyse konnte eine COVID-19-Erkrankung mit einer Sensitivität von 98,5 % und einer Spezifität von 94,4 % auch ohne PCR- oder Antigenanalyse allein am Husten erkannt werden. Ein wichtiger Schritt zur Nutzung von KI bei der Diagnose seltener Erkrankungen ist die Erstellung und Validierung eines Fragenkataloges für Patienten mit einem entsprechenden Krankheitsverdacht, der von der Bonner Arbeitsgruppe von Professor Grigull mit dem Q53-Fragebogen entwickelt wurde. Die Fragen sind so formuliert, dass seltene Erkrankungen von psychosomatisch-psychiatrischen oder anderen chronischen Krankheitsbildern differenziert werden können. Um eine KI für die Identifizierung von seltenen Erkrankungen trainieren zu können, sind zunächst Daten von Patienten mit gesicherten Diagnosen notwendig, die den Q53-Fragebogen ausfüllen. Das damit erzeugte trainierte Modell kann aus dem Input von Verdachtspatienten wahrscheinliche Diagnosen liefern, die danach klassifiziert und validiert werden müssen. Das System wird umso leistungsfähiger, je mehr Daten für das Training eingegeben werden. Schmerzzeichnungen von Patienten werden in der Anästhesiologie und Schmerzmedizin häufig eingesetzt, um die Lokalisation von Schmerzen möglichst genau zu dokumentieren. Mit den aus Schmerzzeichnungen erstellten Trainingsdatensätzen ist es möglich, eine KI so zu trainieren, dass sie ein definiertes Schmerzverteilungsmuster mit einer seltenen Muskelerkrankung assoziieren kann, wie zum Beispiel der fazioskapulohumeralen Muskeldystrophie (FSHD). Bei dieser Erkrankung kommt es neben verschiedenen Lähmungserscheinungen auch zu spezifischen Schmerzen im Schulter- und unteren Lumbalbereich. KI ist mittlerweile auch in der Lage, bestimmte Erkrankungen in einem Porträtfoto zu erkennen und vom Phänotyp Hinweise auf den zugrunde liegenden Genotyp zu generieren. Systeme wie Face2Gene oder der GestaltMatcher können die Diagnose unterstützen, vorausgesetzt, eine datenschutzkonforme Einwilligung zur Bildbearbeitung liegt vor. Mit dem Tool Face2Gene kann zum Beispiel ein Down-Syndrom (Trisomie 21) schon seit 2013 identifiziert werden.
Datenbanken als Informationsquelle für seltene Erkrankungen
PubMed ist eine große Literaturdatenbank mit über 35 Millionen hinterlegten Zitationen, die für die Suche nach Literatur zu seltenen Erkrankungen genutzt werden kann. Um die zu einer bestimmten Krankheit passenden Informationen aus dieser Datenbank zu bekommen, reicht allerdings die Eingabe von spezifischen Fragen oder Symptomen nicht aus, hier sind zusätzliches Fachwissen über die gesuchte Erkrankung und mögliche Differenzialdiagnosen notwendig. Das Gleiche gilt für die Datenbank GeneReviews, die zu bestimmten genetischen Erkrankungen oder Genen detaillierte Informationen bereithält. Orphanet ist ein kostenloses europäisches Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs. Es enthält nicht nur eine Enzyklopädie von etwa 11.000 seltenen Krankheiten, davon 8000 mit den damit assoziierten Genen, sondern auch Informationen zu Behandlungsoptionen mit etwa 6000 Orphan Drugs sowie Expertenzentren, Speziallaboren, laufenden Forschungsprojekten und Selbsthilfeorganisationen. Ein weiterer nützlicher Onlinekatalog für die Suche nach Informationen zu seltenen Erkrankungen ist OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man). Auch bei dieser Datenbank ist medizinisches Fachwissen notwendig, um genetisch bedingte Erkrankungen und die damit assoziierten Gene zu finden. Die NORD Rare Disease Database (National Organization for Rare Disorders) enthält neben Fachinformationen auch Videos von Betroffenen mit seltenen Erkrankungen. Diese Plattform ist gut geeignet, um bestimmte Krankheitsbilder noch besser kennenzulernen.
Symptom-Checker als digitales Diagnostiktool
Im Gegensatz zu Datenbanken generieren KI-gestützte Symptom-Checker eine Auswahl von wahrscheinlichen Erkrankungen auf der Basis von zuvor eingegebenen Krankheitssymptomen. Auch der Chatbot ChatGPT ist in der Lage, mit den richtigen Prompts Symptome mit möglichen Krankheitsbildern zu assoziieren. FindZebra ist ein spezialisierter Suchdienst für seltene Erkrankungen. Die Plattform richtet sich primär an medizinisches Fachpersonal und basiert auf einer gezielten Suche in den bereits erwähnten kuratierten Datenquellen wie Orphanet, OMIM und PubMed. Die zugrunde liegenden Algorithmen basieren auf Information Retrieval und nicht auf klassischem maschinellen Lernen. Isabel Healthcare ist ein in der Vollversion kostenpflichtiges klinisches Entscheidungsunterstützungssystem, das Ärzten bei der Differenzialdiagnose hilft. Die Software basiert auf der NLP-Technologie und einer großen medizinischen Wissensdatenbank. Nach Eingabe von Symptomen, Befunden oder Laborwerten liefert Isabel Healthcare eine Liste möglicher Diagnosen einschließlich seltener Erkrankungen. Die Symptome werden gut erklärt, was auch für die Ausbildung von Studenten genutzt wird. Isabel Healthcare wird häufig in Kliniken eingesetzt und beherrscht mehrere Sprachen. Symptoma.de ist ein KI-gestützter Symptom-Checker, der über 20.000 Krankheiten abdeckt, darunter auch viele seltene Erkrankungen. Symptoma.de ist vor allem für Patienten geeignet und bietet über 40 unterstützte Sprachen an. Symptome können in Freitext oder strukturiert eingegeben werden, und das System berechnet daraus mögliche Diagnosen.
Erfahrungen mit dem Anamnese-Tool Bingli
Bingli ist ein mehrsprachiges digitales Anamnese-Tool, das Arbeitsabläufe in der Praxis vereinfachen kann. Mithilfe von KI wird eine strukturierte und patienten-zentrierte Anamnese automatisiert. Patienten beantworten nach der persönlichen Identifizierung mit Namen, E-Mail-Adresse und Mobilnummer auf Bingli vor dem Arztbesuch gezielte Fragen, die auf ihren Symptomen und der medizinischen Vorgeschichte basieren. Praxen, die dieses Tool nutzen, können ihren Patienten den Link zur Plattform zusammen mit der Terminbestätigung per E-Mail schicken. Der Arzt oder eine damit beauftragte MFA kann sich somit vor dem Patientenkontakt in der Praxisansicht des Systems bereits ein Bild über Symptomatik, Akuität und Schweregrad machen und sich entsprechend vorbereiten. Bingli kennzeichnet potenziell gefährliche Symptome oder Symptomkombinationen mit einem dringlichen Handlungsbedarf mit roten oder gelben Fähnchen, wie zum Beispiel eine mögliche Myokarditis bei Erkältungskrankheiten. Das System kann auch mögliche Diagnosevorschläge generieren. Mit diesen Informationen können Patienten mit dringenden Befunden gegebenenfalls kurzfristiger einbestellt werden. Alle Daten können entweder als Text in die Zwischenablage der Praxissoftware exportiert oder als PDF heruntergeladen und in die Patientenakte eingefügt werden. Patienten lernen durch die strukturierte Dateneingabe ihre Erkrankung besser zu beschreiben und zu hinterfragen. Insgesamt ermöglicht Bingli damit effizientere Konsultationen, Zeitersparnis und eine höhere Qualität von Anamnese und Diagnostik mit dem Ergebnis, dass mehr Zeit für persönliche Zuwendung und fundierte Entscheidungen vorhanden ist.
Rechtliche Aspekte bei der Nutzung der KI
Die Integration von künstlicher Intelligenz in der Medizin hat ein enormes Potenzial, um die Patientenversorgung zu verändern. Beispiele hierzu sind eine verbesserte Genauigkeit bei der Krankheitsdiagnose und eine schnellere Symptomdeutung, denn sie liefert Ärzten, medizinischen Fachangestellten und Patienten in Echtzeit effizient nützliche Informationen, rationalisiert administrative Aufgaben und senkt damit die Kosten. Der Einsatz von KI in der Medizin bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie die Sicherstellung der Datensicherheit, ethische Fragen und die Notwendigkeit, die Technologie kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erkennt das Potenzial künstlicher Intelligenz für die Patientenversorgung an und betont zudem die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umganges mit den Möglichkeiten, die die KI bietet. In einer Stellungnahme vom Mai 2025 heißt es in der Einleitung: „Anwendungen der künstlichen Intelligenz und Algorithmen bieten große Chancen, die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern. In der digitalen Praxis von morgen unterstützen sie etwa bei der Dokumentation, bei der Einschätzung von Befunden oder bei der Auswahl möglicher Behandlungsoptionen. Sie entlasten im Alltag, erhöhen die Effizienz und können zur Qualitätssicherung beitragen. Grundlage für ihren Einsatz sind transparente Algorithmen, ethische Standards und eine rechtlich klare Verantwortung: Entscheidungen treffen weiterhin die Ärzte und Psychotherapeuten im Dialog mit ihren Patienten – nicht die Technik.” Die Bundesärztekammer hat Leitlinien zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Medizin verabschiedet, die wichtige Aspekte betonen, wie die ärztliche Unabhängigkeit, das Patientenwohl und die informationelle Selbstbestimmung. Der Absatz 4 der Leitlinien umfasst unter anderem Themen wie das ärztliche Handeln im Kapitel 4.1, den Datenschutz und die Schweigepflicht im Kapitel 4.3 sowie Anwendungsvoraussetzungen und Haftung im Kapitel 4.5. Es gibt verschiedene Symptom-Checker, deren Bedienung unterschiedliche personenbezogene Daten verlangen. Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Artikel 4 Nummer 1 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung definiert. Dadurch sind es alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Beispielhaft seien genannt: der Vor- und Nachname, das Geschlecht, das Alter, Bilddateien, aber auch Gesundheitsdaten. Am Beispiel des Symptoms Gesichtsdysmorphie ist gut nachvollziehbar, ob und welche Art von personenbezogenen Daten gespeichert bzw. in den Systemen eingegeben werden. Bei einer Eingabe des Symptoms Gesichtsdysmorphie in manche Symptom-Checker werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert. Wird ein Porträtfoto hochgeladen und ein Gesichtserkennungsprogramm verwendet, ist das aber sehr wohl der Fall, und Haftungsregeln sind dementsprechend zu beachten, wie sie beispielhaft in den Leitlinien der Bundesärztekammer erwähnt werden.
Fazit rechtliche Einordnung:
- Grundsätzlich hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz das Potenzial, die Heilbehandlungen zu erleichtern, wenn nicht sogar zu verbessern.
- Die behandelnden Ärzte können KI-Symptom-Checker unterstützend zur Ursachenfindung nutzen, aber allein Ärzte stellen die Diagnose und entscheiden über die anzuwendende Therapie.
- Das bereits bestehende Haftungsrecht bietet ausreichende Regelungen für die Behandlungsrisiken auf Basis des Arzthaftungsrechtes.
- Aufgrund der Nachweisschwierigkeiten, insbesondere bei zunehmender Autonomie der KI, liegt das Risiko bei deren Einsatz aktuell schwerpunktmäßig bei den Patienten.
Sicherstellung der Datenqualität bei der KI-gestützten Suche nach seltenen Erkrankungen
KI-Systeme können wesentlich zur Verbesserung der Diagnose seltener Erkrankungen beitragen, wenn die zugrunde liegenden Daten qualitativ hochwertig, gut strukturiert und korrekt sind. Die Sicherung dieser Datenqualität erfordert internationale Standards, kontinuierliche Validierung durch Experten, transparente Dokumentation sowie eine ethisch vertretbare Datenverarbeitung. Allen seltenen Erkrankungen ist per definitionem gemeinsam, dass es sie nur in geringen Fallzahlen gibt. Dadurch wird die Entwicklung robuster KI-Systeme erschwert. Außerdem sind seltene Erkrankungen sehr heterogen, weil sie viele unterschiedliche Organsysteme betreffen und sich häufig nicht immer einem Organsystem zuordnen lassen. Die lange Leidenszeit von Patienten mit seltenen Erkrankungen führt auch dazu, dass die Abgrenzung der Symptome von zusätzlichen psychosomatischen Beschwerden oft schwerfällt. Durch die regelmäßige manuelle Kuratierung von KI-generierten Diagnosen durch interdisziplinäre Fallkonferenzen und Fachexperten können fehlerhafte KI-generierte Diagnosen identifiziert und durch strukturierte Annotationen so korrigiert und angereichert werden, dass damit die Systeme trainiert und weiter verbessert werden können. Voraussetzung dafür ist, dass KI-Systeme Feedback aus der klinischen Praxis aufnehmen können. Um konsistente und vergleichbare Daten zu erhalten, müssen medizinische Informationen aus verschiedenen Quellen (z. B. elektronische Gesundheitsakten, Genomdaten, Fachliteratur) standardisiert werden. International anerkannte Klassifikationen wie Orphanet und die International Classification of Diseases (ICD) helfen dabei, Diagnosen, Symptome und Therapien eindeutig zu kodieren. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Transparenz der KI-Ergebnisse. Es muss jederzeit nachvollziehbar sein, woher die Daten stammen, wie sie erhoben wurden und ob sie vertrauenswürdig sind. Ein aktuelles Forschungsgebiet mit dem Titel „Explainable AI” soll die Transparenz der KI weiter verbessern. Die zukünftige Entwicklung geht dahin, dass man in der KI-Anwendung erkennen kann, auf welche Informationsquellen zurückgegriffen wurde.
xxxxxxx
Vorteile der KI-Tools für Ärzte und Patienten
Wie bereits bei der Darstellung des Anamnese-Tools Bingli beschrieben, kann ein KI-gestütztes System die Effizienz der Arbeitsabläufe und der Organisation in der Praxis deutlich verbessern. Dadurch, dass Patienten ihre Beschwerden in ein strukturiertes Tool eingeben, setzen sie sich mit ihrer Erkrankung auseinander und lernen diese auch besser kennen, vorausgesetzt, sie sind in der Lage, digitale Systeme zu nutzen. Für viele vor allem ältere Patienten ist das derzeit entweder nicht oder nur mit Unterstützung möglich. Die Erreichbarkeit von Arztpraxen kann durch KI-Anrufbeantworter verbessert werden, weil Patienten ihre Beschwerden oder ihr Anliegen schildern können, ohne dass dazu ein persönlicher Kontakt mit Arzt oder MFA notwendig ist. Diese sind dann in der Lage, die Informationen asynchron abzuarbeiten. Mehrsprachige KI-Anrufbeantworter mit automatischer Übersetzungsfunktion haben für die Kommunikation mit den Patienten große Vorteile. Das System hat auch mehr Zeit, den Patienten zuzuhören, und bietet in gut verständlicher Sprache Kommunikation auf Augenhöhe. Viele Ärzte in Klinik und Praxis beklagen die zunehmende Verwaltungsarbeit, die immer mehr Zeit kostet, die eigentlich für ärztliche Tätigkeiten zur Verfügung stehen sollte. KI-gestützte Dokumentationssysteme können hier deutlich entlasten und die Erstellung hochkomplexer Arztbriefe im Rahmen der Behandlung von Patienten mit seltenen Diagnosen mit fertigen Textbausteinen unterstützen, Patientenaufklärungen in einfacher Sprache generieren, Anfragen vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) beantworten helfen und ärztliche Bescheinigungen ausstellen, die natürlich von Ärzten oder Fachangestellten gegengelesen werden müssen, bevor sie weitergegeben werden. In einigen Praxisverwaltungssystemen hat mittlerweile ein KI-gestütztes Dokumentations-Tool Einzug gehalten, das nach Aufklärung und Einverständnis das Gespräch mit dem Patienten aufzeichnet und dieses selbstständig in Anamnese und Befunde strukturiert. Erfahrungen zeigen allerdings, dass viele Patienten gegen eine Aufzeichnung des Gespräches mit dem Arzt große Vorbehalte haben.
„Deep phenotyping“ und SAMS bei der Suche nach seltenen Erkrankungen
„Deep phenotyping” bezeichnet die detaillierte, strukturierte und computergestützte Erfassung aller klinisch relevanten Merkmale (des Phänotypen) eines Menschen. Anders als bei der klassischen Anamnese werden hier Symptome, Laborwerte, Bildgebungsbefunde und molekulargenetische Informationen in einer standardisierten und strukturierten Form gesammelt. Ziel ist es, den klinischen Phänotyp so präzise wie möglich zu beschreiben, um ihn mit bekannten Krankheitsbildern zu vergleichen. Ein zentraler Baustein für „deep phenotyping” bei seltenen Erkrankungen ist die Verwendung standardisierter Ontologien wie Human Phenotype Ontology (HPO), die eine präzise und international einheitliche Beschreibung klinischer Merkmale ermöglicht. Dokumentationssysteme in Kliniken und Praxen speichern in der Regel nach ICD-10 oder ICD-11 kodierte Diagnosen, die für Abrechnungen verwendet werden, aber das Krankheitsbild der Patienten nur unvollständig beschreiben. Weitere Informationen sind in lokalen Datenbanken und Arztbriefen gespeichert. In Arztbriefen werden in der Regel keine standardisierten Beschreibungen benutzt, sodass z. B. für eine eingeschränkte Nierenfunktion die Bezeichnungen „Nierenerkrankung”, „CKD” (chronische Nierenerkrankung), „NI” oder „Nierenversagen” vorkommen können, wodurch ein automatisiertes Data Mining unmöglich wird. Auch die meisten Datenbanken sind nicht mit anderen Systemen interoperabel, erlauben also keinen Datenaustausch. Dieser Austausch und das Zusammenbringen von Daten eines Patienten aus verschiedenen Quellen sind aber für die Dokumentation und Diagnose seltener Erkrankungen sehr wichtig. An der Charité wurde vor mehr als 15 Jahren die Human Phenotype Ontology (HPO) entwickelt, die im Moment mehr als 18.000 klinische Symptome enthält und mit Ober- und Unterklassen verknüpft. Die HPO-Datensammlung ist kostenlos, community driven (Entwicklung wird von der Gemeinschaft getragen) und wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert. Basierend auf standardisierten Datensystemen wurde die KI-gestützte Plattform SAMS (Symptom Annotation Made Simple) entwickelt, die zur Dokumentation von Forschung an und Entscheidungsunterstützung in der Diagnostik bei seltenen Erkrankungen genutzt werden kann. Krankheiten und klinische Merkmale werden standardisiert (z. B. Orphanet und HPO) eingegeben. SAMS vergleicht den erfassten Phänotyp mit einer großen Wissensbasis seltener Erkrankungen (aus Orphanet) und liefert eine priorisierte Liste seltener Krankheiten, die mit den vorhandenen oder ausgeschlossenen Symptomen übereinstimmen, und fragt gezielt nach dem Vorhandensein bzw. der Abwesenheit der für eine Differenzialdiagnose wichtigen Symptomen. Die Integration in Kliniksysteme und elektronische Patientenakten ist leicht möglich, und die Verwendung von Standardterminologien erlaubt den internationalen Datenaustausch in Form eines „phenopacket” der Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH).
Fallbeispiel SAMS
Bei einem Patienten mit Verdacht auf eine thrombotische Mikroangiopathie (TMA) wurde im Zentrum für seltene Nierenerkrankungen zunächst eine Panel-Gensequenzierung der TMA-Gene durchgeführt. Dabei wurden keine potenziell pathogenen Varianten gefunden. Wenn die Symptome des Patienten in SAMS eingegeben werden und „start differential diagnosis” angeklickt wird, zeigt SAMS zunächst eine Liste verschiedener Krankheiten, deren in Orphanet annotierte Symptome gut zu diesem Patienten passen würden. Durch Klick auf die einzelnen Krankheitsbezeichnungen erhält man die Details, die in Orphanet zu dieser Krankheit hinterlegt sind. Unter der Liste mit den vorgeschlagenen Krankheiten werden verschiedene für eine Differenzialdiagnose wichtige klinische Symptome aufgeführt. Diese können durch entsprechende Eingaben bejaht (in diesem Fall „Migräne ohne Aura”) oder ausgeschlossen werden (in diesem Fall „reduzierter Anteil naiver CD8-T-Zellen” und „Suizidalität”). Danach werden eine aktualisierte Liste der HPO-Symptome und neue Differenzialdiagnosen angezeigt, nun mit retinaler Vaskulopathie als am besten passender Diagnose. Ein Klick auf den Button „show genes” zeigt in grüner Farbe das Gen „three prime repair exonuclease 1” (TREX1) als wahrscheinlichstes Krankheitsgen an, was in diesem Fall auch molekulargenetisch bestätigt wurde. SAMS ist eine kostenlose Open-Source-Software mit offenen Standards, die kontinuierlich erweitert wird. Stand April 2025 waren 413 Nutzer registriert und Daten von etwa 11.000 Patienten in SAMS gespeichert. Alle Daten bleiben entweder in der Charité oder – bei einer Installation der Software auf den eigenen Rechner – beim jeweiligen Nutzer. Um die Plattform auszuprobieren, ist keine Installation notwendig. SAMS kann über den nebenstehenden Link einfach im Browser aufgerufen werden.
Symptoma.de und ChatGPT im Vergleich
Neben Symptom-Checkern wie Symptoma.de werden auch Chatbots wie ChatGPT zunehmend genutzt, um durch die Eingabe von Symptomen mögliche Diagnosen zu generieren. Durch die Eingabe der gleichen Patienteninformation (18-jähriger männlicher Patient mit ausgeprägter Müdigkeit) und der Symptomkombination Hepatomegalie, Splenomegalie und Thrombozytopenie wurde die Leistung beider Systeme verglichen. Symptoma.de lieferte als TOP-3-Diagnosen das Pfeiffersche Drüsenfieber, Morbus Gaucher und die Primäre Myelofibrose. Nach der zusätzlichen Eingabe des von dem Patienten genannten Symptoms Knochenschmerz zeigte Symptoma.de Morbus Gaucher als seltene lysosomale Speichererkrankung an. Durch Klick auf die Krankheitsbeschreibung werden in Symptoma.de weiterführende Informationen zu Symptomatik und Therapie angezeigt. Die Eingabe der gleichen Daten in ChatGPT mit dem Zusatz, die wahrscheinlichste Diagnose anzuzeigen, ergab ebenfalls Morbus Gaucher.
Praxistipps im Umgang mit Symptom-Checkern und ChatGPT
Viele Symptom-Checker und ChatGPT sollten nicht mit zu vielen ungefilterten und unspezifischen Symptomen wie zum Beispiel Bauchschmerzen „gefüttert” werden, sondern nur mit aus ärztlicher Sicht spezifischen Befunden. Gute Programme, wie zum Beispiel SAMS, berücksichtigen auch die Seltenheit von Symptomen, was die Identifizierung seltener Erkrankungen erleichtert. Gerade bei den sogenannten „Drehtürpatienten” ohne klare Diagnose, die sich immer wieder mit Beschwerden in der Praxis vorstellen, ist zu beachten, dass psychosomatische und psychiatrische Symptome genannt werden, die nicht zur Erkrankung gehören. Eine KI führt dann auch nicht zur Diagnose. Es ist hilfreich, bei der Suche nach seltenen Erkrankungen mit verschiedenen KI-Tools zu arbeiten. Bei der Eingabe von unspezifischen Beschwerden wie Bauchschmerzen stellt Symptoma.de gezielt Fragen, die dabei unterstützen, die Symptomatik weiter eingrenzen. Je mehr Fragen beantwortet werden, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, eine spezifische Erkrankung zu identifizieren. ChatGPT verarbeitet auch Informationen zum Ergebnis von bereits durchgeführten Untersuchungen oder auszuschließenden Erkrankungen. ChatGPT kann auch gezielt mit einer Datenbank verknüpft werden, zu der man Zugangsdaten hat, wie zum Beispiel AMBOSS. Nach der Anweisung von ChatGPT, nur aus dieser Datenbank Informationen zu beziehen, können die Ergebnisse etwas differenzierter sein. Der Patient sollte nicht einfach mit einem wahrscheinlichen Suchergebnis konfrontiert werden. Wenn sich der Verdacht auf eine seltene Erkrankung erhärtet, sollte der Patient umgehend an ein spezialisiertes Zentrum oder zur humangenetischen Untersuchung überwiesen werden.
Fazit
- Kuratierte Datenbanken wie PubMed, Orphanet, OMIM und die Rare Disease Database stehen nicht nur für den direkten Zugriff zur Verfügung, sondern werden auch von KI-Systemen als Informationsquelle genutzt.
- Symptom-Checker ermöglichen Ärzten und Patienten, durch die strukturierte Eingabe von Symptomen und Befunden eine oder mehrere wahrscheinliche Diagnosen zu ermitteln. Auch seltene Erkrankungen können damit entdeckt werden.
- Das Anamnese-Tool Bingli ermöglicht es, dass Patienten vor dem Praxisbesuch ihre Beschwerden strukturiert dokumentieren. Arzt oder MFA können erkennen, ob Patienten mit dringenden Befunden früher einbestellt werden müssen.
- Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer haben Leitlinien zur Anwendung von KI in der Medizin herausgegeben. Die Letztverantwortung für Diagnose und Therapie bleibt immer beim Arzt.
- Zur Sicherstellung der Datenqualität bei der KI-gestützten Suche nach seltenen Erkrankungen sind internationale Standards bei der Dateneingabe, eine Kuratierung der Ergebnisse sowie die Nachvollziehbarkeit der KI-Arbeitsweise mit Quellentransparenz notwendig.
- Der Einsatz von KI-Tools in der Medizin verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe in Praxis und Klinik, reduziert den Zeitaufwand für Bürokratie und spart Zeit bis zur Diagnosefindung. KI stößt aber auch auf datenschutzrechtliche Vorbehalte und kann vor allem für ältere nicht technikaffine Patienten eine besondere Herausforderung sein.
- „Deep phenotyping” mit standardisierten Datenquellen mit der Plattform SAMS bietet Interoperabilität mit anderen Datenbanken und erlaubt somit eine bessere Nutzung aktueller Forschungsergebnisse in der Diagnostik seltener Erkrankungen.
- Symptom-Checker und Chatbots wie ChatGPT liefern bei der Eingabe identischer Symptome und Befunde vergleichbare wahrscheinliche Diagnosen. Eine Nutzung verschiedener KI-gestützter Systeme kann bei der Suche nach seltenen Erkrankungen hilfreich sein.
Bildnachweis
MrPanya – Adobe Stock
Referenten
Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke Direktor des Instituts für Digitale Allgemeinmedizin Universitätsklinikum Aachen Pauwelsstraße 30 52074 Aachen Univ.-Prof. Dr. rer. medic. Dominik Seelow Professor of Bioinformatics and Translational Genetics Berlin Institute of Health Charité - Universitätsmedizin Berlin Charitéplatz 1 10117 Berlin Dominik Pütz Praxis Dominik Pütz Provinzialstraße 33-35 53859 Niederkassel-MondorfInteressenkonflikte
Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke gibt an, im Rahmen von Vorträgen und Beratungsleistungen Honorare bzw. Aufwandsentschädigungen von folgenden pharmazeutischen Unternehmen erhalten zu haben: Sanofi Aventis, Chiesi GmbH, Takeda Pharma, Kyowa Kirin, Novartis, Orthomol, Boehringer Ingelheim sowie Alnylam. Diese Beziehungen stehen in keinem direkten Zusammenhang mit dem hier dargestellten Inhalt. Eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Aussagen durch diese Tätigkeiten ist nach bestem Wissen und Gewissen ausgeschlossen. Univ.-Prof. Dr. rer. medic. Dominik Seelow hat keine Interessenkonflikte. Dominik Pütz hat keine Interessenkonflikte.Sponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 16.900,- durch die Sanofi-Aventis Deutschland GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt