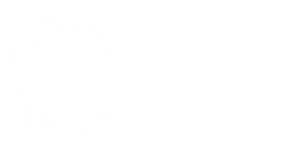Insulin icodec: Wocheninsulin in der praktischen Anwendung bei Typ-2-Diabetes
Am Ende der Fortbildung kennen Sie…
- welche Behandlungsmöglichkeiten bei Typ-2-Diabetes bestehen,
- welche Moleküleigenschaften das Wocheninsulin Insulin icodec aufweist,
- wie Insulin icodec richtig dosiert wird,
- wie Insulin icodec bei insulinnaiven und -erfahrenen Patienten eingesetzt wird,
- wie Insulin icodec in besonderen Situationen und Patientengruppen wirkt.
Einführung
Therapie des Typ-2-Diabetes
Der Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM) ist eine chronische Erkrankung mit in der Regel progressivem Verlauf. Um eine Senkung des Blutzuckerspiegels dauerhaft zu erreichen, möglichen Organ- und Gefäßschädigungen sowie Folgeerkrankungen vorzubeugen bzw. deren Fortschreiten zu verlangsamen, sind Therapieintensivierungen notwendig. T2DM-Patienten schätzen seit der Einführung der lang wirksamen Glucagon-like-Peptide-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) nicht nur deren positive Effekte auf den Glukosestoffwechsel, auf das Hypoglykämierisiko und die Gewichtsreduktion, sondern insbesondere auch die nur einmal wöchentliche Injektion. US-amerikanische und europäische Diabetes-Fachgesellschaften empfehlen zur Behandlung eines T2DM als erste injektable Therapie einen GLP-1-RA, bevor eine Insulintherapie eingeleitet wird. Dies wird u. a. damit begründet, dass die Injektionslast, das Risiko für Hypoglykämien und die Gewichtszunahme geringer sind als bei einer alleinigen Therapie mit einem Basalinsulin. Dennoch kann der progrediente Krankheitsverlauf des T2DM dazu führen, dass eine alleinige Therapie mit GLP-1-RA und oralen Antidiabetika (OAD) nicht mehr ausreichend ist und daher zusätzlich eine Insulintherapie benötigt wird. Allerdings haben viele Menschen mit T2DM Bedenken hinsichtlich einer Insulintherapie, was die Therapieakzeptanz bzw. den zeitgerechten Beginn einer notwendigen Insulintherapie beeinträchtigen kann („Clinical Inertia”). Diabetiker interpretieren den Beginn einer Insulinbehandlung häufig als einen Indikator für die Schwere ihrer Erkrankung und die Unfähigkeit, die Krankheit selbst zu bewältigen. Zudem bestehen oftmals Ängste vor der Komplexität der Therapie, vor Schmerzen durch die Injektionen, vor einer Gewichtszunahme sowie vor hypoglykämischen Episoden. Betroffene von der Notwendigkeit einer Insulintherapie zu überzeugen, kann für den behandelnden Arzt deshalb viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch die konsequente Einhaltung einer Insulintherapie scheint problematisch. So zeigte etwa ein Drittel der Diabetiker gemäß einer multinationalen Studie eine schlechte Adhärenz gegenüber ihrer Insulinbehandlung, und die befragten Ärzte gaben an, dass ihre typischen Patienten im Durchschnitt 4,3 Basalinsulininjektionen pro Monat ausließen. Ein unzureichend behandelter T2DM zieht viele Komorbiditäten nach sich – allen voran kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD). Typ-2-Diabetiker mit einem längerfristig erhöhten Wert für glykiertes Hämoglobin (HbA1c) >7,0 % (53 mmol/mol) ohne eine zeitgerechte Therapieintensivierung innerhalb eines Jahres nach der Diagnose weisen ein deutlich erhöhtes Komplikationsrisiko auf als solche mit rechtzeitiger Therapieanpassung und einem HbA1c ≤7,0 % (53 mmol/mol). Der Risikoanstieg für den kombinierten CVD-Endpunkt lag bei 62 %, für Schlaganfälle bei 51 %, für Herzinsuffizienz bei 64 % und für Myokardinfarkt bei 67 %. Eine weitere Analyse ergab im mikrovaskulären Bereich einen Anstieg der Inzidenz für diabetische Retinopathie um 7 %, Nephropathie um 18 % und Neuropathie um 8 %, wenn bei unzureichender glykämischer Einstellung keine Therapieintensivierung innerhalb eines Jahres erfolgte.
Zeitgerechter Beginn einer Insulintherapie
Eine unbefriedigende Blutzuckereinstellung sollte nicht über einen längeren Zeitraum toleriert und der Start einer Basalinsulintherapie nicht aufgeschoben werden. Gerade Basalinsuline ermöglichen einen komfortablen und einfachen Einstieg in die Insulintherapie. So muss nicht jeden Tag die Insulindosis angepasst und für jede Mahlzeit neu berechnet werden. Wenn Betroffene über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten deutlich über ihrem individuell definierten HbA1c-Ziel liegen und andere Therapieoptionen nicht (mehr) infrage kommen, sollte eine Insulintherapie begonnen werden.
Vorteile eines Wocheninsulins
Die Hemmschwelle gegenüber einer Insulintherapie ist möglicherweise geringer, wenn die Injektionstherapie nicht mehr täglich durchgeführt werden muss, sondern nur noch einmal pro Woche. Tatsächlich gibt es bereits antidiabetische Arzneimittel, wie den GLP-1-RA Semaglutid, die nur noch einmal wöchentlich subkutan verabreicht werden müssen. Patienten sehen darin große Vorteile, wie aus einer älteren Umfrage hervorgeht. Zu den genannten Vorteilen gehören u. a. eine angenehmere Anwendung, eine höhere gesundheitsbezogene Lebensqualität, eine weniger erdrückende Behandlung sowie eine Erleichterung für Personen, die eine medizinische oder pflegerische Betreuung benötigen. Aber auch die Therapieadhärenz kann durch eine Wochentherapie positiv beeinflusst werden, wie eine Untersuchung zu den wöchentlichen gegenüber den täglich anzuwendenden GLP-1-RA zeigte.
Basalinsuline im Überblick und die Pharmakologie von Insulin icodec
Vor knapp 90 Jahren wurde der Vorläufer des noch heute verwendeten Neutral- Protamin-Hagedorn (NPH)-Insulins entwickelt. NPH-Insulin zeigt eine recht kurze Wirkdauer, muss als Suspension vor der Anwendung sorgfältig durchmischt werden und hat eine ausgeprägte Peak-Wirkung zwei bis drei Stunden nach Injektion. Insulinneuentwicklungen der letzten Jahrzehnte zielten vor allem darauf ab, die Anwendung der Basalinsuline sicherer und einfacher hinsichtlich der Anwendung zu machen. Die Wirkprofile wurden zunehmend flacher und die Wirkdauer deutlich verlängert. So wurde als erstes Basalinsulinanalogon das Insulin glargin 100 Einheiten (E)/ml entwickelt, gefolgt von Insulin detemir. Im Jahr 2014 wurde Insulin degludec in den deutschen Markt eingeführt – es ist in der Gruppe der täglich anzuwendenden Basalinsuline durch ein besonders kontinuierliches und gleichmäßiges Wirkprofil gekennzeichnet. 2015 folgte Insulin glargin in einer höher konzentrierten Form mit 300E/ml und einer gegenüber Insulin glargin 100 E/ml verlängerten Wirkdauer. Moderne Basalinsuline sind gegenüber NPH-Insulin für Patienten komfortabler, da sich mit zunehmender Wirkdauer die Injektionsfrequenz reduziert, der Injektionszeitpunkt freier gewählt werden kann und durch flachere pharmakokinetische Wirkprofile das Hypoglykämierisiko verringert wird. Durch eine gleichmäßigere Freisetzung der Insulinmoleküle aus dem subkutanen Depot und durch die Verlängerung der Wirkdauer sinkt die Tag-zu-Tag-Variabilität der Insulinwirkung. Somit wurden die Basalinsuline besser berechenbarer und komfortabler für die Patienten. Beim Wocheninsulin Insulin icodec wurden Modifikationen in das Insulinmolekül eingeführt, um die Bindungsneigung an Albumin zu fördern, die Molekülstabilität gegenüber enzymatischem Abbau zu erhöhen und die Löslichkeit zu verbessern. Dazu wurden drei Aminosäuren in der A- und B-Kette des Insulins ausgetauscht und eine Kohlenstoff-(C-)20-Fettsäure über einen Spacer an die B-Kette angehängt (an Position B29; die Aminosäure B30 wurde vorher entfernt). Durch diese biochemischen Modifikationen verlängert sich die Halbwertszeit des Insulinmoleküls auf etwa eine Woche, sodass Insulin icodec für eine einmal wöchentliche Anwendung geeignet ist. Zudem ermöglicht eine verbesserte Löslichkeit eine Formulierung mit 700 E/ml. Insulin icodec bindet über die C20-Fettsäure an Albumin und bildet so einen Albumin-gebundenen Insulinspeicher, aus dem Insulin icodec langsam freigesetzt wird. Die Wirkstoffabgabe erfolgt kontinuierlich über 24 Stunden über das Injektionsintervall von einer Woche. Insulin icodec nutzt dabei <0,1 % des natürlichen, körpereigenen Albuminspeichers. Jedes Albuminmolekül weist vier hochaffine sowie zusätzliche intermediär affine Bindungsstellen für Fettsäuren auf. Es besteht dadurch ein großer Überschuss an Albuminbindungsstellen, sodass selbst bei (krankheitsbedingt) verminderten Albuminkonzentrationen kein Einfluss auf die Pharmakokinetik von Insulin icodec zu verzeichnen ist. Daher ist kein klinisch relevanter Einfluss auf die Aktivität von Insulin icodec durch Albuminurie, intrinsische Faktoren und kompetitive Proteinbindung zu erwarten. Weiterhin zeigten pharmakokinetische Studien, dass eine dem Insulin icodec spezifische Dosisanpassung bei Nieren- und Leberfunktionsstörungen nicht erforderlich ist. Der Hersteller empfiehlt jedoch bei Patienten mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen eine häufigere Überwachung des Blutzuckerspiegels. Auch bestehen keine Interaktionen mit anderen plasmaeiweißbindenden Medikamenten. Diese Eigenschaften stellen wichtige Sicherheitsaspekte bei der Anwendung von Insulin icodec dar.
Klinische Studiendaten zu Insulin icodec bei Menschen mit Typ-2-Diabetes
Im Rahmen des klinischen Phase-IIIa-Studienprogrammes ONWARDS wurde in fünf Studien die Wirksamkeit und Sicherheit von einmal wöchentlich verabreichtem Insulin icodec versus täglichen Basalinsulinen (Insulin glargin oder degludec) bei T2DM-Patienten geprüft. Die Studien ONWARDS 1 bis 5 untersuchten sowohl die Neueinstellung auf ein Basalinsulin bei Insulin-naiven Patienten (ONWARDS 1, ONWARDS 3 und ONWARDS 5) als auch den Wechsel auf Insulin icodec bei zuvor mit einem anderen Basalinsulin (ONWARDS 2) bzw. mit Basal- und Bolusinsulin (ONWARDS 4) vorbehandelten Patienten. Die Studiendauer lag bei 26 (ONWARDS 2) und 52 Wochen (ONWARDS 1, 5), mit einer Verlängerungsphase von weiteren 26 Wochen bei der ONWARDS-1-Studie. Das Wocheninsulin erzielte in den Studien eine effektive Blutzuckerkontrolle, gemessen an der Veränderung des HbA1c-Wertes in Woche 52 bzw. 26, und eine Nichtunterlegenheit gegenüber herkömmlichen Basalinsulinen (primärer Endpunkt). Mit <1 Ereignis pro Patientenjahr waren zudem die Raten klinisch relevanter oder schwerer Hypoglykämien (Plasmaglukose <3,0 mmol/l [<54 mg/dl] oder Fremdhilfe erforderlich) in den Studien mit einer Basalinsulintherapie in Kombination mit Nichtinsulinantidiabetika gering (ONWARDS 1, 3, 5 bzw. 2). Bei T2DM-Patienten unter einer Basal-Bolus-Therapie zeigte sich kein Unterschied bei der HbA1c-Reduktion und in der Rate klinisch relevanter oder schwerer Hypoglykämien versus Insulin glargin 100 E/ml (ONWARDS 4). Generell besteht aber bei einer intensivierten konventionellen Therapie (ICT), bei der Bolusinsulin injiziert wird, ein erhöhtes Hypoglykämierisiko. Weiterhin wurde in dem ONWARDS-Studienprogramm auch das Erreichen eines kombinierten Endpunktes, bestehend aus einem HbA1c-Wert <7 % ohne klinisch relevante oder schwere Hypoglykämieereignisse, überprüft. In den Studien ONWARDS 1, 3 und 5 bzw. ONWARDS 2 – jeweils T2DM mit einer Basalinsulintherapie in Kombination mit Nichtinsulinantidiabetika – erreichte ein größerer Anteil an Patienten unter Insulin icodec den kombinierten Endpunkt im Vergleich zu täglichen Basalinsulinen. So wiesen in den Studien ONWARDS 1 und 3 insgesamt 10 % mehr vormals insulinnaive Patienten nach 52 Wochen sowie 12 % mehr Patienten nach 26 Wochen einen HbA1c-Wert <7 % auf, ohne dass eine klinisch relevante oder schwere Hypoglykämie auftrat, verglichen mit Insulin glargin 100 E/ml (52,6 vs. 42,6 %) bzw. Insulin degludec (52,1 vs. 39,9 %).
Patientenpräferenz
Befragungen von T2DM-Patienten aus dem ONWARDS-Studienprogramm zeigten eine höhere Behandlungszufriedenheit und eine starke Präferenz für die wöchentliche versus die tägliche Gabe von Basalinsulin. So wurden in einer Post-hoc-Analyse der ONWARDS-2-Studie die Patienten im Studienarm mit Insulin icodec auf Basis ihrer Erfahrungen vor und während der Studie befragt, welches Basalinsulin sie bevorzugen: 93,7 % präferierten einmal wöchentliches Basalinsulin (74,1 % sehr starke Präferenz) gegenüber dem vor Studienbeginn verwendeten täglichen Basalinsulin (Insulin glargin 100 E/ml, Insulin degludec, Insulin glargin 300 E/ml, NPH-Insulin oder Insulin detemir). Als Hauptgründe nannten 69,5 % der Studienteilnehmer die einmalige Injektion pro Woche, die einfache Anwendung (52,3 %) und die verbesserte Blutzuckerkontrolle (36,0 %). Weitere positive Aspekte waren die gute Kompatibilität mit Alltagssituationen, eine geringere emotionale Belastung und weniger Injektionsschmerzen.
Insulin icodec zur Behandlung des Diabetes mellitusx
In der Europäischen Union ist Insulin icodec zur Behandlung des Diabetes mellitus bei Erwachsenen seit Mai 2024 zugelassen und wurde im September 2024 in den deutschen Markt eingeführt. Wie bei anderen Basalinsulinen wird die Wirkstärke von Insulin icodec in Einheiten (E) ausgedrückt. So entspricht 1 E Insulin icodec je 1 E Insulin glargin 100 E/ml, Insulin detemir, Insulin degludec oder Humaninsulin. Insulin icodec ist als Formulierung mit 700 E/ml erhältlich und siebenfach konzentrierter als konventionelle, täglich injizierbare Basalinsuline mit 100 E/ml. Damit ist das wöchentliche Injektionsvolumen gleichwertig mit dem täglichen Injektionsvolumen eines Basalinsulins mit 100 E/ml. Durch die wöchentliche Gabe werden im Vergleich zu 365 Injektionen/Jahr mit Insulin glargin 100 E/ml nur 52 Injektionen/Jahr mit Insulin icodec benötigt (Reduktion der Injektionen um 86 %).
Insulin icodec bei Insulin-naivem Typ-2-Diabetes
Fallbeispiel 1
Ein 68-jähriger Gartenlandschaftsbauer in Rente: Er ist mit einem Body Mass Index (BMI) von 24,5 kg/m2 normgewichtig, wiegt 82 kg bei einer Größe von 183 cm. Der Patient ernährt sich zwar kohlehydratbetont, aber ohne grobe Ernährungsfehler, und betätigt sich regelmäßig sportlich. Der frühere Raucher leidet seit zehn Jahren an einem T2DM sowie einem Hypertonus und einer koronaren Dreigefäßerkrankung (koronare Herzerkrankung [KHK] mit hochgradigen Stenosen in drei Hauptästen der Koronararterien), fünf Stents wurden bereits gesetzt. Außerdem leidet er an einer chronischen Nierenkrankheit bei einer Nephrosklerose. Bislang wurde der Patient mit einer OAD-Triple-Therapie behandelt, bestehend aus Biguanid Metformin, dem Dipeptidylpeptidase-(DDP-)4-Inhibitor Sitagliptin und dem Natrium-Glukose-Cotransporter-(SGLT-)2-Inhibitor Empagliflozin. Dennoch war die Blutzuckereinstellung des Patienten unzureichend (HbA1c: 8,7 %), bei merklich eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin 1,40 mg/dl, glomuläre Filtrationsrate [GFR] 53 ml/min/ 1,73 m2). Da der Albumin-Kreatinin-Quotient (UACR) im Normbereich lag (4,3 mg/g Krea), sprach dies nicht für eine klassische diabetische Nephropathie, sondern eher für hypertensive Schäden, wie schon die anamnestisch aufgeführte Nephrosklerose anzeigt. Da der Patient normgewichtig war, wurde eine C-Peptid-Bestimmung durchgeführt, die mit 1,04 ng/ml am unteren Rand des Normbereiches lag. Vor diesem Hintergrund wurde nachfolgend durch Antikörperbestimmung (Anti-Tyrosinkinase-IA-2- und Anti-Glutaminsäure-Decarboxylase-[GAD-] Antikörper) ein Autoimmundiabetes („latent autoimmune diabetes in adults”, LADA) ausgeschlossen. Damit war die Diagnose T2DM sicher gestellt.
Therapieumstellung
Aufgrund seines normalen Köpergewichtes und des knapp niedrigen C-Peptid-Wertes profitiert der Patient aus Sicht des Behandlers eher von einer Insulintherapie als von einem GLP-1-RA. Den Beginn einer Insulinbehandlung hatte der Patient allerdings bisher abgelehnt, da er Vorbehalte hinsichtlich der täglichen Injektionen hatte – bedingt durch häufige Reisen, einen aktiven Lebensstil und den Wunsch nach Flexibilität. Daher wurde dem Patienten Insulin icodec (700 E/ml) als Wocheninsulin mit einer Anwendung von nur einmal pro Woche nahegelegt. Zunächst wurde gemeinsam mit dem Patienten ein geeigneter und verlässlicher Injektionstag sowie die initiale Wochendosis festgelegt. Zudem wurde der Patient darin geschult, die verschriebene Wochendosis einzustellen. Dazu wird die wöchentliche Dosis in Schritten von 10 E in der Dosisanzeige des Fertigpens ausgewählt, der eine Skala von 10 bis 700 hat. Außerdem wurde das Vorgehen bei versehentlich ausgelassenen Injektionen erörtert.
Exkurs: Insulin icodec bei vormals Insulin-naivem TD2M
Laut Herstellerangaben sollte mit einer Einstiegsdosis von 70 E einmal pro Woche begonnen werden. Dies entspricht der üblichen täglichen Basaldosis von 10 E. Analog zur Dosisanpassung eines täglichen Basalinsulins erfolgt ab Woche 2 eine wöchentliche Dosistitration in Schritten von ±20 E Insulin icodec (entsprechend einem Titrationsalgorithmus von ±3 E bei täglichen Basalinsulinen), bis der Nüchternplasmaglukosezielbereich erreicht ist. Ein Vergleich der Dosiseinstellung zwischen Insulin icodec und Insulin glargin 100 E/ml zeigte, dass die angestrebten Spiegel der Nüchternplasmaglukose mit beiden Insulinen vergleichbar rasch erreicht werden.
Therapieverlauf nach Einstellung des Patienten auf Insulin icodec
Im Rahmen der berichteten Fallbeispiels 1 erfolgte bei dem Patienten eine Erhöhung der Insulindosis auf schließlich 130 E Insulin icodec pro Woche. Bereits nach drei Monaten konnte so ein HbA1c-Wert von 7,3 % und nach sechs Monaten von < 7 % erreicht werden - bei Beibehaltung der OAD-Triple-Therapie.
Das Arzt-Patienten-Gespräch
Zur Vermeidung von Dosierungsfehlern sollten mit dem Patienten Aspekte wie zum Beispiel die einmal wöchentliche Anwendung des Wocheninsulins und die korrekte Einstellung der verordneten Dosis am Pen besprochen werden. Auch das Verhalten bei vergessener Dosis sollte erläutert werden. Wenn ein T2DM-Patient von einer täglichen Basalinsulintherapie auf eine Wochentherapie mit Insulin icodec umgestellt wird und dabei die optionale einmalige Aufsättigungsdosis von 50 % bei der ersten Injektion (Woche 1) angewendet wird, ist auch dies mit dem Patienten zu besprechen. Es ist dabei deutlich zu machen, dass die Aufsättigungsdosis nur einmalig bei der ersten Injektion (Woche 1) angewendet wird und ab Woche 2 nur noch die Wochendosis (siebenmal tägliche Basalinsulindosis) zu injizieren ist.
Ausgelassene Injektionen
Wenn eine Dosis ausgelassen wurde, sollte diese so rasch wie möglich nachgeholt werden. Sind nach dem ursprünglich festgelegten Tag (z. B. montags) der subkutanen Insulin-icodec-Injektion nicht mehr als drei Tage vergangen, kann der T2DM-Patient die Injektion nachholen und seinen ursprünglichen Wochentag der Injektion (hier montäglich) beibehalten. Sind jedoch bereits mehr als drei Tage vergangen, sollte die versäumte Dosis so rasch wie möglich verabreicht werden und das wöchentliche Dosierungsschema entsprechend auf den „neuen” Wochentag verlegt werden, an dem die versäumte Dosis injiziert wurde. Möchte der T2DM-Patient zu seinem ursprünglichen Injektionstag (hier: Montag) zurückkehren, so ist dies auch möglich. Dafür kann er den Zeitraum zwischen den aufeinanderfolgenden Injektionen schrittweise verlängern, bis er schließlich wieder den ursprünglichen Verabreichungstag erreicht hat. Während dieser Phase sollte der Nüchternplasmaglukosespiegel sicherheitshalber engmaschig(er) kontrolliert werden.
Insulin icodec bei Insulin-erfahrenen Patienten
Fallbeispiel 2
Eine 79-jährige, typische T2DM-Patientin mit einem BMI von 35 m2/kg: Ihre Ernährung umfasst reichlich Obst, Süßigkeiten, Kuchen und Zwischenmahlzeiten, außerdem bewegt sie sich zu wenig, nicht zuletzt aufgrund einer fortgeschrittenen Coxarthrose. Der T2DM besteht seit 15 Jahren, zudem leidet die Patientin an Hypertonie, Nephropathie, Polyneuropathie und einer ausgeprägten Makuladegeneration. Der Albumin-Kreatinin-Quotient (UACR) zeigte mit knapp 64 mg/g Krea eine Mikroalbuminurie an. Trotz einer Therapie mit einmal wöchentlich Semaglutid subkutan (s. c.) 1 mg, Insulin glargin 300 E/ml 28 E täglich (abends) und Metformin liegt ihr HbA1c-Wert bei 10,7 % und ist demnach viel zu hoch. Daher sollte dringend eine Änderung der Therapie wie auch der Ernährungsweise erfolgen. Die Patientin beschrieb, dass das Nachlassen ihrer Sehkraft ein großes Problem für sie darstelle, insbesondere in der Umsetzung ihrer Insulintherapie bei der Dosiseinstellung am Pen, und sie öfters abends die Insulindosis vergesse. Im Gespräch stellte sich heraus, dass das einmal wöchentliche Semaglutid s. c. von ihrem Sohn verabreicht wird, jeweils am Sonntag. Abhilfe soll hier neben einer Diabetes- und Ernährungsschulung die Umstellung auf das Wocheninsulin Insulin icodec schaffen – zumal es gemeinsam am gleichen Tag mit dem einmal wöchentlichen Semaglutid s. c. verabreicht werden kann.
Exkurs: Umstellung auf Insulin icodec bei T2DM
Bei einem Wechsel von einem täglich verabreichten Basalinsulin auf ein Wocheninsulin sollte die erste Injektion von Insulin icodec am Tag nach der letzten Dosis des bisher verwendeten täglichen Basalinsulins erfolgen. Die Dosierung entspricht der täglichen Basalinsulingesamtdosis multipliziert mit 7 (hier in Fallbeispiel 2: 28 E multipliziert mit 7, gerundet auf die nächsten 10 E – also 200 E). Für die erste Injektion (Dosis in Woche 1) wird eine zusätzliche einmalige Aufsättigungsdosis von 50 % Insulin icodec empfohlen, um ein schnelleres Erreichen der Blutzuckerkontrolle bei T2DM-Patienten zu erzielen.
Aufsättigungsdosis bei T2DM: Ja oder nein?
Eine zusätzliche einmalige Aufsättigungsdosis von 50 % Insulin icodec wird empfohlen, falls ein schnelleres Erreichen der Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit T2DM angestrebt wird. Bei Typ-1-Diabetes soll die einmalige Aufsättigungsdosis für die erste Injektion immer angewendet werden. Die Empfehlung für die zusätzliche einmalige Aufsättigungsdosis von 50 % bei Umstellung auf Insulin icodec ist durch die lange Halbwertszeit des Insulins begründet, das mit der Aufsättigungsdosis nach etwa zwei bis drei Wochen den maximalen Wirkspiegel der gewählten Dosis erreicht (ohne Aufsättigungsdosis drei bis vier Wochen). So kann die einmalige Aufsättigungsdosis Menschen mit T2DM helfen, die anfängliche Verschlechterung der glykämischen Kontrolle bei der Basalinsulinumstellung auf Insulin icodec zu minimieren, ohne dass ein zusätzliches Hypoglykämierisiko während der Umstellungsphase (Wochen 0 bis 4) besteht. Die 50%ige Aufsättigungsdosis wird ausschließlich für die erste Injektion empfohlen. Wie oben beschrieben ist sie bei Typ-1-Diabetes obligatorisch und bei T2DM empfohlen. Ab der zweiten Injektion wird die siebenfache vorherige Basalinsulingesamtdosis verabreicht (Wochendosis). Alle weiteren Injektionen basieren dann auf den Stoffwechselbedürfnissen des Patienten, den Ergebnissen der Blutzuckermessung und dem Ziel der Blutzuckereinstellung, bis der gewünschte Nüchternplasmaglukosespiegel erreicht ist. Während der Umstellung und in den darauffolgenden Wochen wird eine engmaschige Überwachung des Blutzuckers empfohlen.
Umstellung und Therapieverlauf bei Fallbeispiel 2:
Bei der Patientin erfolgte die Basalinsulinumstellung mit einer einmaligen Aufsättigungsdosis. Konkret bedeutet dies: 28 E Gesamtbasalinsulintagesdosis multipliziert mit 7 (d. h. Wochendosis) und multipliziert mit dem Faktor 1,5 sowie gerundet auf die nächsten 10 E: das heißt 290 E für die erste Injektion (Woche 1) der Umstellung. Der Einfachheit halber wurde die erste Dosis inklusive der Aufsättigungsdosis in der Praxis verabreicht. Die Patientin nahm weiterhin täglich Metformin ein. Ab Woche 2 nach Umstellung injizierte der Sohn sonntäglich die Wochendosis von 200 E Insulin icodec sowie Semaglutid s. c. 1 mg. Die Wochendosis wurde schrittweise auf 240 E pro Woche erhöht, und drei Monate nach Therapieumstellung lag der im Labor gemessene HbA1c bei 6,7 % und die im Labor gemessene Nüchternplasmaglukose bei 127 mg/dl (7,0 mmol/l).
Insulin icodec bei besonderen Situationen und Patienten
Hohes Alter sowie Nieren- oder Leberfunktionsstörungen
Insulin icodec kann sowohl bei älteren Patienten als auch bei Patienten mit einer Nieren- oder Leberfunktionsstörung angewendet werden. Es ist keine spezifische Dosisanpassung für Insulin icodec notwendig. Generell wird in diesen Patientengruppen eine häufigere Überwachung des Blutzuckerspiegels empfohlen und eine Anpassung der Insulintherapie und Insulindosis sollte entsprechend der glykämischen Stoffwechselbedürfnisse der Patienten erfolgen.
Gastrointestinale Infekte und Fieber, Nüchternphasen
Eine kurzfristige Dosisanpassung ist bei lang wirksamen Basalinsulinen kaum möglich und wird bei Insulin icodec aufgrund der langen Halbwertszeit nicht empfohlen. Aufgrund der zugrunde liegenden Erkrankung (z. B. entzündliche Erkrankungen, Fieber etc.) sowie der Stresssituation für den Patienten besteht eher ein erhöhter Insulinbedarf mit konsekutiv auftretenden Hyperglykämien. Auf diese muss gegebenenfalls mit der Gabe eines Bolusinsulins reagiert werden. Auch im Vorfeld und während einer Koloskopie kann es durch erhöhte Adrenalinspiegel zu Hyperglykämien kommen. Sollte im Rahmen der Vorbereitung auf eine Koloskopie durch die Nüchternphase eine Unterzuckerung auftreten, kann dieser mit zuckerhaltigen, klaren Getränken oder Traubenzucker begegnet werden.
Krankenhausaufenthalte
Während stationärer Klinikaufenthalte sollen lang wirksame Basalinsuline wie gewohnt injiziert werden. Dies gilt auch für Insulin icodec. Eine Post-hoc-Analyse der ONWARDS-Studien zeigte, dass die meisten Patienten ihr Injektionsintervall auch bei einem Krankenhausaufenthalt beibehalten haben und sich durch eine Hospitalisierung keine größeren Effekte auf die Blutzuckerkontrolle ergaben. Die Hypoglykämieraten waren niedrig, und es bestanden keine Unterschiede vor, während oder nach dem Klinikaufenthalt.
Sport, körperliche Aktivität
Aufgrund der Halbwertszeit von Insulin icodec wird eine Anpassung der Basalinsulindosis bei Sport nicht empfohlen. Eine Post-hoc-Auswertung der klinischen Studien ONWARDS 1 bis 5 bei Menschen mit T2DM ergab keinen Hinweis auf ein erhöhtes Hypoglykämierisiko gegenüber den täglichen Basalinsulinen im Zusammenhang mit von den Patienten berichteten körperlichen Aktivitäten. Generell gilt bei vermehrtem Training und Sport, den Blutzuckerspiegel engmaschig zu kontrollieren und bei Bedarf zusätzliche Kohlenhydrate zuzuführen sowie im Falle einer Basal-Bolus Therapie gegebenenfalls die Dosis des Bolusinsulins anzupassen.
Überdosierungen
Bei einer versehentlichen zwei- oder dreifachen Dosierung mit Insulin icodec wurde kein erhöhtes Hypoglykämierisiko gegenüber Insulin glargin 100 E/ml beobachtet (jeweils beim Auslassen der nächsten Injektion). Eine Überdosierung wurde in einer pharmakologischen Studie bei Menschen mit T2DM untersucht, in der die Auswirkung einer doppelten oder dreifachen Wochendosis Insulin icodec mit einer doppelten oder dreifachen Tagesdosis Insulin glargin 100 E/ml zum Zeitpunkt der höchsten Wirkung des jeweiligen Insulins verglichen wurde. Mit Insulin icodec wurde im Vergleich zu Insulin glargin 100 E/ml keine Erhöhung des Gesamtrisikos oder eine längere Dauer der klinisch relevanten Hypoglykämie beobachtet, vorausgesetzt, die nächste Wochendosis wurde ausgelassen. Während der Behandlungszeiträume traten keine schweren Hypoglykämien auf. Pharmakokinetische Modellierungen zeigen, dass die Peak-Wirkungen einer zwei- oder dreifachen Dosierung einer Wochendosis Insulin icodec versus Tagesdosis Insulin glargin 100 E/ml ähnlich bzw. unter Insulin icodec sogar geringer sind, da der Großteil des Insulin icodec zunächst an den Albuminpuffer bindet. Allerdings ist nachfolgend der Insulinspiegel unter Insulin icodec gegenüber Insulin glargin 100 E/ml längere Zeit erhöht. Unter der Voraussetzung, dass die nachfolgende Wochendosis ausgelassen wird, sollte deshalb bei einer zweifachen Überdosierung von Insulin icodec mindestens drei bis fünf Tage und bei einer dreifachen Überdosierung mindestens fünf bis sieben Tage lang eine engmaschige Kontrolle des Blutzuckers erfolgen, idealerweise mit einer kontinuierlichen Glukosemessung (CGM). Generell sollten Patienten, die auf eine Insulintherapie eingestellt werden, über Maßnahmen im Umgang mit einer Hypoglykämie geschult werden. Dies bedeutet u. a., dass Aktivitäten, die sich blutzuckersenkend auswirken können (z. B. Alkoholkonsum, körperliche Anstrengung, Sport) in dieser Zeit vermieden werden sollten. Zudem wird empfohlen, vor dem Schlafengehen lang wirksame Kohlehydrate zu sich zu nehmen, um dem Auftreten womöglich unbemerkter nächtlicher Hypoglykämien entgegenzuwirken. Patienten unter einer ICT wird zudem zu einer Reduktion des Bolusinsulins geraten.
Fazit
- Insulin icodec ist ein langwirksames Insulin-Analogon zur einmal wöchentlichen Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen. Es steht seit September 2024 in Deutschland zur Verfügung.
- Das klinische ONWARDS-Studienprogramm hat gezeigt, dass Insulin icodec eine effektive und gut verträgliche Therapieoption für Erwachsene mit T2DM ist.
- Bei insulinnaiven Patienten kann die einmal wöchentliche Anwendung den Beginn der Insulintherapie erleichtern und etwaige Vorbehalte reduzieren.
- In der praktischen Anwendung von Insulin icodec hinsichtlich Startdosis, Titration oder Vorgehen in besonderen Situationen und Patientengruppen ist vieles ableitbar aus und vergleichbar zu dem Umgang mit herkömmlichen lang wirksamen Basalinsulinen.
- Bei Umstellung von Insulin-erfahrenen Patienten mit T2DM auf das Wocheninsulin icodec kann optional eine zusätzliche einmalige 50%ige Aufsättigungsdosis bei der ersten Injektion (Woche 1) verabreicht werden.
Bildnachweis
Viacheslav – Adobe Stock
Referenten
Dr. med. Marcel Kaiser Internist, Diabetologe DDG Diabetologische Schwerpunktpraxis Triebstraße 43 60388 Frankfurt Dr. med. Petra Sandow Fachärztin für Allgemeinmedizin Reichsstraße 81 14052 BerlinInteressenkonflikte
Herr Dr. med. Marcel Kaiser hat in den letzten Jahren Honorare für Vorträge / Beratungstätigkeiten von folgenden Firmen bezogen: Bayer, Boehringer Ingelheim, Lilly, MSD, Novo Nordisk, Santis, AstraZeneca, derCampus Dr. Petra Sandow: Vorträge, die Teilnahme Advisory Boards, allgemeine Beratung, ungebundene Forschungsunterstützung oder sonstige medizinisch-wissenschaftliche Leistungen von Boehringer Ingelheim, Lilly, Volopharm, Roche, Repha, Bayer Healthcare, Medical Tribune, Berlin Chemie, Novartis, AstraZeneca, BMS, Gilead, GSKSponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 14.900,- durch die Novo Nordisk Pharma GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt