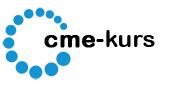Einleitung
Die Zahlen 10.000 und 1.000 stehen stellvertretend dafür, wie Diabetes effektiv und erfolgreich verhindert werden kann. 10.000 Schritte täglich ab dem 25. Lebensjahr würden chronische Erkrankungen wie Diabetes, Depression, Demenz, Adipositas, Insulinresistenz und Hypertonie verhindern.
Auch wenn diese Erkenntnis für manchen zu spät kommt, zeigt sie doch, welches Potential in der Bewegung steckt. Wenn ein Patient mit Diabetes Mellitus nur 1.000 Schritte täglich mehr läuft, das entspricht etwa 600 Metern, dann senkt das den postprandialen Blutzuckerspiegel doppelt so stark ab wie 1000 mg Metformin. Das bedeutet, dass die Prävention von Diabetes nicht in unserem Kopf, nicht in unseren Armen, sondern tatsächlich in unseren Beinen steckt. In den Muskeln die aktiviert werden wenn wir uns bewegen, überall im Körper. Das heißt, die Diabetesprävention läuft letzten Endes über Muskelzellen, über die Aktivierung von Muskelzellen, über das Laufen und Alltagsaktivitäten also über das „dem Diabetes davonlaufen“. Wenn wir es denn tun würden.
Die tägliche (In)Aktivität
2700 Schritte sind der durchschnittliche Bewegungsradius eines Erwachsenen hierzulande. Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper für eine tägliche Distanz von 36.000-39.000 Schritten ausgelegt ist. Wir nutzen also nur 6-8 % unseres Potentials.
Und wie sieht es mit unserer täglichen Aktivität insgesamt aus? Viele von uns schlafen 7 oder 8 Stunden und gehen vielleicht 8 Stunden dem Beruf nach. Daraus folgt: Rechnerisch wären das 16 Stunden Inaktivität. Tatsächlich sind wir 23.45 Minuten am Tag körperlich inaktiv, denn wir brauchen nur 15 Minuten, um die 2.700 Schritte zu laufen.
Was aber sagt Ihnen der Patient, wenn Sie ihm vorschlagen, 10.000 Schritte am Tag zu laufen? Er antwortet: Ich habe keine Zeit. Das stimmt nicht. Die Zeit ist da. Wir glauben einfach nur, wir hätten keine Zeit, weil es nicht unsere Priorität ist. Es ist nicht unsere Präferenz. Uns nicht zu bewegen empfinden wir als Lebensqualität und dagegen anzugehen ist gar nicht so leicht. Ich möchte Sie im Folgenden überzeugen, dass es trotzdem geht.
Manchmal müssen wir dazu auch andere Wege gehen. Abbildung 1 zeigt 540 Dresdner auf Facebook. Alle die rot markiert sind, werden im Laufe Ihres Lebens einen Diabetes Mellitus entwickeln. Das sind viele. Die grünen Kacheln haben den gleichen schlechten Lebensstil wie die roten, sind auch übergewichtig, z.T. sogar deutlich, bewegen sich wenig, ernähren sich falsch, trinken Alkohol oder rauchen. Und trotzdem entwickeln sie keinen Diabetes.
Wir wissen heute, dass das etwa 7 % der Übergewichtigen betrifft, die „gesunden Dicken“ oder „gesunden Übergewichtigen“. Wenn wir verstehen würden, warum diese Menschen keinen Diabetes bekommen, wäre das die Antwort darauf, wie wir Diabetes verhindern können. Doch leider kennen wir die Mechanismen (noch) nicht.
Nachhaltigkeit von Präventionsmaßnahmen
Vor einigen Jahren hat die OECD untersucht, wann sich Präventionsmaßnahmen gesundheitspolitisch und gesundheitsökonomisch „auszahlen“? Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse: Immer dann, wenn die farbige Kurve die rote gestrichelte Linie schneidet, ist der Punkt erreicht, an dem die Intervention für die Gesellschaft kosteneffektiv ist [1].
Eine naheliegende Strategie wäre es, in die Schulen zu gehen, um vor Ort den zukünftigen Diabetes zu verhindern. Man würde Cola-Automaten und Fast-Food aus den Schulen verbannen. Die Wirkung einer solchen Maßnahme zeigt die gelbe Linie, die bis zu 70 Jahre benötigt, bis sie auf gesellschaftlicher Ebene eine Veränderung oder eine Reduktion der Prävalenz einer chronischen Erkrankung wie Diabetes bewirkt. Die Maßnahme ist durchaus sinnvoll, aber es dauert sehr lange, bis die Allgemeinheit davon profitieren.
Es geht jedoch auch deutlich schneller. Ganz links in der Grafik sind drei Kurvenverläufe, die sehr schnell unter die rote gestrichelte Linie gehen, also sehr schnell wirksam sind. Das sind Massenmedienkampagnen, also Werbung für die Gesundheit, eine Nahrungsmittelkennzeichnung, sogenanntes Food labeling, und physician dietitian counseling. Das bedeutet, wir Ärzte sind hocheffizient im Bereich Prävention, weil wir eine hohe Glaubwürdigkeit besitzen. 87 % der Patienten glauben ihrem Arzt. 48 % glauben dem Apotheker 22 % dem Pfarrer, aber nur 12 % ihrer Krankenkasse.
Betrachtet man hingegen die unterschiedlichen Programme aus Kostensicht, so zeigt sich ein ganz anderes Bild. Abbildung 3 zeigt nach unten hellblau dargestellt, wie effektiv eine Maßnahme ist, nach oben in rot dargestellt, was die Maßnahme kostet. Bedauerlicherweise ist die ärztliche Beratung die teuerste Maßnahme [1]. Ärzte sind hocheffizient aber auch teuer. Dagegen sind steuerliche Initiativen wie z.B. eine Zuckersteuer sehr effektiv und erheblich günstiger in der Umsetzung.
Dänemark hat dieses Konzept vor einigen Jahren getestet und eine Steuer auf gesättigte Fette eingeführt. Ein Kilogramm gesättigte Fettsäuren wurde mit 2,50 Euro belegt. Die Maßnahme hat unmittelbar gewirkt. Über einen Zeitraum von einem Jahr hat ein durchschnittlicher Däne 180 g abgenommen. Das ist eine hocheffiziente Präventionsmaßnahme. Leider wurde das Programm aus politischen Gründen wieder eingestellt.
Pathophysiologie des Diabetes
Es ist wichtig zu verstehen, wie die Erkrankung entsteht und wie sie sich entwickelt. In Abbildung 4 sehen Sie eine gesunde Krankenschwester unserer Klinik, bei der wir über kontinuierliches Glucosemonitoring einen Tag lang Glukosespiegel gemessen haben. Die grünen Pfeile zeigen, wann diese Person etwas gegessen hat. Die Probandin hat einen durchschnittlich guten HbA1C und wir sehen keinerlei Veränderungen des Blutzuckerspiegels im Tagesverlauf. Heute wissen wir, diese Person ist sehr insulinsensitiv. Das heißt, sie benötigt nur 1% oder 2% ihres Insulins, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Der gesamte Stoffwechsel funktioniert in Hinblick auf die Blutzuckerregulation vorbildlich.
Im Vergleich dazu zeigt ihr Vater einen ganz anderen Response (Abbildung 5). Obwohl sein HbA1C-Wert diskret besser ist, sehen wir schon vor dem Aufstehen Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Dann kommt es zu einer Auslenkung des Glukosespiegels beim Frühstück und beim Mittagessen. Am späten Nachmittag und abends fällt der Wert ab, obwohl der Vater keinen Sport getrieben oder Medikamente eingenommen hat.
Diese Schwankung des Blutzuckerspiegels deutet auf die Entwicklung eines Diabetes Mellitus hin. Der Vater ist bereits sichtlich insulinresistent. Er benötigt im Vergleich zur Tochter etwa 80% seines Insulins, um seinen Blutzuckerspiegel zu regulieren. Es wird vermutlich noch 2 bis 3 Jahre dauern, bis der Vater eine Hyperglykämie entwickelt, dann dauert es häufig noch einmal 9-15 Jahre, bis er mit einem Diabetes erstdiagnostiziert wird.
Die Herausforderung vor der wir stehen ist, dass Personen mit diesem klinischen Bild prädestiniert sind, Prävention zu betreiben. Aber wir finden diese Patienten nicht. Es gibt keine Möglichkeit, außer einem kontinuierlichen, flächendeckenden Glukosemonitoring, was nicht möglich und zudem obsolet ist, um diese Person zu finden. Trotzdem ist genau das die Pathophysiologie, bei der wir ansetzen müssen, den Diabetes zu verhindern.
Aus dieser Erkenntnis folgt, dass wir künftig sowohl bei der Behandlung von Menschen mit Diabetes Mellitus, als auch in der Prävention der Erkrankung, mehr darauf achten werden, was den Blutzuckerspiegel beeinflusst, ganz gleich, ob Medikamente oder Ernährung. Und wir werden sowohl in der Prävention, als auch in der Behandlung darauf achten, dass wir besonders hohe oder besonders niedrige Blutzuckerspiegel vermeiden.
Bereits heute wissen wir, dass sehr niedrige Werte oder sehr hohe Werte zum einen das Herz, zum anderen das Gehirn schädigen [2, 3]. Dieses zu verhindern muss unser Behandlungsziel sein. Dazu können wir einerseits Medikamente einsetzen, um Glukoseschwankungen zu beeinflussen. Oder wir können mit Bewegung und ballaststoffreicher Ernährung die Glukosekurve egalisieren, was langfristig ein Vorteil für unsere Patienten oder diejenigen mit einem Diabetesrisiko ist.
Die Light-Falle
Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, das Cola light oder Cola zero gesünder sei als klassische zuckerhaltige Cola. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Studie über 280.000 Patientenjahre hat die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel einer täglichen Aufnahme eines Softdrinks (330 g/Tag) über ein Jahr verglichen [4]. Abbildung 6 zeigt ganz links die Ergebnisse für Wasser welches das Diabetesrisiko erwartungsgemäß nicht erhöht. Auch Säfte, vorwiegend aus Konzentrat, wurden untersucht. Wer ein solches Getränk täglich zu sich nimmt, erhöht sein Diabetesrisiko um etwa 40 %. Das gleiche Risiko hat klassische Cola. Dagegen erhöht Cola light das Diabetesrisiko um 60 %. Warum ist das so? Diese Cola-Sorte beinhaltet doch keinen Zucker? Es sind die Zuckerersatzstoffe und seit einiger Zeit wissen wir, dass die Austauschstoffe das Mikrobiom verändern. Sie beeinflussen die Bakterienzusammensetzung im Darm.
Die Aufnahme von Zucker begünstigt die Entwickelung von Escherichia Coli. Wenn Sie aber stattdessen Zuckeraustauschstoffe zu sich nehmen, gedeihen bei Kaukasiern 13 weitere Bakterienstämme, die den Darm in kurzer Zeit. Anders ausgedrückt: wer täglich eine Dose Cola light über zwei Wochen trinkt, verändert seine Bakterienzusammensetzung im Darm stärker als eine 10-tägige Antibiotikatherapie.
Es gibt Experimente, in denen eine Stuhlprobe eines Cola light Konsumenten, in eine sterile Ratte implantiert wurde. Es dauerte nur 3-4 Wochen bis die Ratte einen Diabetes entwickelt hatte. Dieser Versuch zeigt, dass zahlreiche, größtenteils unbekannte Vorgänge bei der Entwicklung eines Diabetes Mellitus eine Rolle spielen. Das Mikrobiom wird in Zukunft sehr wahrscheinlich eine größere Bedeutung erlangen, weil es ganz entscheidend von unserer Ernährungsweise beeinflusst wird.
Über 30 % der heutigen industriell hergestellten Nahrungsmittel enthalten Zuckerersatzstoffe, vor allem jene Produkte, die vorgeben, gesund zu sein. Eine Kennzeichnung bezüglich der Gefahren gibt es nicht. Und das ist nur eine der Herausforderungen vor der wir stehen, wenn es um eine veränderte Ernährung zur Vorsorge oder Vermeidung des Diabetes oder anderen chronischen Erkrankungen geht.
Ein weiterer Grund ist, dass wir nicht essen, um Kalorien zu uns nehmen. Ernährung ein Stück Lebensweise. Essen ist mit sehr vielen kulturellen und sozialen Interaktionen verbunden. Essen ist für uns gleichbedeutend mit Kultur. An Weihnachten essen wir besondere Sachen, wenn wir bei den Großeltern zu Besuch sind, gibt es etwas Besonderes. Das heißt viele soziale Interaktionen gehen auch über Essen und deswegen ist die Änderung der Ernährungsweise häufig auch mit kulturellen und sozialen Aspekten verbunden. Das macht es so schwer, Ernährung zu ändern.
Wie aber läßt sich Gesundheitsverhalten überhaupt ändern? Abbildung 7 wesentliche Einflussfaktoren und deren wechselseitigen Abhängigkeiten?
Stellen Sie sich vor, ein Kollege diagnostiziert bei Ihnen eine Krebserkrankung und er möchte bereits morgen früh operieren. Bei einer solchen Erkrankung folgt ein Patient im Allgemeinen dem Rat des Arztes. Wenn es also um eine schwerwiegende Erkrankung geht, glaubt und folgt der Patient dem, was der Arzt sagt.
Ganz anders verhält es sich bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes Mellitus. Da haben wir als Ärzte nur noch wenig Einfluss auf unsere Patienten, auch wenn wir häufig das Gegenteil glauben. Tatsächlich ist der Einflussnehmer auf den Lebensstil des Patienten nicht der Arzt, sondern die Peer-Group des Patienten: die Freunde, die Familie oder die Arbeitskollegen. Die sind wirkungsvoller darin Einfluss zu nehmen, als wir Ärzte. Wenn wir unserem Patienten eine ärztliche Anweisung geben, dann wird er die vermutlich eine Zeit lang befolgen, bis die Einflussnahme seines Umfelds stärkeres Gewicht hat. Die Patienten mit denen er gemeinsam im Wartezimmer sitzt sind für seinen Lebensstil unter Umständen wichtiger, als wir Ärzte, die er besucht.
Wir ändern unseren Lebensstil erst, wenn wir merken, dass sich unsere Lebensqualität hierdurch innerhalb kürzester Zeit verbessert. Diese Erwartungshaltung stellt eine hohe Barriere dar. Daher müssen wir Ärzte dem Patienten etwas anbieten, wo er das Gefühl hat, innerhalb von 2-3 Tagen ändert sich etwas spürbar. Die meisten Entscheidungen pro Lebensstiländerung werden nicht auf kognitiver oder rationaler Ebene, sondern auf emotionaler Ebene gefällt und da ist die Lebensqualität unser stärkster Trigger. Eine Entscheidung für eine Lebensstiländerung hängt davon ab, wie gut wir es schaffen, den Patienten bei dieser Veränderung zu unterstützen.
Pathophysiologie des Diabetes mellitus
Um dem Diabetes erfolgreich davonzulaufen, müssen wir die Pathophysiologie der Diabeteserkrankung besser verstehen. Und die Pathophysiologie eines Diabetes ist nicht der Zucker, sondern es ist das Fett.
Es geht um das Wechselspiel zwischen dem viszeralen Fett und dem Leberfett. Das viszerale Fett ist jene Fettschicht die wir unter der Muskelschicht im Bauch mit uns tragen, um das Omentum Majus, um den Darm, um die Leber und um die Nieren herum. Dieses Fett macht uns krank. Wir wissen heute, dass aus diesem Fettkompartiment mehr als 600 Hormone sezerniert werden und diese Hormone wirken im Gehirn, in Muskelzellen, in Fettzellen und in nahezu allen Geweben. Sie sind verantwortlich für Demenz, für Depression, für Hypertonus, Insulinresistenz und Diabetes Mellitus. Wir haben hier ein Korrelat für viele chronische Erkrankungen. Je mehr die Fettmasse zunimmt, desto höher das Erkrankungsrisiko. Diese Erkenntnis über den Zusammenhang von viszeralem Fett und chronischen Erkrankungen hilft uns, geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
Es gibt Experimente mit Ratten, die eine Insulinresistenz hatten. Den Tieren wurde das viszerale Fett operativ entfernt und keine 24 Stunden später, war der Diabetes weg. Das sind wahrscheinlich auch die Mechanismen warum metabolische Chirurgie so gut funktioniert, weil hierbei auch viszerales Fett entfernt wird. Wenn uns das viszerale Fett krank macht, das Leberfett bringt uns um. Bei Patienten, die 80, 90 oder sogar 100 g Leberfett angesetzt haben, wirkt eine Lebensstiländerung nicht mehr. Das sind Patienten, die ihren Lebensstil und ihre Ernährung ändern, und die sich mehr bewegen, ohne Erfolg. Das sind non-responder in Hinblick auf eine Lebensstilintervention und das ist schade, weil diese Patienten engagiert und motiviert sind, aber keine Wirkung erfahren.
Leberfett abbauen
Das viszerale Fettgewebe ist endokrin aktiv und produziert sehr viele freie Fettsäuren. Diese werden aus dem viszeralen Fett sezerniert, wenn wir uns jetzt mehr bewegen, wenn wir die Alltagsaktivität steigern, z.B. wenn wir 10.000 Schritten am Tag laufen. Dann werden Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt, die letztendlich dazu führen, dass freie Fettsäuren stärker verbrannt werden, das viszerale Fett abnimmt und chronische Erkrankungen verhindert werden.
Eine einfache wie wirkungsvolle Maßnahme gegen das Leberfett ist das Fasten. Wir sehen in rezenten Studien, dass wenn wir 2 Wochen lang keinerlei Energie aufnehmen, das Leberfett vollständig verschwindet. Alternativ können Ihre Patienten beim Fasten auch drei Wochen lang als 600 bis 800 Kilokalorien am Tag aufnehmen. Der Leberfett-Abbau lässt sich mit MR-Spektroskopieverfahren gut nachweisen.
Fasten ist wahrscheinlich der schnellste Zugewinn an Gesundheit den wir generieren können. Eine überaus wirkungsvolle Maßnahme zur Prävention, die künftig vermutlich noch an Bedeutung gewinnen wird.
Abbildung 8 zeigt die Insulinsignaltransduktionskaskade. Insulin dockt an den Rezeptor an, dann werden verschiedene Proteine angeschaltet oder phosphoryliert und am Ende wird der Glucoserezeptor zur Zellmembran transportiert und die Glucose in die Zelle eingeschleust. Alle in rot dargestellten Substanzen stammen aus dem viszeralen Fett und blockieren diesen Prozess. Letztendlich geht die Insulinresistenz auf das viszerale Fett zurück. Wenn es gelingt, dieses zu reduzieren, geht auch die Insulinresistenz zurück und damit auch ein zukünftiges Diabetesrisiko.
Wie können wir aus dem pathophysiologischen Verständnis heraus Maßnahmen zur Prävention des Diabetes Mellitus entwickeln?
In den vergangenen 20 Jahren wurden zahlreiche Studien an Patienten mit Prädiabetes oder gestörter Glucosetoleranz durchgeführt Dabei wurde der Frage nachgegangen, mit welchen Maßnahmen die Konversion zum Diabetes Mellitus verhindert werden kann. Jährlich entwickeln 5-8% der Patienten mit gestörter Glucosetoleranz einen Diabetes Mellitus.
Lebensstilinterventionen erwiesen sich dabei als hochgradig wirksam. Die relative Risikoreduktion liegt im Mittel bei 50%. Jeder zweite Diabetes läßt sich demnach mit einer Lebensstilintervention verhindern. Aber auch medikamentöse Therapien funktionieren, zum Teil sogar noch besser. Arzneimittel wirken jedoch nur gut, solange sie gegeben werden. Wird die Behandlung abgebrochen, steigt das Diabetesrisiko auf das Niveau der Vergleichsgruppe, die ein kontinuierlich erhöhtes Diabetesrisiko hat, an. Der gesamte Therapieeffekt geht auf einmal verloren. Diabetesmedikamente bieten insofern keine wirkliche Diabetesprävention, sondern Maskieren vor allem chronisch erhöhte Blutzuckerspiegel.
Die Lebensstiländerung kommt dagegen einer wirklichen Prävention eines Diabetes schon sehr nahe. Wenn wir den Lebensstil ändern führt das dazu, dass das viszerale Fett und das Leberfett zurückgehen. Damit erreichen wir die Wurzel dessen, was das Diabetesrisiko erhöht.
5 Kernziele der Prävention
Was wir aus den Studien noch gelernt haben ist, dass es 5 Ziele gibt, die evidenzbasiert eine Empfehlung darstellen, um Diabetes zu verhindern: Gewichtsreduktion, mehr körperliche Aktivität, mehr Ballaststoffe, weniger Fett und insbesondere weniger gesättigte Fettsäuren [6, 7].
Lindström und Kollegen haben die Ziele dahinhegend untersucht, wie additiv diese zueinander sind [8]. An 100 Patienten die jeweils 0 bis 5 Ziele umgesetzt hatten, wurde das jährliche Diabetesrisiko gemessen. Von den Menschen, die keines dieser Ziele umgesetzt hatten, entwickelten 8 % einen Diabetes. Hingegen entwickelte keiner der Patienten einen Diabetes, die alle 5 Ziele umgesetzt hatte (Abbildung 9).
Eine wichtige Erkenntnis der Studie ist, dass die Umsetzung der Ziele einen additiven Effekt hatte. Gesündere Ernährung kombiniert mit mehr Bewegung oder einer Gewichtreduktion, hat einen höheren Diabetespräventiven Effekt als eine einzelne Maßnahme.
Verhaltensveränderung: Modelle und Techniken
Lebensstiländerungen können das Diabetesrisiko nachhaltig reduzieren. Wie aber lassen sich gewünschte Änderungen herbeiführen? Der Ablauf solcher Veränderungsprozesse wurde in einem europäischen Projekt bei Menschen mit chronischen Erkrankungen untersucht [9].
Der Prozess vollzieht sich in drei Phasen: Die Phase der Motivation, die Phase der Aktion und die Phase der Aufrechterhaltung. Es ist entscheidend, im ärztlichen Gespräch mit dem Patienten oder der Risikoperson, phasengerecht oder phasenspezifisch unterschiedliche geeignete verhaltenstherapeutische Techniken einzusetzen und ihn dadurch zu assistieren, eine Lebensstiländerung umzusetzen. Einen Patienten, der schon zahlreiche Fehlversuche hatte, müssen wir anders unterstützen als jemanden, der mit seiner Situation an sich zufrieden ist und keine Notwendigkeit einer Veränderung sieht. Wenn wir allen Patienten nur die eine gleiche Maßnahme anbieten, dann profitieren davon etwa 11 %.
Diese Fortbildung soll Sie motivieren, Techniken wie motivierende Gesprächsführung oder aktives Zuhören, Methoden von denen sie alle bereits gehört haben, erneut auszuprobieren. Sie werden sehen, es funktioniert tatsächlich. Es kostet Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit das zu erlernen, es kostet Sie vielleicht eine halbe Minute das anzuwenden, aber es erspart Ihnen am Ende Stunden im Umgang mit dem Patienten. Aber es erfordert auch die Bereitschaft, mit dem Patienten etwas mehr auf Augenhöhe umzugehen.
Bedarfsanalyse
Eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes ist das Sweet-Smart-Konzept, in dem wir eine dritte Dimension ergänzt haben die berücksichtigt, was den Patienten antreibt, seinen Lebensstil zu ändern (Abbildung 10).
Als Ärzte beurteilen wir vordringlich, wie krank der Patient ist. Es ist aber häufig nicht die Krankhaftigkeit, die den Patienten motiviert etwas zu ändern, sondern es spielen andere Faktoren eine viel wichtigere Rolle. Das ist z.B. die Bereitschaft den Lebensstil zu ändern. In welcher Phase der Bereitschaft zur Lebensstiländerung befindet sich der Patient (1. Dimension)? Das definiert sehr gut, mit welcher Maßnahme wir den Patienten erreichen oder assistieren können seinen Lebensstil zu verändern. Als wichtige 2. Dimension müssen die individuellen Präferenzen, die individuellen Bedürfnisse des Patienten berücksichtigt werden. Die 3. Dimension beschreibt die Progression seiner Erkrankung. Nur wenn wir alle drei Dimensionen zusammennehmen, können wir den Patienten mit seinen Bedürfnissen korrekt beschreiben. Unsere Maßnahmen für eine Lebensstiländerung müssen sich an den eigentlichen Bedürfnissen des Patienten ausrichten.
Dieser Ansatz lässt sich noch weiterführen. Aufbauend auf dem dargestellten dreidimensionalen Modell haben wir ein Assessment mit bis zu 20 Fragen entwickelt. Diese Fragen helfen uns dabei zu verorten, was hat der Patient für Bedürfnisse hat und wo er sich derzeit befindet. Das Ganze führt schnell zu 100 verschiedenen Maßnahmen, die uns für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen. Das können unterschiedliche Therapien sein, unterschiedliche Lebensstilinterventionen, unterschiedliche digitale Apps und so weiter. Ein solches Assessment kann uns schnell und effektiv helfen herauszufinden, was dem Patienten wirklich am besten hilft.
Es liegt auf der Hand, das beschriebene Maßnahmenportfolio mit Hilfe digitaler Instrumente zu ergänzen. Viele Patienten messen ihr Gewicht, speichern ihre Schrittzahl, beobachten ihren Blutzucker, ihren Blutdruck und vieles mehr. Viele dieser digital erfassten Daten können wir mit den Bedürfnissen des Patienten kombinieren, um bessere therapeutische Strategien, ein besseres Diabetesmanagement, ein besseres Chronic Care Management und neue Therapieverfahren für den Patienten zu entwickeln.
Beispielhaft für ein solches digitales Programm ist eine Initiative, die wir vor einiger Zeit gestartet haben. Eine digitale Patientenakademie. Hierbei schulen wir Patienten bedürfnisorientiert über das Smartphone. Einem Patienten mit einer Hypo- oder Hyperglykämie zeigen wir einen kurzen Erklärfilm von 2 bis 3 Minuten, der ihm hilft, damit umzugehen. Den Film kann er sich beliebig oft anschauen, ganz nach seinen Bedürfnissen. Eine solche Maßnahme kann insbesondere für die Prävention interessant sein, weil wir hierdurch Patienten mit neuen digitalen Medien gezielt bedürfnisorientiert erreichen und ihnen helfen, langfristig ihren Lebensstil zu ändern.
Bedarf decken
Wenn wir effektiv Prävention betreiben wollen, dann müssen wir uns viel stärker am Bedarf des Patienten, der Risikoperson orientieren. Wir müssen uns die Denkweise beispielsweise der Coca-Cola Company aneignen. Diese Firmen rekrutieren ein Panel von Personen und fragen, welche Bedürfnisse diese Personen haben. Im besten Fall ist das ein Bedarf, von dem der Mensch noch gar nicht weiß, dass er ihn hat. Dann ermitteln die Firmen, was der Mensch bereit ist dafür zu bezahlen und überlegen, welches Produkt sie dafür entwickeln können.
Wir in der Medizin gehen immer den umgekehrten Weg. Wir haben ein Produkt, zum Beispiel ein neues Medikament, und überlegen dann erst, wie wir den Patienten überzeugen können das Präparat einzunehmen. Häufig überlegen wir nicht einmal, sondern verschreiben es schlichtweg.
In der Prävention müssen wir jedoch überzeugen. Dazu müssen wir besser verstehen, welchen Bedarf die Risikoperson hat. Und wir müssen uns bei der Entwicklung von Präventionsmaßnahmen davon leiten lassen, diesen - zum Teil auch intuitiven - Bedarf zu decken. Das können wir nur schaffen, wenn wir umdenken und das bedeutet, wir müssen damit beginnen, echte Produkte zur Prävention zu entwickeln.
Präventionsparadox
Als Wissenschaftler sind wir von Evidenz getrieben. Wir bemühen uns nicht darum ein Produkt zu entwickeln, sondern wir halten eine Maßnahme für indiziert, wenn evidenzbasiert ist. Geschäftsleute und Unternehmer legen häufig keinen Wert auf die wissenschaftliche Evidenz. Die Firmen möchten ein Produkt entwickeln, das der Verbraucher tatsächlich kauft (Abbildung 11) [10].
Würde man beide Ansätze zusammenbringen, die Evidenz und die Bedürfnisse der Verbrauchers, dann würde das zu Präventionsprodukten führen, die tatsächlich eine nachhaltige Prävention leisten kann.
Und es gibt sie bereits, die einzigartige Maßnahme die dazu führt, dass sich Fitness und Body Mass Index verbessern, Blutzucker und Blutdruck sinken, der Taillenumfang schmaler wird, sich die Insulinwirkung verbessert und sogar das Schlaganfallrisiko zurückgeht. Dieses Produkt wurde eingangs bereits vorgestellt: es sind die 10.000 Schritte. 10.000 Schritte am Tag zu laufen ist eine Strategie die uns wirklich gesunderhalten oder gesund machen kann.
Die Datenlage hierzu ist gut. Ab 10.179 Schritten kristallisiert sich die Evidenz heraus [11]. „10.000 Schritte“ ist die griffigere Botschaft. Sie ist leicht verständlich und vom Rezipienten gut umzusetzen, z.B. mit Hilfe von Schrittzählern. Wenn Sie einen Schrittzähler tragen und dreimal täglich auf die Schrittzahl schauen, hat das eine beeindruckende Wirkung. Am Ende des Monats laufen Sie 3.000 Schritte am Tag mehr als ohne Zähler, unabhängig vom Ausgangsniveau. Alleine die Schrittzahl zu sehen stellt ein effektives Feedback dar.
Nicht ich
Das wirkt bei jedem unserer Patienten, das wirkt sogar bei uns Ärzten. Leider sind wir Mediziner allzu häufig kein gutes Vorbild. Eingangs hatte ich aufgezeigt, dass 87 % der Patienten uns Glauben schenken. Stellen Sie sich vor, Sie selbst würden einen Schrittzähler tragen, würden das Ihrem Patienten zeigen und dem Patienten am Ende sogar noch einen Schrittzähler mitgeben. Das hätte wahrscheinlich eine sehr nachhaltige Wirkung.
Letztendlich denken und handeln wir aber wie unsere Patienten: „Nein, nicht ich. Der Nachbar gegenüber, der sollte sich mehr bewegen. Mich betrifft das nicht“. Wir sind elegant geeignet, uns nicht zu bewegen und dieses nicht bewegen als Lebensqualität wahrzunehmen. Dagegen anzugehen ist schwierig.
Untersuchungen zeigen: es ist nicht die Zeit, die uns fehlt, uns nicht zu bewegen, sondern es ist die Motivation. Bewegung ist nicht unsere Präferenz. Auf der anderen Seite die Zeit dafür wäre da.
Was uns antreibt
Wenn wir Motivation untersuchen, gibt es zwei Strategien. In der Medizin motivieren wir in der Regel indem wir dem Patienten einen Effekt versprechen. Wir sagen, wenn du dies oder jenes machst, dann bleibt dir diese oder jene Erkrankung in Zukunft erspart. Krankenkassen bieten Bonusprogramme an und versuchen, über einem Zugewinn zu motivieren.
Es gibt aber auch noch eine ganz andere Strategie, die vor allem in der Geschäftswelt verbreitet ist: die Verlustaversion. Wenn man Motivation über das Gewinnen und Motivation über Verlustaversion miteinander vergleicht, ist die Verlustaversion 3x stärker. Das heißt wir sind viel eher bereit, auf einen potentiellen Gewinn zu verzichten, als uns etwas wegnehmen zu lassen und einen Verlust zu erleiden.
Das Anker-Prinzip
Wir haben eine Strategie entwickelt, die Menschen motivieren soll, Verhalten zu ändern: Das Anker-Prinzip – Motivation durch monetäre Incentivierung.
Beim Anker-Prinzip wird eine Wette auf das Erreichen eines Ziels abgeschlossen und ein kleiner Geldbetrag eingesetzt. Der Patient wettet beispielsweise darauf, sich gesünder zu ernähren oder sich mehr zu bewegen. Er wettet darauf, 10.000 Schritte am Tag zu laufen. Durch den Vorsatz „Ich wette darauf“ verankert er über die Wette die Motivation für das Erreichen dieses Ziels. Der monetären Anker soll ihn zudem verpflichten, das Ziel zu erreichen.
Das Anker-Prinzip kombiniert somit zwei Motivationsstrategien: Die Aussicht auf den Verlust des Einsatzes sowie die Aussicht auf einen Zugewinn bei Zielerreichung.
Wir haben das Anker-Prinzip in einer kleinen Studie mit 64 Teilnehmern getestet. Hierzu sollten alle Teilnehmer die DGE-Empfehlung „5 am Tag“, also 3x Gemüse und 2x Obst, über drei Monate einhalten. Wir haben die Kandidaten in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe sollte ihr Essen fotografieren und in einer WhatsApp Gruppe teilen. Hierfür gab es Punkte in Form von Facebook-Daumen wenn die geforderte Anzahl an Portionen erreicht war. Ein zusätzlicher Anreiz wurde den monetären Wetteinsatz geschaffen, den die Teilnehmer täglich innerhalb der Gruppe gepostet haben. Die Kontrollgruppe sollte ebenfalls „5 am Tag“ umsetzen, zur Dokumentation aber lediglich eine Strichliste führen.
In der Gruppe, die mit Strichliste gearbeitet hat, haben die Teilnehmer ihren Schnitt von 2,2 Portionen auf 2,7 Portionen Obst und Gemüse am Tag gesteigert. Insgesamt haben nur 12 % der Teilnehmer das Ziel von 5 Portionen an Tag erreicht. Hingegen konnten die Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe ihre täglichen Portionen von 2,4 auf 5,4 Portionen steigern und 96 % der Teilnehmer hatten das Studienziel „5 am Tag“ erreicht.
Der Einsatz eines Wettmodells unterstützt durch eine einfache App (WhatsApp) hat dazu geführt, das die Teilnehmer kontinuierlich über 3 Monate einen gesunden Lebensstil geführt haben. Hierdurch entstanden keine zusätzlichen Kosten, da die Teilnehmer eigenes Geld investiert und darauf gewettet hatten.
Der Erfolg in der Pilotphase hat uns angespornt, unser Anker-Prinzip in einer eigenen App umzusetzen. Eine Recherche der am Markt bereits etablierten Apps für Bewegung zeigte, dass diese zum Teil ebenfalls über Motivationsansätze wie Feedback, Gamification oder Trainingspläne verfügten, aber nur wenige Bewegungs-Apps, auf monetärer Incentivierung bauten, um selbst gesteckte Ziele, wie eine nachhaltige Lebensstiländerung, zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund haben wir die Präventionsapp „AnkerSteps“ entwickelt (Abbildung 12). Der Teilnehmer wettet darauf, 10.000 Schritte am Tag zu erreichen und bestimmt einen Einsatz, z.B. 1 Euro. Erreicht er das Bewegungsziel nicht, verliert er den Wetteinsatz, also reales Geld. Wenn er es aber schafft, die 10.000 Schritte zu laufen, gewinnt er seine Wette und behält seinen Einsatz.
Zusätzlich wird er mit einem Gewinn belohnt, der aus den verlorenen Wetteinsätzen anderer AnkerSteps Teilnehmer ermittelt wird. Anders ausgedrückt: der Wetteinsatz der Verlierer finanziert den Bonus der Gewinner, eine einfache Umverteilung.
Wir haben die Nutzung der App analysiert und konnten nachweisen, dass sich die aktiven Nutzer der App 7x mehr am Tag bewegen als Nichtnutzer. Als weitere Funktion bietet die App evidenzbasierte Gesundheitsinformationen von Experten, darunter Ärzte, Sport- und Ernährungswissenschaftler und Präventionsmanager.
AnkerSteps besitzt Schnittstellen zu allen großen sozialen Netzwerken. Hierüber kann der Nutzer z.B. Freunde einladen gemeinsam zu laufen oder im Wettbewerb gegeneinander antreten, was einen zusätzlichen Motivationsschub bewirken kann. Die App arbeitet völlig automatisiert. Sie zählt die Schritte nicht einmal selbst, sondern sie synchronisiert die Schrittzahl mit Apps die auf dem Smartphone vorinstalliert sind oder synchronisiert sich mit häufig benutzen Fitness-Trackern. Die Abrechnung der Wetteinsätze erfolgt im Hintergrund über den Bezahldienst PayPal.
Zusammenfassung:
Bewegung ist eines der stärksten und effektivsten Instrumente zur Prävention chronischer Erkrankungen. 10.000 Schritte täglich ab dem 25. Lebensjahr können Diabetes, Depression, Demenz, Adipositas, Insulinresistenz oder Hypertonie verhindern. Nur 1.000 Schritte täglich senken den postprandialen Blutzuckerspiegel doppelt so stark ab wie 1000 mg Metformin.
Dennoch bewegt sich die Mehrzahl der Deutschen zu wenig, im Durchschnitt nur 2700 Schritte am Tag. Bewegungsmangel in Verbindung mit fettreicher Nahrung, zu viel Zucker, aber auch von Zuckerersatzstoffen, steigert das Diabetes-Risiko.
Dieses Verhalten zu ändern ist eine große Herausforderung. Effektive Prävention setzt daher bei den individuellen Bedürfnissen der Risikopersonen an. Durch die Kombination unterschiedlicher Motivationsstrategien im Rahmen eines „Präventionsprodukts“, unterstützt durch Motivations- und Bewegungs-Apps wie „
AnkerSteps“, kann dies nachhaltig gelingen.
Literatur:
1. Sassi F et al. Improving Lifestyles, Tackling Obesity: The Health and Economic Impact of Prevention Strategies. OECD Health Working Papers (2009) No. 48, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/220087432153
2. Qiao Q et al. J Clin Epidem (2004); 57(6): 590-596;
3. Whitmer RA et al., JAMA (2009); 301(15): 1565-1572
4. InterAct, C., et al. Diabetologia, 2013.
5. Klöting et al., Der Internist 2007
6. Schwarz P et al. TUMAINI Präventionsprogramm, Diabetes und Stoffwechsel 09/2003
7. Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001; 344: 1343-50
8. Lindström J et al. Horm Metab Res. 2010; 42 (Suppl 1): S37–S55.
9. Greaves CJ et al. BMC Public Health. 2011 Feb 18;11(1):119.
10. Schwarz P et al. DiabCare 2016;39(Suppl. 2):S121–S126 | DOI: 10.2337/dcS15-3001
11. Schwarz P et al. Nat Rev Endocrinol. 2012