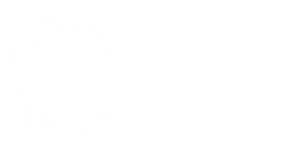Diabetes und Auge – die Routine durchbrechen
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie ...
- die zentrale Rolle der Entzündung bei DMÖ,
- die zentrale Rolle der Entzündung bei DMÖ,
- verfügbare Therapieoptionen und Gründe für ein unzureichendes Ansprechen,
- mögliche Biomarker für Entzündung, Chronizität und Visusprognose,
- den Unterschied zwischen erhöhtem Augeninnendruck und Glaukom.
Einleitung
Diabetes mellitus stellt schon heute eine der größten Herausforderungen für die Gesundheitssysteme dar – und die Tendenz ist steigend: Derzeit weisen in Europa etwa 66 Millionen Erwachsene (20 bis 79 Jahre) einen Diabetes mellitus auf, bis 2050 ist mit einem weiteren Anstieg auf 72 Millionen zu rechnen. Besonders fatal: Etwa ein Drittel der Betroffenen ist unterdiagnostiziert. Dies hat weitreichende Folgen für verschiedene medizinische Disziplinen, da die im Verlauf auftretende chronische Hyperglykämie – zunächst meist schleichend und unbemerkt – Makro- und Mikroangiopathien verursacht. Diese wiederum führen zu Schädigungen von Herz und Blutgefäßen, Nieren, Nerven, Zähnen und Augen.
Augenbefunde regelmäßig kontrollieren
Die Nationale Versorgungsleitlinie zur Prävention und Therapie von Netzhautkomplikationen empfiehlt daher bei allen erwachsenen Patienten mit Typ-2-Diabetes bei der Erstuntersuchung ein augenärztliches Screening sowie mindestens alle zwei Jahre augenärztliche Kontrolluntersuchungen. Sobald erste diabetische Veränderungen der Netzhaut festgestellt werden, sollten die Kontrollintervalle auf mindestens einmal jährlich verkürzt werden. Dennoch scheinen ophthalmologische Untersuchungen bislang immer noch viel zu selten zu erfolgen: Gemäß den Erhebungen großer Krankenkassen hat selbst nach etwa zweijähriger Erkrankungsdauer nur die Hälfte der Patienten mit Diabetes eine Untersuchung beim Augenarzt wahrgenommen. Und dies, obwohl ein Sehkraftverlust auch für Patienten die am meisten gefürchtete Komplikation darstellt – noch vor den kardiologischen und renalen Komplikationen.
Häufigste mikrovaskuläre Komplikation: DMÖ
Zudem ist die diabetische Retinopathie (DR), in deren Verlauf jederzeit ein DMÖ entstehen kann, eine der häufigsten mikrovaskulären Komplikationen bei Patienten mit Diabetes mellitus – und gleichzeitig die Hauptursache für schwere Sehbehinderungen und Erblindung im erwerbsfähigen Alter. Bereits bei Diagnosestellung weisen 2 bis 16 % aller Menschen mit Typ-2- Diabetes eine DR auf. Bei Typ-1-Diabetikern entwickeln sich die Netzhautveränderungen nach einer Erkrankungsdauer von 15 bis 20 Jahren. Um die Sehkraft von Patienten mit DR und DMÖ zu erhalten oder sogar wieder zu bessern, ist eine rasche Diagnosestellung sowie eine konsequente und individualisierte Langzeittherapie erforderlich. Dazu steht eine umfangreiche Palette aus verschiedenen Anti-VEGF-Wirkstoffen, Kortikosteroiden, Lasertherapien und chirurgischen Optionen zur Verfügung. Für Patienten mit einem DMÖ mit fovealer Beteiligung und Visusminderung ist derzeit eine intravitreale Medikamentengabe (IVOM) von Anti-VEGF-Wirkstoffen die empfohlene Therapie, während Kortikosteroide weiterhin eine wichtige Behandlungsoption bei chronisch persistierendem DMÖ darstellen.
Unterbehandlung gefährdet Sehvermögen
Allerdings können Behandlung und Erhalt der Sehkraft im klinischen Alltag auf lange Sicht aus mehreren Gründen schwierig sein: Viele Patienten weisen aufgrund der Grunderkrankung Diabetes und zusätzlicher Begleiterkrankungen eine komplexe Krankengeschichte auf und sind durch zahlreiche Termine sowie Medikamente bereits erheblich belastet. Daher stellt die Therapietreue, ein entscheidender Faktor für den Behandlungserfolg, bei der Versorgung von Patienten mit Diabetes oftmals eine Herausforderung dar. Verschiedene Real-World-Studien zeigen übereinstimmend, dass eine regelmäßige Einhaltung der Anti-VEGF-Therapie im klinischen Alltag oftmals schwierig ist und Patienten weniger Injektionen als in klinischen Studien erhalten. Laut Versorgungsdaten aus den USA brachen 52 % der Patienten mit DMÖ eine Anti-VEGF-Behandlung nach durchschnittlich sechs Monaten in der klinischen Praxis ab. Zwar nahm ein Drittel der Patienten die Therapie wieder auf, allerdings gefährden Behandlungsunterbrechungen langfristig die Sehschärfe und erhöhen das Risiko für eine Progression der Erkrankung. Ein weiterer Grund für die nicht ausreichende Therapietreue gegenüber der Anti-VEGF-Therapie kann auch ein nur unzureichendes Ansprechen sein: Je nach verwendetem Medikament sprechen etwa 30 bis 65 % der Patienten mit DMÖ nur unzureichend oder stark verzögert auf die Anti-VEGF-Behandlung an. Dies scheint auch bei den kürzlich eingeführten Anti-VEGF-Wirkstoffen mit längerer Wirkdauer unverändert zu bleiben.
Wo kommt das DMÖ her?
Ein wesentlicher Faktor für dieses begrenzte Ansprechen ist die multifaktorielle und komplexe Pathophysiologie des Makulaödems, bei der Entzündungsmechanismen eine zentrale Rolle spielen. Häufiger Auslösemechanismus ist nach derzeitigem Verständnis eine Minderdurchblutung, die durch die mikrovaskulären Veränderungen infolge des Diabetes verursacht wird. Die in der Folge auftretende Hypoxie ist ein starker Stimulus für verschiedene entzündliche Mechanismen. Dabei ist die entzündliche Komponente bei Makulaödemen oft ausgeprägter und länger anhaltend als die VEGF-Komponente. So zeigen Untersuchungen am Tiermodell, dass eine Hypoxie zu einem Anstieg von VEGF und Entzündungsparametern führt. Während VEGF auf das Dreifache ansteigen und bereits nach einem Tag wieder auf einem normalen Level sind, steigen die Entzündungsparameter auf das 120-Fache an und normalisieren sich erst nach 14 Tagen. Dies induziert erstens Veränderungen der Endothelzellen und einen Wasseraustritt aus den Gefäßen in die Retina und führt zweitens zu einer Störung der Kalium-Wasser-Kanäle in Müller-Zellen. So kann deren intrazellulärer Wassergehalt nicht mehr reguliert werden, es kommt zu einem intrazellulären Ödem. Anti-VEGF-Medikamente reduzieren die VEGF-Expression, haben allerdings kaum Einfluss auf Entzündungsfaktoren und Müller-Zellen. Kortikosteroide hingegen haben kaum Einfluss auf die VEGF-Hochregulation, reduzieren allerdings signifikant entzündliche Parameter und sorgen für eine Regeneration der Müller-Zellen. Auch jüngste Forschungsergebnisse unterstreichen die Schlüsselrolle der Entzündung in der komplexen Pathophysiologie des DMÖ und positionieren sie als wichtiges therapeutisches Ziel.
Von Pixeln zu Prognosen
Wünschenswert wäre, eine differenziertere Einschätzung der Erkrankung vornehmen zu können, um eine individuelle Therapieplanung und Visusprognose abzuschätzen und mit dem Patienten besprechen zu können. Als unverzichtbares diagnostisches Verfahren hat sich beim DMÖ die optische Kohärenztomografie (OCT) etabliert und mit der OCT-Angiografie (OCTA) dazu beigetragen, eine Vielzahl morphologischer Veränderungen in der Netzhaut sichtbar zu machen – von Flüssigkeitsansammlungen über degenerative Strukturen bis hin zu subtilen Gefäßveränderungen. Die OCT liefert eine hochauflösende, nicht invasive Darstellung der Netzhautschichten und dadurch sowohl quantitative als auch qualitative Informationen zum Ausmaß und zur Struktur des Ödems. Zudem ermöglicht die OCT eine präzise Identifikation feinster morphologischer Veränderungen, die Lokalisation und Quantifizierung retinaler Flüssigkeitsansammlungen und die Beurteilung der Integrität einzelner Netzhautschichten. Damit spielt sie eine zentrale Rolle in der individuellen Therapieplanung und im Monitoring des Behandlungserfolges. Neben der strukturellen Bildgebung zur Diagnose und Verlaufskontrolle bietet die OCT heute vor allem eines: die Möglichkeit, spezifische morphologische Merkmale zu identifizieren, die Rückschlüsse auf Krankheitsaktivität, Entzündungsprozesse oder Prognose zulassen.
Biomarker für individualisierte Therapie?
Zahlreiche dieser morphologischen Merkmale wurden in den letzten Jahren als potenzielle Biomarker identifiziert mit dem Potenzial, die Therapiewahl zu individualisieren und dadurch langfristige Ergebnisse zu verbessern. Im klinischen Alltag kann die Berücksichtigung der im Folgenden beschriebenen fünf Biomarker für Inflammation, Chronizität und Visusprognose hilfreich sein. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich Ansprechen und Prognose nicht anhand eines einzelnen Biomarkers abschätzen lassen. Vielmehr sollte das Zusammenspiel mehrerer Biomarker auch im Zusammenhang mit der Gesamtsituation in die Beurteilung einfließen. Diesbezüglich kann zukünftig möglicherweise der zusätzliche Einsatz von künstlicher Intelligenz noch konkrete Aussagen ermöglichen.
OCT-Biomarker für Inflammation und Chronizität
Ein wichtiger Biomarker im klinischen Alltag ist das Vorhandensein von großen (>250 µm) intraretinalen Zysten. Dabei handelt es sich um flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Bereich der Makula, die je nach ihrer Lage innerhalb der Netzhautschichten und nach ihrer Größe beurteilt werden können. Das Vorhandensein von großen Zysten korreliert mit stärkeren Schäden in der äußeren Netzhaut und liefert einen Hinweis auf eine schlechte Visusprognose. Zudem sind sie mit einer längeren Krankheitsdauer und einem chronischen DMÖ assoziiert und werden als Zeichen eines chronischen DMÖs angesehen. Es wird postuliert, dass chronische Ödeme mit großen intraretinalen Zysten von einer Behandlung mit intravitrealen Steroiden mehr profitieren könnten als von einer Behandlung mit Anti-VEGF-Substanzen. Einen Hinweis auf eine verstärkte Inflammation liefern sie außerdem dann, wenn sie im Zusammenhang mit vielen hyperreflektiven Foci (HRF) auftreten. Dabei handelt es sich um kleine (ca. 30 µm), scharf begrenzte, punktförmige Läsionen im OCT, die ein vergleichbares oder höheres Reflexionsvermögen im Vergleich zum retinalen Pigmentepithel aufweisen. Zwar ist ihr Ursprung noch nicht vollständig geklärt, einige Studien legen allerdings nahe, dass HRF aktivierte Mikrogliazellen und somit einen Biomarker für Entzündungen darstellen. Zudem gelten sie auch als Biomarker für Chronizität und eine schlechte Visusprognose. Mehrere Studien schlussfolgern, dass in Fällen mit vielen HRF die Anwendung von intravitrealen Steroiden von Vorteil ist. Auch eine größere Menge und länger bestehende subretinale Flüssigkeit (SRF), d. h. eine Flüssigkeitsansammlung zwischen retinalem Pigmentepithel und neurosensorischer Retina, scheint mit einer verstärkten inflammatorischen Komponente einherzugehen, sodass ein Einsatz von Steroiden sinnvoll sein kann. Vor allem bei chronischem, länger bestehendem DMÖ mit SRF oder großen intraretinalen Zysten sollten nach Udaondo et al. Steroide den Anti-VEGF-Substanzen vorgezogen werden.
Biomarker für Visusprognose
Die zentrale Netzhautdicke (CMT, „central macular thickness”) ist im klinischen Alltag ein häufig eingesetzter Biomarker zur Diagnose und spielt im Therapiemonitoring eine entscheidende Rolle. Ihre prognostische Aussagekraft vor Beginn der Therapie ist jedoch begrenzt. Diesbezüglich gibt es widersprüchliche Studienergebnisse. Manche Publikationen nennen eine initial große CMT (>400 µm), die häufig auch mit großen intraretinalen Zysten einhergeht, als Biomarker für eine schlechte Visusprognose. Größere Aussagekraft scheint die Veränderung der Netzhautdicke unter Therapie zu haben: So scheint eine fehlende Abnahme nach Therapiebeginn mit einer schlechteren Prognose einherzugehen, während eine suffiziente frühe Abnahme der zentralen Netzhautdicke (>20 %) unter Therapie mit einer besseren funktionellen Langzeitprognose verbunden zu sein scheint. Bei der Vorhersage des morphologischen Ansprechens auf eine Anti-VEGF- bzw. intravitreale Kortikosteroidtherapie ist die CMT nicht hilfreich. Die sogenannte „disorganisation of the retinal inner layers” (DRIL) korreliert stark mit einem schlechteren Visusergebnis. In diesen Arealen sind die inneren Netzhautschichten nicht mehr klar abgrenzbar, was für eine Auflösung der normalen retinalen Struktur spricht – möglicherweise als eine Folge häufiger und chronischer Ödeme. Sie gelten daher auch als Marker für Chronizität. DRIL kann sich jedoch unter intravitrealer Therapie zurückbilden. Ein frühes Zurückbilden in den ersten drei Monaten der Therapie spricht für eine Regeneration und ist mit einem besseren funktionellen Langzeitergebnis assoziiert. Fehlt diese Verbesserung unter der Anti-VEGF-Behandlung, sollte ein frühzeitiger Wechsel zu Steroiden in Betracht gezogen werden. Ebenso deutet – wie bereits beschrieben – auch das Auftreten vieler HRF auf eine schlechte Visusentwicklung hin. Darüber hinaus sind auch eine durch OCT-Angiografie darstellbare, vergrößerte foveale avaskuläre Zone (FAZ) und eine reduzierte Gefäßdichte mit einem herabgesetzten Visus assoziiert.
Biomarker und Therapiewahl im Überblick
Empfehlungen zum Einsatz von Biomarkern zur Therapieplanung sind zwar bislang noch nicht in Leitlinien eingeflossen, werden allerdings bereits in mehreren Konsensusartikeln von Expertenpanels beschrieben. So wird ein frühzeitiger Einsatz von Kortikosteroiden (unter Berücksichtigung der Gesamtsituation und des Linsenstatus) insbesondere in Fällen mit einer stärkeren inflammatorischen oder chronischen Komponente empfohlen, da diese eine Vielzahl entzündungshemmender Wirkmechanismen entfalten und mehrere Ziele adressieren, während eine Anti-VEGF-Therapie vorwiegend auf die Senkung der VEGF-Spiegel abzielt. Insgesamt werden übereinstimmend das Vorliegen vieler hyperreflektiver Foci, große intraretinale Zysten sowie eine umfangreiche und anhaltende subretinale Flüssigkeit als relevante Biomarker zur Erwägung eines frühen Switchs auf Kortikosteroide genannt.
Wege durch den Therapiedschungel
Wie bereits erläutert, steht zur Behandlung einer DR und eines DMÖ heute eine große Bandbreite an Optionen zur Verfügung. Wesentliche Grundlage stellt immer eine gute Einstellung des Stoffwechsels und die Modifikation bestehender Risikofaktoren dar. Darauf aufbauend stehen je nach Befund verschiedene Wirkstoffe und Therapiekonzepte zur Verfügung, um den Visus langfristig zu erhalten und weitere Komplikationen zu vermeiden. Bei Patienten mit mildem DMÖ und noch guter Sehschärfe kann bei adäquater glykämischer Einstellung und regelmäßigen ophthalmologischen Kontrollen zunächst auch die Beobachtung („watch and control”) eine geeignete Behandlungsstrategie sein. Bei Patienten mit DMÖ mit fovealer Beteiligung und Visusminderung erfolgen in der Regel wiederholte intravitreale Anti-VEGF-Injektionen, wobei die Therapie möglichst frühzeitig und intensiv begonnen werden sollte. Dazu stehen mittlerweile zahlreiche Anti-VEGF-Wirkstoffe, teils mit verlängerter Wirkdauer, sowie auch Biosimilars zur Verfügung. Bei gutem Ansprechen können im weiteren Therapieverlauf die Behandlungsintervalle verlängert und so die Behandlungslast reduziert werden. Allerdings sprechen nicht alle Patienten mit DMÖ gleichermaßen auf eine Anti-VEGF-Behandlung an. Bei ausbleibender Verbesserung oder mangelnder Befundstabilität kann der Umstieg auf eine intravitreale Kortikosteroidtherapie eine echte Chance für die Patienten darstellen. Dazu stehen in Deutschland mit einem Dexamethason-Implantat und einem langwirksamen Fluocinolonacetonid(FAc)-Implantat zwei Optionen zur Verfügung.
Kortikosteroidtherapie – wann und für welche Patienten?
Selbst bei Non-Respondern einer Anti-VEGF-Therapie verspricht die Kortikosteroidtherapie aufgrund ihres multifaktoriellen Wirkansatzes oft noch einen Behandlungserfolg. Wesentlich dafür ist ein rechtzeitiger Wechsel auf Kortikosteroide. Die europäische Leitlinie empfiehlt, bei unzureichender Visusbesserung bereits nach drei bis sechs Anti-VEGF-Injektionen (je nach individuellem Ansprechen des Patienten) auf eine Kortikosteroidtherapie umzustellen. Bei Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko ist die Kortikosteroidtherapie sogar als First-Line-Therapie zu erwägen, da sie – im Gegensatz zur Anti-VEGF-Therapie – keine systemischen Nebenwirkungen nach sich zieht. Weiterhin kann auch bei Patienten mit schlechter Therapieadhärenz, die nicht bereit oder in der Lage sind, die initialen monatlichen Anti-VEGF-Injektionen einzuhalten, eine Kortikosteroidtherapie als First-Line-Therapie erwogen werden, um den Behandlungserfolg zu sichern. Auch beim Vorliegen von Biomarkern für Inflammation und Chronizität kann – wie zuvor bereits beschrieben – eine möglichst frühzeitige intra-vitreale Kortikosteroidtherapie sinnvoll sein. Aufgrund der erhöhten Neigung zur Kataraktentwicklung ist die Kortikosteroidtherapie bevorzugt bei Pseudophakie oder absehbarer Kataraktoperation anzuwenden. Ist eine Kortikosteroidtherapie geplant, sollten alle Patienten über einen möglichen Augeninnendruckanstieg bzw. eine Kataraktentwicklung informiert und auf die Bedeutung regelmäßiger Kontrollen hingewiesen werden. Insbesondere bei jüngeren Patienten sollten diese Nebenwirkungen sorgfältig gegenüber einem irreversiblen Netzhautschaden bzw. einer Visusbeeinträchtigung durch das DMÖ abgewogen werden. Dabei ist auch zu bedenken, dass sich ein Augeninnendruckanstieg meist medikamentös gut behandeln lässt und bei Patienten mit Diabetes das Kataraktrisiko ohnehin um 20 % erhöht ist und dass sie nach einer Kataraktoperation in der Regel wieder den Visus vor der Kataraktentwicklung erreichen.
Befundstabilität nach Umstieg auf Kortikosteroidtherapie
Die Umstellung auf eine intravitreale Kortikosteroidtherapie kann zu Befundstabilität und deutlich reduzierter Behandlungslast führen, wie ein Fallbeispiel aus unserem klinischen Alltag (PD Dr. Catharina Busch) zeigt. Eine 57-jährige Patientin mit schwerer nicht proliferativer DR und panretinaler Laserkoagulation bilateral, die bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr an Diabetes mellitus leidet, wurde 2012 aufgrund einer Visusverschlechterung durch ein DMÖ bei uns vorstellig. Eine intensive Anti-VEGF-Behandlung (15 Injektionen in 24 Monaten) brachte zwar eine vorübergehende Besserung, allerdings mehrfach gefolgt von Rezidiven. Auch nach zwei Jahren war trotz intensiver Behandlung keine Befundstabilität erreicht. Dementsprechend entschieden wir uns im März 2014 gemeinsam mit der Patientin für die Implantation eines lang wirksamen FAc-Implantates im Rahmen der IRISS-Studie. Bereits drei Monate nach der Implantation war eine deutliche anatomische Verbesserung eingetreten, die im weiteren Verlauf sehr langfristig aufrechterhalten wurde. Ein vorübergehender Augeninnendruckanstieg war mithilfe zeitweiser topischer Medikation gut kontrollierbar. Im Dezember 2015 kam es zu einer Kataraktentwicklung und einem Abfall des Visus, der nach Kataraktoperation wieder auf 0,63 dezimal anstieg. Insgesamt wurde bei dieser Patientin nach Umstellung auf das FAc-Implantat über acht Jahre eine Befundstabilität ohne weitere Behandlungen erreicht. Ein im März 2022 aufgetretenes Rezidiv des DMÖ wurde mit einer zweiten FAc-Implantation behandelt. Erneut wurden eine deutliche anatomische Verbesserung und Befundstabilität erreicht und bislang aufrechterhalten.
Erhöhter IOD ist kein Glaukom
Im klinischen Alltag gilt es, mögliche Nebenwirkungen einer intravitrealen Kortikosteroidtherapie wie etwa eine IOD-Erhöhung angemessen gegenüber den möglichen Therapieerfolgen abzuwägen. Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass ein erhöhter IOD zwar ein wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung eines Glaukoms ist, das zwischenzeitliche Auftreten eines erhöhten IOD aber nicht mit dem Vorliegen eines Glaukoms gleichzusetzen ist. Vielmehr handelt es sich beim Glaukom um eine neurodegenerative, altersbedingte Erkrankung des Sehnervs, die durch verschiedene Risikofaktoren beeinflusst wird. Selbst bei einem erhöhten IOD ist nicht zwangsläufig die Entwicklung eines Glaukoms zu erwarten. So zeigt eine große Landmark-Studie mit 1636 Patienten und einem IOD von 24 bis 32 mmHg, dass innerhalb von fünf Jahren 91 % dieser Patienten auch ohne drucksenkende Therapie kein Glaukom entwickelten. Unter medikamentöser drucksenkender Therapie halbierte sich das Risiko für ein Glaukom – ein weiterer Beleg dafür, dass ein erhöhter IOD alleine nicht der einzige Risikofaktor für die Entstehung eines Glaukoms ist.
Risiko für erhöhten IOD individuell abschätzen
Um bereits vor einer Kortikosteroidbehandlung das Risiko für das Auftreten eines hohen IOD abschätzen zu können, empfiehlt es sich, die familiäre Vorgeschichte sowie Risikofaktoren für eine Steroid-Response zu erfragen. Zu diesen zählen ein bestehendes primäres Offenwinkelglaukom (POAG), der Verdacht auf eine Glaukomerkrankung, eine zuvor aufgetretene Steroid-Response, zunehmendes Alter, Verwandte ersten Grades mit POAG, starke Kurzsichtigkeit, Typ-1-Diabetes und Bindegewebserkrankung. Zudem kann bei Patienten mit okulärer Hypertension mithilfe von online verfügbaren Kalkulatoren das individuelle Risiko des Patienten für die Entwicklung eines Glaukoms innerhalb der nächsten fünf Jahre abgeschätzt werden. Dieses kann selbst bei gleichem Alter und gleichen IOD-Werten je nach Vorliegen verschiedener anderer Risikofaktoren (Hornhautdicke, Cup-Disc-Ratio, Gesichtsfeld) sehr unterschiedlich ausfallen.
Management bei erhöhtem IOD
Ohnehin ist bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten unter intravitrealer Kortikosteroidtherapie kein IOD-Anstieg zu befürchten. Verschiedene Studien zeigen übereinstimmend, dass nach FAc-Implantation bei etwa einem Drittel der Patienten ein IOD-Anstieg auftrat. Dieser ließ sich bei den meisten Patienten mit einer topischen Monotherapie sehr gut kontrollieren; ein chirurgischer Eingriff war nur sehr selten erforderlich. Auch ein Gremium europäischer Glaukomexperten, das die Evidenz zu IOD-Anstiegen infolge einer intravitrealen Kortikosteroidtherapie bei Patienten mit DMÖ untersucht hat, bestätigt diese Einschätzung. Das Gremium hat zudem einen Algorithmus entwickelt, der im klinischen Alltag als Leitfaden zum Management von Kortikosteroidinduzierten IOD-Anstiegen dienen kann. Diesem zufolge sollten Patienten mit beginnender okulärer Hypertension (>21 mmHg) nach einer intravitrealen Kortikosteroidinjektion eine Basisuntersuchung sowie regelmäßige Bildgebungs- und Gesichtsfelduntersuchungen erhalten. Eine Behandlung zur IOD-Senkung wird erst ab einem IOD von 25 mmHg vorgeschlagen oder wenn diagnostische Tests auf eine sich entwickelnde Glaukomerkrankung hindeuten. Bleibt der IOD auch bei Gabe von zwei Wirkstoffen über 25 mmHg, so wird eine Überweisung an einen Glaukomspezialisten empfohlen. Für alle anderen Patienten mit einem IOD ≤21 mmHg werden regelmäßige IOD-Kontrollen empfohlen, um bei einem möglichen Anstieg gegebenenfalls rasch angemessen reagieren zu können.
Fazit
- DR und DMÖ sind häufige mikrovaskuläre Komplikationen bei Diabetes mellitus und die häufigste Ursache für eine schwere Sehbehinderung im erwerbsfähigen Alter.
- Regelmäßige augenärztliche Kontrollen (mindestens alle 2 zwei Jahre) bei Patienten mit Diabetes mellitus sind wichtig – auch ohne bestehende Symptome.
- Es steht eine große Bandbreite an Therapieoptionen zur Verfügung; eine rasche und konsequente Umsetzung ist wichtig.
- Individuelle Therapie je nach Behandlungslast, Entzündungsstatus, weiteren Risikofaktoren
- Entzündungsmechanismen spielen eine zentrale Rolle bei DMÖ, ggf. frühzeitige intravitreale Kortikosteroidtherapie erwägen.
Bildnachweis
Titelbild unter Verwendung von: Pojjanee – stock.adobe.com
Referenten
Prof. Dr. Matus Rehak Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie Medizinische Universität Innsbruck Anichstrasse 35 A-6020 Innsbruck Prof. Dr. Verena Prokosch Uniklinik Köln - Zentrum für Augenheilkunde Gebäude 34 Kerpener Str. 62 50937 Köln Dr. Astrid Sader-Moritz Augenzentrum Berliner Ring Schweinfurter Straße 2 97080 Würzburg Priv.-Doz. Dr. Karl Mercieca Universitäts-Augenklinik Bonn Ernst-Abbe-Straße 2 53127 Bonn Priv.-Doz. Dr. med. Catharina Busch, FEBO Breitenfelder Str. 12 04155 LeipzigInteressenkonflikte
Die Referenten haben keine Interessenkonflikte angegeben.Sponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 14.900,- durch die Alimera Sciences Ophthalmologie GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt