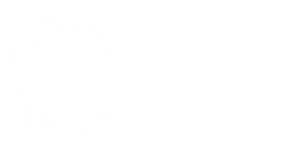Update: Der Divertikelpatient in der Praxis
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
- die Pathophysiologie der Divertikelkrankheit und die Rolle des Mikrobioms.
- die unterschiedlichen Typen einer Divertikelkrankheit und deren unterschiedliche Therapieoptionen.
- die Aufklärungs- und Präventionsmöglichkeiten für PatientInnen, bei denen zufällig Divertikel diagnostiziert wurden oder die an der chronischen Divertikelkrankheit leiden.
- die Nachsorgemöglichkeiten für DivertikulitispatientInnen.
- die Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen der chronischen Divertikelkrankheit und dem Reizdarmsyndrom.
Einleitung
Divertikel im Bereich des Kolons zählen in den westlichen Ländern zu den Zivilisationskrankheiten. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland mehr als 116.000 Behandlungsfälle und mehr als 850.000 Behandlungstage in Krankenhäusern aufgrund einer Divertikelkrankheit registriert. Dies führte zudem zu insgesamt mehr als knapp 1,3 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen. Die Divertikulitis und die chronische Divertikelkrankheit gehören damit zu den häufigsten gastro- intestinalen Erkrankungen. Damit einher geht eine entsprechend hohe ökonomische Belastung für das Gesundheitssystem. Am häufigsten kommt es zu sogenannten falschen Divertikeln oder Pseudodivertikeln, die bis zu 90 % der Divertikulosefälle in Deutschland ausmachen. Hierbei stülpen sich die Mukosa und Submukosa durch kleine Lücken in der Muskularis, meist an Durchtrittsstellen von Gefäßen. Im rechtsseitigen Kolon finden sich auch gelegentlich sogenannte echte oder komplette Divertikel, bei denen auch die Muskularisschicht mit ausgestülpt ist. Interessanterweise treten Divertikel bei Asiaten gehäuft im proximalen Kolon auf, in westlichen Ländern ist überwiegend das Sigma betroffen. Der Nachweis von Divertikeln erfolgt meist als Zufallsbefund, beispielsweise im Rahmen einer Früherkennungskoloskopie: In rund 40 % der Vorsorgeuntersuchungen werden Divertikel erkannt. Dies macht die entsprechende Person jedoch noch nicht behandlungsbedürftig. Nur wenn Symptome vorliegen, spricht man von einer Divertikelkrankheit.
Epidemiologie
Untersuchungen zeigen, dass die Prävalenz der Divertikulose mit dem Lebensalter ansteigt. Lediglich 13 % der Personen im Alter unter 50 Jahren weisen Divertikel auf. Für Personen zwischen 50 und 70 Jahren liegt die Prävalenz bei ca. 30 %. Etwa 50 % der Personen zwischen 70 und 85 Jahren tragen Divertikel, im Alter über 85 Jahre sind es ca. 66 %. Umgerechnet entspricht das in Deutschland in etwa 7,2 Mio. Divertikelträger, allein bei den über 70-Jährigen. Ein relevanter geschlechtsspezifischer Unterschied in der Prävalenz der Divertikulose findet sich in der westlichen Welt nicht. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 80 % der Personen mit Divertikeln lebenslang asymptomatisch bleiben. Etwa 20 % der Menschen mit Divertikeln entwickeln Symptome, die sich in verschiedenen Krankheitsbildern manifestieren können. Die Mehrheit dieser Betroffenen (ca. 80 %) leidet unter einer symptomatischen unkomplizierten Divertikelkrankheit (SUDD), die mit funktionellen Darmbeschwerden und einem typischen Schmerzprofil einhergeht. Bei einem kleineren Teil der Patienten (ca. 20 %) kann es jedoch auch zu einer akuten Divertikulitis kommen, die mit oder ohne Komplikationen verlaufen kann. Gemäß einem systematischen Review kommt es nach einer ersten Episode einer unkomplizierten Divertikulitis zu Rezidivraten von 15 bis 35 %. Nach zwei Episoden steigt das Risiko für weitere Rezidive, der Schweregrad der Schübe nimmt dabei aber nicht zu.
Ätiologie und Pathogenese
Die Ätiologie und Pathogenese der Divertikelbildung ist multifaktoriell und bisher noch nicht komplett aufgeklärt. Bei Patienten mit Divertikeln können z. B. Veränderungen in der Darmmotilität festgestellt werden; es bleibt jedoch unklar, ob Divertikel hierbei Ursache oder Folge sind. Die Altersabhängigkeit gibt einen Hinweis auf die Bedeutung degenerativer Veränderungen im Bindegewebe für die Ausbildung von Divertikeln. Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle bei der Entstehung von Divertikeln: Zwillingsstudien weisen darauf hin, dass das Auftreten von Divertikeln etwa 40 bis 50 % durch die Genetik bestimmt wird. Weiter scheint das enterische Nervensystem bei der Entstehung der Divertikel mitzuwirken. Man findet strukturelle und funktionelle Veränderungen, wie eine myenterische und submuköse Hypoganglionose, eine mukosale Nervenfaserhypertrophie sowie eine veränderte Expression von Neurotransmittern und Rezeptoren. Schlussendlich zeigt sich häufig eine Verdickung der Längs- und Ringmuskulatur des Kolons (Myochosis coli), vor allem im linksseitigen Hemikolon, wobei noch nicht abschließend geklärt ist, ob es sich hierbei um Ursache oder Folge der Divertikulose handelt. Ein erhöhter intraluminaler Druck im Bereich des Sigmas sowie strukturelle Veränderungen der Darmwand können entscheidende pathogenetische Faktoren sein, die sich mit zunehmendem Alter verstärken. Die frühere Vorstellung, dass ein reduzierter Ballaststoffgehalt in der Nahrung und die damit einhergehende Obstipation die Ausbildung von Divertikeln primär begünstigen, ist nicht zutreffend. Neuere Studien mit großen, heterogenen Patientenkollektiven, bei denen Vorsorgekoloskopien durchgeführt wurden, zeigen keine eindeutige Assoziation zwischen dem Auftreten von Divertikeln und dem Ballaststoffgehalt der Nahrung oder einer Obstipationsneigung. Auch die Daten zur Rolle von Übergewicht sind nicht eindeutig.
Risikofaktoren für das Auftreten von Symptomen
Jeder fünfte Divertikelträger hat behandlungsbedürftige Beschwerden. Erst dann wird von einer Divertikelkrankheit gesprochen. Im Gegensatz zu den weitestgehend unbekannten Faktoren, die zur Ausbildung von Divertikeln führen, sind mehrere Risikofaktoren bekannt, die das Auftreten von Beschwerden, d. h. einer akuten Divertikulitis oder der chronischen Divertikelkrankheit, bei Divertikelträgern begünstigen. Insgesamt wird angenommen, dass die Beschwerden aus dem komplexen Zusammenspiel von Ernährungs- und Lebensstilfaktoren, Medikamenten, Genetik und dem Darmmikrobiom resultieren.
Ballaststoffarme Kost
Die Aufnahme von Ballaststoffen spielt eine wichtige Rolle. So zeigt ein aktuelles systematisches Review mit Metaanalyse das Bestehen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen dem Ballaststoffgehalt der Nahrung und der Entwicklung einer Divertikelkrankheit. Die Aufnahme von Ballaststoffen gilt als besonders effektiv in der Risikoreduktion eines symptomatischen Verlaufes. So wurde gezeigt, dass das relative Risiko, Beschwerden zu entwickeln, bei einem Konsum von täglich 40 g Ballaststoffen im Vergleich zu Personen mit sehr geringer Ballaststoffzufuhr um etwa die Hälfte gesenkt wird.
Wenig körperliche Aktivität
Körperliche Aktivität hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung bei der Entstehung von Symptomen: In einer Analyse mit fast 50.000 amerikanischen Männern wird eine inverse Korrelation zwischen körperlicher Aktivität und symptomatischer Divertikelkrankheit erfasst. Geringe körperliche Aktivität und wenig sportliche Betätigung erhöhten das Risiko, Divertikelbeschwerden zu entwickeln, um den Faktor 2,6.
Weitere Risikofaktoren
Folgende Faktoren begünstigen ebenfalls die Entstehung einer Divertikelkrankheit:
- Verzehr von rotem Fleisch
- Rauchen
- Schädlicher Alkoholkonsum
- Übergewicht
Veränderungen im Darmmikrobiom
Immer mehr Studien weisen darauf hin, dass auch das intestinale Mikrobiom bei der Entstehung einer Divertikelkrankheit mitspielt. Verschiedene Untersuchungen dokumentieren ein charakteristisches dysbalanciertes Mikrobiomprofil entlang des Krankheitsspektrums:
- Bereits bei asymptomatischen Divertikelträgern zeigen sich signifikante Unterschiede in der mikrobiellen Zusammensetzung im Vergleich zu divertikelfreien Personen, besonders in Bezug auf Bakterien mit entzündungshemmenden Eigenschaften.
- Bei Patienten, die aufgrund der Divertikel funktionelle Darmbeschwerden entwickelten (symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit; SUDD), finden sich weitere spezifische Veränderungen im Mikrobiomprofil, die zum Teil mit der Schwere der Abdominalschmerzen assoziiert waren (v. a. reduzierte Präsenz entzündungshemmender und SCFA-produzierender Bakterien).
- Besonders aufschlussreich ist, dass bei SUDD-Patienten das Bakterienprofil vom mukosalen Mikrobiom im Bereich der Divertikel deutlich von dem in anderen Kolonabschnitten und im Stuhl abweicht. Dies deutet darauf hin, dass sich die Dysbiose lokal im Bereich der Divertikel manifestiert.
- Bei Divertikulitispatienten wurde zudem ein verändertes metabolisches Profil mit Verschiebungen zugunsten proinflammatorischer Faktoren nachgewiesen.
Klassifikation der Divertikelkrankheit
Das Spektrum der Divertikelkrankheit ist vielfältig. In der aktuellen deutschen Leitlinie zur Divertikelkrankheit wird daher eine Klassifikation vorgeschlagen, die auch international zunehmend Anwendung findet. Bei dieser Klassifizierung, der „Classification of Diverticular Disease“ (CDD), wird, statt der häufig verwendeten Einteilung nach Stadien, bewusst eine Einteilung nach Typen gewählt. Dadurch soll unter anderem auch zum Ausdruck kommen, dass es sich bei der Divertikelkrankheit nicht um eine in Stadien verlaufende Erkrankung handeln muss. Zudem erlaubt die Einteilung nach Krankheitstypen auch eine bessere Zuordnung von diagnostischen und therapeutischen Algorithmen. Der Zufallsbefund von Kolondivertikeln, die beispielsweise im Rahmen einer Koloskopie bei beschwerdefreien Patienten auffallen, wird als Typ 0 bezeichnet (Divertikulose). Die akute unkomplizierte Divertikulitis wird als Typ 1 geführt. Eine akute Divertikulitis mit Komplikationen ist hingegen Typ 2. Die chronische Divertikelkrankheit wird als Typ 3 beschrieben. Diese kann als symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (Typ 3a) ohne Entzündung oder als rezidivierende Divertikulitis ohne (Typ 3b) oder mit Komplikationen (Typ 3c) verlaufen. Als Typ 4 der Divertikelkrankheit wir die Divertikelblutung bezeichnet.
Akute Divertikulitis
Akute unkomplizierte Divertikulitis (Typ 1a und Typ 1b)
Die Diagnose Divertikulitis wird zunehmend häufiger gestellt. Eine Untersuchung aus den USA zeigte einen regionalen Anstieg der geschlechts- und altersadaptierten jährlichen Inzidenz von etwa 150 Fällen im Jahr 1980 auf rund 250 Fälle pro 100.000 Personen im Jahr 2007. Interessanterweise betraf der Anstieg vorwiegend Personen unter 70 Jahren.
Symptomatik und Diagnostik
Hinweisend auf eine Divertikulitis sind akut einsetzende und zunehmende Schmerzen mit Punctum maximum im linken Unterbauch („linksseitige Appendizitis“). Fieber, rektaler Luftabgang, eine spontane Stuhlentleerung, Übelkeit, Obstipation oder Diarrhö können die Symptomatik ergänzen. Beschreiben Patienten Schmerzen im Genitalbereich, kann das auf eine Irritation des Plexus sacralis hinweisen. Eine Pollakisurie oder Dysurie weisen auf ein Übergreifen der Entzündung auf die Harnblase hin. Bei Verdacht auf eine Divertikulitis soll neben einer gründlichen körperlichen Untersuchung (Palpation, Perkussion und Auskultation des Abdomens, rektale Untersuchung und Temperaturmessung) auch eine Labordiagnostik (CRP, Leukozytenzahl und Urinstatus) erfolgen. Typischerweise besteht ein Druckschmerz im linken Unterbauch, während eine Abwehrspannung auf eine peritoneale Reizung und eine mögliche komplizierte Divertikulitis hinweist. Da viele Patienten die Schmerzlokalisation exakt angeben können, lässt sich das betroffene Divertikel durch gezielte Palpation gut identifizieren – der klinische Befund kann jedoch je nach Entzündungsort variieren. Zusätzlich soll zur Diagnosesicherung ein Schnittbildverfahren (Ultraschall oder Computertomographie, CT) durchgeführt werden. Als bildgebende Methode wird in der Regel die abdominelle Sonografie eingesetzt, die sich auch hervorragend zur Verlaufskontrolle eignet. Typisch ist der Nachweis einer entzündlichen Umgebungsreaktion um das Divertikel. Die echoreiche Netzkappe bildet sich bei unkompliziertem Verlauf meist sehr rasch innerhalb weniger Tage komplett zurück. Auf den Einsatz einer Magnetresonanztomografie (MRT) kann meist verzichtet werden.
Therapie
Die akute Divertikulitis kann bei geringer klinischer Symptomatik ohne Fieber, Stuhlverhalt und Abwehrspannung und nur gering erhöhtem CRP sowie fehlender Leukozytose ambulant behandelt werden. Voraussetzung ist, dass Patienten ausreichend orale Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen können und eine engmaschige klinische Kontrolle möglich ist. Kommt es zu einer Verschlechterung, ist die umgehende stationäre Einweisung dringend erforderlich.
Antibiotika
Früher wurden bei jeder akuten Divertikulitis routinemäßig Antibiotika verordnet. Neuere Daten zeigen jedoch, dass ihr Einsatz bei unkomplizierten Verläufen keinen nachweisbaren Vorteil bringt. Entsprechend zurückhaltend äußern sich auch die deutschen Leitlinien zum Einsatz von Antibiotika: Bei linksseitiger Divertikulitis unter engmaschiger klinischer Kontrolle und bei Fehlen von Risikofaktoren für einen komplizierten Verlauf kann auf Antibiotika verzichtet werden. Auch international ist der Konsens mittlerweile, dass Antibiotika bei Patienten mit akuter unkomplizierter Divertikulitis eher selektiv statt routinemäßig eingesetzt werden sollten. Ob eine Antibiotikatherapie erforderlich ist, sollte individuell abgewogen werden. Entscheidend sind Risikofaktoren wie das Vorhandensein einer Hypertonie, einer chronischen Nierenerkrankung, einer Immunsuppression oder einer allergischen Disposition. Im Praxisalltag kann im Zweifelsfall zugunsten einer antibiotischen Therapie entschieden werden. Wenn Antibiotika verwendet werden, sollten sie gramnegative Stäbchen und anaerobe Bakterien abdecken. Bei ambulanter Antibiotikatherapie bietet sich eine Monotherapie mit Amoxicillin-Clavulansäure an. Alternativ kann Metronidazol mit Ciprofloxacin, Levofloxacin oder Trimethoprim-Sulfamethoxazol kombiniert werden, wobei es zu Fluorchinolonen eine offizielle Warnung gibt („Rote-Hand-Brief“).
Ernährung
Bisher befassen sich nur wenige Studien mit der Frage nach der richtigen Ernährung während einer akuten Divertikulitis. Üblich ist bei schweren Formen initial eine parenterale Ernährung mit anschließendem Kostaufbau mit anfangs ballaststofffreier oder -armer Kost. Im ambulanten Bereich ist den Patienten eine leichte, ballaststoffarme Ernährung (Schonkost) anzuraten.
Chirurgischer Eingriff
Eine Operation ist bei einer unkomplizierten akuten Divertikulitis nicht indiziert. Allerdings kann eine elektive Sigmaresektion bei Patienten mit anhaltenden Beschwerden („smoldering divertikulitis“) zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen.
Akute komplizierte Divertikulitis (Typ 2a und Typ 2b)
Bei der akuten komplizierten Divertikulitis ist entweder ein Mikroabszess (≤3 cm; gedeckte Perforation; Typ 2a), ein Makroabszess (>3 cm; para- oder mesokolisch; Typ 2b) oder sogar eine freie Perforation (eitrige oder fäkale Peritonitis; Typ 2c) festzustellen. Patienten mit einer komplizierten Divertikulitis sollen umgehend stationär aufgenommen, behandelt und überwacht werden.
Therapie
Die Therapiestrategie umfasst die rasche Überprüfung einer Indikation zur Intervention. Die Interventionsoptionen umfassen:
- Antibiose
- Schmerzkontrolle
- Abszessdrainage (unter Umständen)
- Notfalloperation (unter Umständen)
- Parenterale Flüssigkeitsgabe bei mangelhafter oraler Trinkmenge
- Situationsadaptierte orale Nahrungszufuhr in Abhängigkeit der klinischen Situation
Antibiotika
Eine konservative Therapie der akuten komplizierten Divertikulitis beinhaltet eine Antibiotikatherapie. Kleinere Abszesse <3 cm können meist mit Antibiotika allein behandelt werden. Wichtig ist eine engmaschige Kontrolle der Symptomatik und der Entzündungszeichen. In der klinischen Routine verwendete Antibiotika sind Cefuroxim, Ceftriaxon oder Ciprofloxacin, jeweils kombiniert mit Metronidazol, sowie Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam und Moxifloxacin („Rote-Hand-Brief“). Zusätzlich erhalten die Patienten eine adäquate Schmerzkontrolle und - wenn nötig - parenterale Flüssigkeitsgabe. Als Kost wird initial nur klare Flüssigkeit verabreicht.
Perkutane Drainage
Um eine Notfalloperation zu vermeiden, kann bei größeren retroperitonealen oder parakolischen Abszessen ab 3 cm eine perkutane Drainage zusätzlich zur Antibiose erfolgen. Da dieses Verfahren durchaus zu relevanten Komplikationen führen kann, sollte es nur bei größeren und interventionell sicher zugänglichen Abszesslokalisationen unter engmaschiger Überwachung des klinischen Verlaufs durchgeführt werden.
Chirurgischer Eingriff
Patienten mit freier Perforation und Peritonitis bei akut komplizierter Divertikulitis sollten innerhalb von sechs Stunden nach Diagnosestellung operiert werden. Die Mehrzahl dieser Eingriffe erfolgt in Deutschland inzwischen minimalinvasiv. Der Anteil der Patienten, der trotz konservativer Therapie operiert werden muss, schwankt in der Literatur zwischen 5 und 33 %. Um postoperative Morbiditäten zu minimieren, muss das Versagen der konservativen Therapie frühzeitig erkannt werden und entsprechend eine zeitnahe dringliche Operation erfolgen. Bislang fehlen leider sowohl zuverlässige Prädiktoren für ein Therapieversagen als auch evidenzbasierte, klar definierte Kriterien zu deren Identifikation. Neben der klinischen Einschätzung beruht die Diagnostik derzeit auf Schnittbildverfahren (i. d. R. ein Abdomen-CT).
Chronische Divertikelkrankheit
In der deutschen Leitlinie werden drei Formen der chronischen Divertikelkrankheit unterschieden: die symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (SUDD; Typ 3a) ohne Entzündungsnachweise, die rezidivierende Divertikulitis ohne Komplikationen (Typ 3b) und die rezidivierende Divertikulitis mit Komplikationen wie z. B. Stenosen, Fisteln oder Konglomerattumor (Typ 3c).
Symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (Typ 3a)
Patienten mit symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (SUDD) zeigen chronisch rezidivierende funktionelle Darmbeschwerden wie Blähungen, Diarrhö, Obstipation sowie Abdominalschmerzen, die einen Bezug zu dem divertikeltragenden Segment haben. Die Symptomatik ist zum Teil wie bei einer milden akuten Divertikulitis, aber ohne die nachweisbaren entsprechenden entzündlichen Veränderungen im Blut (z. B. CRP, Leukozyten). Auch die Ultraschalldiagnostik zeigt bei SUDD-Patienten keine Zeichen einer akuten Divertikulitis. Dennoch scheint bei diesen Patienten eine chronisch persistierende Entzündung vorzuliegen, da histologisch durchaus entzündliche Veränderungen in der Schleimhaut vorhanden sein können sowie Calprotectin im Stuhl diskret erhöht sein kann. Die Schwere und Häufigkeit der Symptome können sich, ähnlich wie beim Reizdarmsyndrom, auf die täglichen Aktivitäten auswirken und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.
Mesalazin
Mehrere Studien untersuchten die Wirkung von Mesalazin auf die reizdarmähnlichen Beschwerden der SUDD-Patienten. In einer sechswöchigen randomisierten placebokontrollierten Studie, die 125 Patienten mit SUDD oder unkomplizierter Divertikulitis einschloss, zeigte Mesalazin (dreimal 1 g Mesalazin täglich) keinen signifikanten Effekt auf die Unterbauchschmerzen. In mehreren randomisierten offenen Studien ergab eine Therapie mit Mesalazin bei SUDD-Patienten jedoch positive Effekte bezüglich der Symptome und der symptomatischen Rezidive. Auf Grundlage dieser und weiterer Studien kommt die Leitlinie zu dem Schluss, dass eine intermittierende Gabe von Mesalazin zur symptomatischen Verbesserung und zur Verhinderung symptomatischer Episoden bei SUDD gegeben werden kann. Am häufigsten wurde eine Dosis von 1,6 g täglich an zehn Tagen im Monat eingesetzt. Allerdings handelt es sich hierbei um einen „Off-Label-Use“, da Mesalazin für diese Indikation in Deutschland nicht zugelassen ist.
Ernährung
Trotz der positiven Effekte ballaststoffreicher Ernährung auf die Reduzierung des Divertikulitisrisikos sowie auf Surrogatmarker wie Kolonpassagezeit und Stuhlgewicht, fehlt ausreichende Evidenz für die therapeutische Wirksamkeit bei SUDD. Es gibt daher keine Empfehlung für die Supplementierung von Ballaststoffen. Die Empfehlung zu einer ballaststoffreichen Kost kann unabhängig davon aufgrund allgemeingültiger Ernährungsempfehlungen gegeben werden.
Mikrobiom-Modulation
Bei Patienten mit SUDD können Veränderungen in der Mikrobiotazusammensetzung eine Ursache für chronische funktionelle Darmbeschwerden und unterschwellige Entzündungen sein (u. a. verringerter Nachweis von Bakterien mit entzündungshemmenden Eigenschaften). Die chronische Dysbiose könnte auf eine Stuhlstase infolge der Kolondysmotilität zurückzuführen sein und könnte dann Veränderungen in Verdauungsprozessen bewirken sowie mukosale Immunaktivierung und viszerale Hypersensitivität fördern. Demzufolge kann eine Modulation des Mikrobioms für SUDD-Patienten vorteilhafte Effekte auf die funktionellen Darmbeschwerden haben.
Mikrobiom-Modulation durch Rifaximin
Eine Möglichkeit zur Mikrobiom-Modulation ist der Einsatz des minimal resorbierbaren darmselektiven Antibiotikums Rifaximin. Verschiedene Leitlinien und internationale Konsensusempfehlungen raten zu einer Anwendung von Rifaximin (plus Ballaststoffe) bei SUDD zu einer besseren Symptomkontrolle und Verhinderung von akuten Schüben einer Divertikulitis. Belege für die Wirksamkeit von Rifaximin bei SUDD stammen hauptsächlich aus fünf Studien, von denen allerdings nur eine placebokontrolliert war. In der aktuell gültigen deutschen Leitlinie wird derzeit keine Empfehlung für diese Therapie ausgesprochen, möglicherweise erfährt dieser Aspekt bei einem weiteren Update jedoch eine neue Beurteilung.
Mikrobiom-Modulation durch Probiotika
Eine Reihe von Studien hat den Einsatz von mikrobiologischen Präparaten bei der Behandlung der SUDD und der Prävention von rezidivierender Divertikulitis untersucht. Obwohl die Behandlungen und Ergebnisse sehr heterogen sind, deuten aktuelle Daten auf eine mögliche klinische Anwendung bei der Divertikelkrankheit hin. Nicht für jedes der getesteten Probiotika, die jeweils unterschiedliche Bakterienstämme enthielten, konnte ein positiver Effekt für die Patienten nachgewiesen werden. Somit kann nicht von einer generellen Wirksamkeit von Probiotika ausgegangen werden. Vielmehr sind es vermutlich spezifische Effekte einzelner ausgewählter Bakterienstämme. Präklinische Daten zeigen, dass manche probiotische Bakterienstämme in der Lage sind, Effekte zu erreichen, die womöglich über die Wirkung von Ballaststoffen hinausgehen und sich so positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken könnten:
- Normalisierung der Stuhlkonsistenz
- Ausgleich der Dysbiose
- Hemmung der Entzündungsreaktion
- Regulation der Darmmotilität
Rezidivierende Divertikulitis ohne Komplikationen (Typ 3b)
Tritt die unkomplizierte Divertikulitis in rezidivierenden Schüben auf, liegt das Hauptaugenmerk darauf, das Wiederrauftreten dieser Schübe zu vermeiden.
Rezidivprophylaxe mit Mesalazin oder Rifaximin
Zur Sekundärprophylaxe einer rezidivierenden Divertikulitis liegen mehrere hochwertige Studien zum Einsatz von Mesalazin vor. Keine dieser Untersuchungen konnte jedoch eine Senkung der Rezidivrate nachweisen, was sowohl durch eine Metaanalyse als auch durch eine Cochrane-Analyse bestätigt wurde. Mesalazin soll daher nicht zur Sekundärprophylaxe der rezidivierenden Divertikulitis eingesetzt werden. Auch Rifaximin wird zur Prävention rekurrierender Schübe einer akuten Divertikulitis intensiv diskutiert. Bis heute fehlt jedoch eine kontrollierte Studie, die den Effekt einer Rifaximin-Monotherapie zur Remissionserhaltung evaluiert hat. Lediglich für die Kombination aus Rifaximin und Ballaststoffen existieren Hinweise auf eine mögliche remissionserhaltende Wirkung – ein vielversprechender Therapieansatz, dessen Wirksamkeit jedoch noch durch weitere Studien belegt werden muss. Rifaximin sollte also laut Leitlinie nicht zur Sekundärprophylaxe der rezidivierenden Divertikulitis eingesetzt werden.
Chirurgischer Eingriff
Früher wurde bei der rezidivierenden Divertikulitis spätestens nach dem zweiten Schub zu einer elektiven Operation geraten, da angenommen wurde, dass das Risiko für Komplikationen mit der Zahl der Schübe ansteigt. Neuere Erkenntnisse belegen allerdings, dass das Perforationsrisiko beim ersten Schub am höchsten ist und mit der Anzahl der weiteren Schübe abnimmt, auch wenn das Rezidivrisiko mit jedem Entzündungsschub steigt. Die Indikation zur Operation sollte daher nicht von der Anzahl der vorangegangenen Entzündungsschübe abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die rezidivierende Erkrankung bei diesen Patienten als wesentliche Entscheidungshilfe zur Indikationsstellung für oder gegen eine elektive Sigmaresektion herangezogen werden, da diese die Lebensqualität der Patienten signifikant verbessern kann.
Rezidivierende Divertikulitis mit Komplikationen (Typ 3c)
Rezidivierende Divertikulitiden können zu Komplikationen wie Stenosen, Fisteln oder einem Konglomerattumor führen. Die Divertikulitis Typ 3c mit Nachweis von Fisteln oder einer symptomatischen Kolonstenose sollte operativ behandelt werden.
Akute Divertikelblutung
Eine Sonderform der Divertikelkrankheit stellen akute Divertikelblutungen dar (Typ 4). Diese sind die häufigste Ursache für untere gastrointestinale Blutungen. Etwa 5 % der Patienten mit Divertikulose sind als Folge einer Ruptur der Vasa recta im Divertikelhals davon betroffen. Die Blutung sistiert in 90 % der Fälle spontan. Die Diagnostik erfolgt durch rasche Koloskopie mit möglicher endoskopischer Blutstillung. Bei persistierender Blutung sollte eine endoskopische, eine operative oder eine radiologisch-interventionelle Therapie erfolgen. In der besonderen und bedrohlichen Situation, dass bei schwerer aktiver Blutung weder endoskopisch noch angiografisch eine Blutungslokalisation gelingt, ist eine chirurgische Exploration, ggf. mit Kolektomie, gerechtfertigt; oder es kann bei einer eindeutig lokalisierbaren, rezidivierenden oder unstillbaren Divertikelblutung eine segmentale Resektion durchgeführt werden.
Fazit
- Kolondivertikel sind häufig: Mindestens 75 % der Personen über 80 Jahre weisen Divertikel auf.
- Etwa 80 % der Personen mit Divertikeln bleiben lebenslang asymptomatisch.
- Übergewicht, Bewegungsmangel, ballaststoffarme Kost, Rauchen und häufiger Konsum von rotem Fleisch erhöhen das Risiko, dass Personen mit Divertikeln symptomatisch werden.
- Bei Verdacht auf eine akute Divertikulitis sind neben Anamnese und klinischer Untersuchung eine Laboruntersuchung auf Entzündungszeichen und ein Ultraschall des Abdomens notwendig.
- Patienten mit akuter Divertikulitis können bei enger klinischer Überwachung ambulant behandelt werden. Die Gabe von Antibiotika hat keinen Effekt auf den Krankheitsverlauf der unkomplizierten Divertikulitis.
- Bei der rezidivierenden Divertikulitis muss die Indikation zur Operation individualisiert ausgesprochen werden; die Zahl der Schübe ist kein Kriterium mehr.
- Bei der chronischen Divertikelkrankheit sind eine ballaststoffreiche Kost, körperliche Aktivität, Anstreben/Erhalt von Normalgewicht, Nikotinabstinenz und eine fleischarme Kost sinnvoll
- Bei der symptomatischen unkomplizierten Divertikelkrankheit (SUDD) kann eine Off-Label-Therapie mit Mesalazin oder eine Mikrobiom-Modulation durch Ernährungsumstellung (ballaststoffreich, evtl. Low-FODMAP-Diät) oder evidenzbasierte probiotische Bakterienstämme eine Therapieoption zur Linderung der funktionellen Darmbeschwerden und zur Reduktion der Divertikulitisschübe sein.
Bildnachweis
selvanegra – iStockphoto
Referent
Prof. Dr. Dr. Manfred Gross Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie Ärztlicher Direktor des Internistischen Klinikums München Süd GmbH Am Isarkanal 36 81379 MünchenInteressenkonflikte
Prof. Gross gibt folgende Interessenkonflikte an: BMS, esanum GmbH, Falkfoundation, Grünenthal, Medical Tribune, Merz Pharmaceuticals, Microbiotica, Norgine, Omniamed, Pfizer, Reckitt BenckiserSponsoring
Diese Fortbildung wurde für den aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 4.900,- durch die Weber & Weber GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt