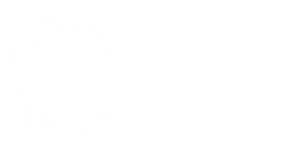Bewegungstherapie mit digitalen Gesundheitsanwendungen bei nicht spezifischem Rückenschmerz
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
- die wichtigsten Merkmale und Anforderungen an DiGA,
- die Abläufe einer DiGA-Verordnung einschließlich Abrechnung und Vergütung,
- den Einsatz bewegungstherapeutischer DiGA in der Behandlung von nicht spezifischem Rückenschmerz,
- die Evidenz zur Wirksamkeit bewegungstherapeutischer DiGA,
- wie die angestrebten Therapieziele mit DiGA am besten erreicht werden können.
Was ist eine digitale Gesundheitsanwendung?
Digitale Gesundheitsanwendungen (kurz: DiGA), im alltäglichen Sprachgebrauch auch „Apps auf Rezept” genannt, sind auf digitalen Technologien basierte Medizinprodukte. Es handelt sich um mobile Applikationen („Apps”), die auf einem Smartphone oder Tablet genutzt werden können, oder webbasierte Anwendungen, die über einen Internetbrowser laufen. Als Teil der Regelversorgung sind DiGA verordnungsfähig, budgetneutral, und deren Kosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen vollständig übernommen. Die Zulassung einer DiGA durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erfolgt basierend auf dem Nachweis eines sog. positiven Versorgungseffektes, der sich entweder als medizinischer Nutzen, beispielsweise Verbesserung des Gesundheitszustandes oder der Lebensqualität, oder als patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserung, beispielsweise Förderung der Patientensouveränität oder der Koordination von Behandlungsabläufen, darstellt. DiGA sind evidenzbasierte Behandlungsoptionen, die zunehmend in aktuellen medizinischen Leitlinien sowie Praxisempfehlungen unterschiedlicher Fachgesellschaften aufgenommen werden. Darüber hinaus finden DiGA zunehmend als Bestandteil von sogenannten Disease-Management-Programmen (DMP) Anwendung. DiGA unterscheiden sich von Gesundheitsapps ohne DiGA-Status: DiGA unterliegen klaren regulatorischen Anforderungen und erfüllen spezifische Kriterien, um in das offizielle DiGA-Verzeichnis des BfArM aufgenommen zu werden. Der für die dauerhafte Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis erforderliche Nachweis eines positiven Versorgungseffektes auf die adressierte Patientenpopulation erfolgt durch eine vergleichende und in der Regel randomisiert-kontrollierte Studie. Liegt dieser Nachweis bereits vor der Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis vor, wird die DiGA dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen. Alternativ kann der Nachweis im Rahmen einer vorläufigen Aufnahme während eines sogenannten Erprobungszeitraumes erbracht werden. Für die vorläufige Aufnahme sind Daten einer strukturierten Datenauswertung erforderlich. Zudem muss der Nachweis eines positiven Versorgungseffektes aus Sicht der BfArM als wahrscheinlich gelten. Der gewährte Erprobungszeitraum beträgt zwölf Monate und kann auf maximal 24 Monate verlängert werden. Während dieser Zeit können die erforderlichen Daten erhoben werden, um den positiven Versorgungseffekt zu belegen. Wird der Nachweis innerhalb des Erprobungszeitraumes erbracht und vom BfArM anerkannt, erfolgt die dauerhafte Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis. Details zum Studiendesign und zu der bestehenden Evidenz zu jeder einzelnen DiGA sind im BfArM-Verzeichnis unter der Rubrik „Informationen für Fachkreise“ einsehbar. Die zugrunde liegenden Quellen, Daten sowie die Beurteilung des BfArM sind dort beschrieben.
Verordnung und Aktivierung von DiGA
DiGA gehören neben Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder häuslicher Krankenpflege zu den abrechnungsfähigen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Ärzte und Psychotherapeuten können ein Rezept (Muster 16) für eine DiGA ausstellen, wenn die Verordnung medizinisch indiziert ist. Perspektivisch wird auch die DiGA-Verordnung über die Telematikinfrastruktur (E-Rezept) möglich werden. Zu jeder gelisteten DiGA stellt das BfArM im DiGA-Verzeichnis verordnungsrelevante Informationen bereit. Diese Informationen sind bereits in einigen Praxisverwaltungssystemen (PVS) verfügbar und werden künftig in allen PVS bereitstehen. Gesetzlich versicherte Patienten reichen das Rezept bei ihrer Krankenkasse ein, um den notwendigen Freischaltcode für die DiGA zu erhalten. Unterstützend bieten einige DiGA-Hersteller Rezeptservices zur Weiterleitung des Rezeptes an die Krankenkasse des Patienten und bei der Aktivierung der DiGA an. Alternativ können Versicherte auch ohne ärztliche Verordnung einen Antrag auf Genehmigung der DiGA bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse stellen. Diese übernimmt die Kosten, wenn eine entsprechende Indikation vorliegt bzw. mittels Diagnosenachweis von den Patienten vorgelegt wird. Letzterer darf nicht älter als vier Wochen sein.
Abrechnung und Vergütung von DiGA
Die Abrechnung und Vergütung im Kontext der Verordnung einer DiGA erfolgt über vereinbarte Pauschalen. Für einzelne DiGA ist eine Verlaufskontrolle abrechenbar.
Bewegungstherapie mit einer DiGA
Epidemiologie und sozioökonomische Relevanz von Rückenschmerzen
Rückenschmerzen gelten als „Volkskrankheit” und sind ein häufiger Vorstellungsgrund in der ambulanten und stationären Versorgung. Durch die begleitende Beeinträchtigung der Lebensqualität erfordern sie häufig eine fachübergreifende Betreuung. Darüber hinaus zeigen Rückenschmerzen eine starke Tendenz zur Chronifizierung und damit zur langfristigen Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Erwerbsfähigkeit: Etwa 61 % der Bevölkerung sind jährlich von Rückenschmerzen betroffen, hierbei leiden ca. 15,5 % unter chronischen Schmerzen. In ca. 85 % der Fälle sind Rückenschmerzen nicht spezifisch. Rückenschmerzen sind ein besonders häufiger Grund für die Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssystems, für Arbeitsunfähigkeit und für Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung.
Leitliniengerechte Therapie
Neben der Aufklärung und Motivation des Patienten zu einer gesunden Lebensführung gehören die Beibehaltung körperlicher Aktivitäten sowie die Bewegungstherapie zur leitliniengerechten Behandlung des nicht spezifischen Rückenschmerzes. Die Bewegungstherapie bei nicht spezifischem Rückenschmerz zielt darauf ab, die Schmerzen zu lindern sowie die körperliche Funktion und Belastbarkeit zu verbessern. Durch gezielte Übungen werden Muskelkraft und -ausdauer gestärkt, die Beweglichkeit gefördert und die Koordination verbessert. In der Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) nicht spezifischer Kreuzschmerz wird die Durchführung von Bewegungstherapie als evidenzbasierte Empfehlung zur Behandlung von nicht spezifischem Rückenschmerz genannt (Empfehlungsgrad A, starke Empfehlung). Bewegungstherapie, kombiniert mit edukativen Maßnahmen nach verhaltenstherapeutischen Prinzipien, soll zur primären Behandlung subakuter und chronischer nicht spezifischer Kreuzschmerzen zur Unterstützung der körperlichen Aktivität angewendet werden.
Bewegungstherapeutische DiGA bei nicht spezifischem Rückenschmerz
Bewegungstherapeutische DiGA können eine Alternative zur herkömmlichen Physiotherapie darstellen oder in Ergänzung zu anderen konventionellen Therapien eingesetzt werden. Im Verzeichnis des BfArM werden aktuell drei DiGA mit bewegungstherapeutischer Komponente angeboten, die bei nicht spezifischen Rückenschmerzen verordnet werden können: Die DiGA ViViRa und Kaia Rückenschmerzen sind durch den nachgewiesenen positiven Versorgungseffekt dauerhaft in das BfarM-Verzeichnis aufgenommen worden. Die DiGA ecovery ist aktuell vorläufig im oben genannten Verzeichnis gelistet. Diese DiGA bieten eine personalisierbare Bewegungstherapie zur Schmerzreduktion. Zudem gehören edukative Inhalte zu den zentralen Elementen dieser DiGA. Für diese drei DiGA wurde eine Anwendungsdauer von jeweils 90 Tagen zur Behandlung von Schmerzen definiert. Bei fortbestehenden Beschwerden kann eine erneute Verordnung erfolgen, sofern diese medizinisch indiziert ist. Bewegungstherapeutische DiGA unterstützen die Umsetzung der in den Leitlinien für nicht spezifischen Kreuzschmerz vorgesehenen Therapieelemente, insbesondere Bewegungstherapie mit Motivationselementen, Patienteninformation, Maßnahmen zur Veränderung eines maladaptiven Krankheitsverhaltens sowie Erlernen von Entspannungstechniken. Zudem wird die Umsetzung der Vorgaben der Heilmittelrichtlinie für die konventionelle und angeleitete Bewegungstherapie unterstützt. Das bewegungstherapeutische Training mit der patientenindividuellen täglichen Anpassung der Trainingsinhalte und die personalisierte Progression der Übungen bilden den Kern bewegungstherapeutischer DiGA.
Funktionen bewegungstherapeutischer DiGA
Folgende Funktionen werden zur Anleitung und Steuerung der digitalen Bewegungstherapie, Patientenedukation, Unterstützung der Verhaltensänderung sowie Förderung der Adhärenz verwendet: Trainingsprogramm: Das Bewegungstraining ist der Kern eines digitalen Therapieprogrammes. Für die DiGA ViViRa wird beispielsweise empfohlen, dieses mindestens an drei Tagen pro Woche zu nutzen. Dazu schlägt der Therapiealgorithmus an jedem Tag wechselnde Übungen vor. Eine tägliche Einheit dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Minuten und deckt die Bereiche Beweglichkeit, Kräftigung, Koordination, Funktionalität, Dehnung und Entspannung ab. Vor Beginn des Bewegungstrainings wird der Patient über die bevorstehenden Übungen informiert. Während des Bewegungstrainings wird der Patient durch ausführliche Anleitungsvideos mit audiovisuellen Hinweisen durch die einzelnen Übungen geführt. In den Videos werden die Übungen detailliert erklärt, um ein sicheres Training zu gewährleisten. Einzelne DiGA bieten zudem Funktionen wie Bewegungstests oder einen KI-gestützten Bewegungscoach an. Adaptiver Progressionsalgorithmus: Zur fortlaufenden Individualisierung der Trainingsinhalte wird nach jeder Trainingseinheit eine Rückmeldung vom Patienten, wie beispielsweise in Bezug auf Durchführbarkeit und Schmerz, erfasst. Diese Rückmeldungen werden bei der weiteren Zusammenstellung der Übungen berücksichtigt, um den Patienten ein optimales Training zu ermöglichen. Edukative Inhalte: Um Patienten bei der Etablierung einer regelmäßigen körperlichen Aktivität zu unterstützen, werden patientengerecht aufbereitete Schulungsinhalte wie Wissensartikel und Videos angeboten, beispielsweise zu relevanten Krankheitsbildern, zur Schmerzwahrnehmung und zu Schmerztypen sowie zu Körperhaltung und ergonomischer Bewegung. Ein besseres Verständnis von präventivem Verhalten und Risikofaktoren kann den therapeutischen Fortschritt unterstützen und die Motivation für ein gesundheitsförderliches Verhalten unterstützen. Erinnerungen: Nutzer können festlegen, an welchen Tagen ein Training erfolgen soll und Benachrichtigungen aktivieren, die an das Bewegungstraining erinnern. Verlaufsprotokoll: Eine Übersicht über die erfassten Gesundheitsdaten und den Behandlungsverlauf, etwa absolvierte Trainingseinheiten oder Angaben zur Schmerzintensität, werden in einem Verlaufsprotokoll dokumentiert. PDF-Fortschrittsbericht: Informationen zum Therapieprogramm, zum Verlaufsprotokoll, zur Trainingshistorie und zum Behandlungsverlauf können als PDF-Dokument exportiert und z. B. im ärztlichen Gespräch verwendet werden. Datenerfassung und individuelle Anpassung: Zur Konfiguration eines personalisierten Trainingsprogrammes werden Daten zur Demografie, zu Risikofaktoren, zur Schmerzlokalisation, Schmerzintensität, zu ggf. vorliegenden Kontraindikationen und körperlichen Einschränkungen sowie individuelle Ziele erfasst. Profil und Einstellungen: Die Konfiguration des Trainingsprogrammes, des Passwortes, Datenschutzeinstellungen, Informationen zum Kundenservice sowie der Zugang zu Dokumenten wie etwa der Gebrauchsanweisung sind in diesen Bereichen möglich.
Vorteile der bewegungstherapeutischen DiGA im Kontext der bestehenden Versorgungssituation
DiGA ermöglichen eine personalisierte Einzelbehandlung, die unmittelbar verfügbar ist und zeitlich und räumlich flexibel eingesetzt werden kann. Der vom Arzt festgestellte Versorgungsbedarf eines Patienten kann unmittelbar in Anspruch genommen werden. Die Funktionen einer DiGA ermöglichen ein selbstständig und nicht supervidiert durchgeführtes Training, das durch individualisierte Trainingspläne, Feedback, Erinnerungsfunktionen und Verlaufskontrollen unterstützt wird. So wird eine effektive Therapie ohne direkte Betreuung durch einen Physiotherapeuten möglich.
Feststellung der Indikation für eine digital vermittelte Bewegungstherapie
Die Beurteilung der Eignung eines Patienten für eine digital vermittelte Bewegungstherapie basiert auf verschiedenen Kriterien, wie etwa dem klinischen Befund, vorliegenden Kontraindikationen und der Vertrautheit des Patienten im Umgang mit einem Smartphone. Die Indikationsstellung und die Berücksichtigung der Ausschlusskriterien dienen bei ärztlicher Verordnung der qualitätsgesicherten Anwendung einer DiGA. DiGA ViViRA, Kaia Rückenschmerzen sowie eCovery können zur digitalen Bewegungstherapie bei nicht spezifischem Rückenschmerz eingesetzt werden. Die vollständige Auflistung der Indikationen inkl. der ICD-10-Codes ist im DiGA-Verzeichnis des BfArM verfügbar.
- Die DiGA ViViRA ist für 20 ICD-10-Codes aus den Bereichen der unspezifischen und degenerativen Rückenschmerzen (u. a. aus M42, M53, M54, M99) für Patienten ab 18 Jahren zugelassen.
- Die DiGA Kaia Rückenschmerzen ist für die Behandlung der unspezifischen (M54) Rückenschmerzen für Patienten von 18 bis 65 Jahren zugelassen.
- Die DiGA eCovery ist für 18 ICD-10-Codes aus den Bereichen der unspezifischen und degenerativen Rückenschmerzen (u. a. aus M42, M54, M99) für Patienten ab 18 Jahren vorläufig zugelassen.
Kontraindikationen
Bewegungstherapie mit einer DiGA ist grundsätzlich kontraindiziert, wenn das bewegungstherapeutische Training ohne Aufsicht für Patienten ungeeignet ist.
- Für DiGA werden die Kontraindikationen produktspezifisch aufgelistet.
- Die vollständige Liste der Kontraindikationen inkl. ICD-10-Codes ist im BfArM DiGA-Verzeichnis aufgeführt.
- Voraussetzung für die Anwendung einer bewegungstherapeutischen DiGA ist ein stabiler gesundheitlicher Allgemeinzustand.
- Bei starken Schmerzen, geschwollenen oder überwärmten Gelenken, Fieber oder allgemeinen Krankheitsgefühlen ist die Bewegungstherapie auszusetzen.
- Eine Bewegungstherapie mit DiGA ist grundsätzlich auch für ältere Patienten geeignet. Auch hier sollte das Vorliegen von Begleiterkrankungen sowie von kognitiven oder koordinativen Einschränkungen, die eine adäquate Durchführung der angeleiteten Übungen nicht ermöglichen, beachtet werden.
Evidenz zur Wirksamkeit bewegungstherapeutischer DiGA
Die publizierten Studienergebnisse zeigen, dass Bewegungstherapien mit DiGA eine signifikante und klinisch relevante Verbesserung des Gesundheitszustandes bei Patienten mit nicht spezifischem Rückenschmerz erzielen. Die Bewegungstherapie mit DiGA wurde in den Interventionsstudien mit der Standardbehandlung (wie zum Beispiel allgemeine Krankengymnastik oder Zugang zur Regelversorgung) verglichen und zeigte sich demgegenüber Überlegen. Je nach Studiendesign und wissenschaftlicher Fragestellung konnten die positiven Effekte bewegungstherapeutischer DiGA auf die Schmerzsymptomatik, Funktionalität sowie Lebensqualität der Patienten mit nicht spezifischem Rückenschmerz demonstriert werden
Therapieziele mit DiGA erreichen
Um angestrebte Therapieziele mit DiGA zu erreichen, ist es wichtig, die regelmäßige und zielgerichtete Anwendung digitaler Bewegungstherapie zu fördern. Patienten, die regelmäßig trainieren, erreichen eine klinisch relevante Schmerzreduktion mit höherer Wahrscheinlichkeit als jene, die unregelmäßig trainieren. Patientenkommunikation und Behandlungsplanung dienen der Verbesserung der Adhärenz bei der Behandlung mit DiGA. Aufklärung des Patienten, Unterstützung bei der Etablierung der Trainingsroutine, Besprechung der Behandlungsziele sowie eine positive Bestärkung können die Behandlungsadhärenz steigern und somit zu besseren Therapieergebnissen führen. Folgende Inhalte können im Arzt-Patienten-Gespräch zur Unterstützung des Erreichens therapeutischer Ziele adressiert werden:
- Zentrale Rolle der Bewegungstherapie bei der Behandlung nicht spezifischer Rückenschmerzen: Die regelmäßige Durchführung geeigneter Übungen fördert die Schmerzreduktion und verbessert die Funktionalität.
- Funktionsweise der DiGA: DiGA bieten strukturierte Anleitungen und eine Steuerung der Bewegungstherapie, vermitteln edukative Inhalte und unterstützen die Verhaltensänderung.
- Individuelle Zielsetzung: Ein schrittweiser, an die individuelle Belastbarkeit adaptierter Beginn der Trainingstherapie ist möglich. Nach Etablierung einer Routine kann die Häufigkeit und Intensität des Trainings erhöht werden.
- Geplanter Zeitraum und Regelmäßigkeit der Nutzung: Die regelmäßige Nutzung einer DiGA über den verordneten Zeitraum ist maßgeblich für den Therapieerfolg. Empfehlenswert ist eine Mindestnutzungsdauer von drei Monaten, da randomisierte kontrollierte Studien gezeigt haben, dass die Schmerzintensität im Vergleich zur Kontrollgruppe zu diesem Zeitpunkt signifikant reduziert ist. Die geeignete Anwendungsdauer hängt vom individuellen Krankheitsstadium des Patienten ab und liegt im Ermessen des behandelnden Arztes unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren und Krankheitslast des Patienten.
- Umgang mit möglichen Nebenwirkungen oder Komplikationen: Falls Patienten während oder nach der Anwendung der DiGA Schmerzen, Unwohlsein oder Funktionsverlust verspüren, sollten sie das Programm abbrechen. Einzelne DiGA geben hierzu spezielle Rückmeldungen. Bei starken Schmerzen, geschwollenen oder stark überwärmten Gelenken, Fieber, allgemeinen Krankheitsgefühlen ist die Bewegungstherapie auszusetzen.
- Verlaufskontrolle und Folgetermin: Um den Therapiefortschritt, gegebenenfalls auf Basis eines Verlaufsberichtes aus der DiGA, mit dem Patienten zu besprechen, Schwierigkeiten zu identifizieren, Feedback zu geben, Patienten positiv zu bestärken und eventuell eine medizinisch indizierte Folgeverordnung auszustellen, kann ein Folgetermin vereinbart werden.
- Unterstützungsmöglichkeiten: Die Hersteller bieten technische und inhaltliche Unterstützung über Patientenservices und ihre Webseite an.
Fazit
- DiGA sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte der Risikoklassen I, IIa oder IIb und werden vom BfArM geprüft und zugelassen.
- Als Teil der Regelversorgung sind DiGA verschreibungsfähig, budgetneutral, und ihre Kosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen vollständig übernommen.
- Bewegungstherapeutische DiGA stellen eine leitliniengerechte, evidenz-basierte Behandlungsoption bei nicht spezifischem Rückenschmerz dar.
- Die DiGA ViViRA und Kaia Rückenschmerzen sind bei nachgewiesenem positiven Versorgungseffekt dauerhaft in das BfArM-Verzeichnis aufgenommen. Zudem ist DiGA eCovery aktuell vorläufig im o. g. Verzeichnis gelistet (Stand Juli 2025).
Bildnachweis
Unter Verwendung von Jacob Lund – Adobe Stock
Referent
Dr. med. Manfred Eisert OMZ Prävention & Orthopädie Zaisenmühlstraße 2 97980 Bad MergentheimInteressenkonflikte
Der Referent hat keine Interessenkonflikte angegeben.Sponsoring
Diese Fortbildung wird im aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 9.900,- durch die Vivira Health Lab GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt