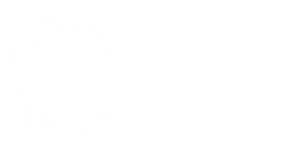Update antientzündliche Therapie beim Trockenen Auge – Erfahrungen aus der klinischen Praxis
Am Ende dieser Fortbildung wissen Sie...
- welche Risikofaktoren für das Trockene Auge bestehen,
- wie entzündliche Prozesse im Praxisalltag rasch erkannt werden können,
- wann eine antientzündliche Therapie bei trockenen Auge erwogen werden sollte,
- welche Therapieoptionen zur Verfügung stehen und wie sie angewendet werden sollten.
Einleitung
Das Trockene Auge hat sich zu einer Volkskrankheit entwickelt: Europaweit sind zwischen 11 und 35 % aller Menschen von einem Trockenen Auge betroffen, wobei diese Spanne u. a. auf methodische und geografische Unterschiede zwischen den verschiedenen Studien zurückzuführen ist. Zudem sind exakte Prävalenzdaten zum Trockenen Auge auch deshalb schwierig zu ermitteln, weil sehr viele Patienten zur Selbstmedikation ohne augenärztliche Kontrolle greifen. Der Berufsverband der Augenärzte (BVA) geht davon aus, dass in Deutschland etwa 15 bis 17 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland am Trockenen Auge leiden, wobei die Erkrankung mit zunehmendem Alter und bei Frauen häufiger auftritt.
Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt
Ein Trockenes Auge sollte nicht einfach als eine lästige Befindlichkeitsstörung abgetan werden, da die damit einhergehenden Beschwerden das Sehvermögen, die mentale und physische Lebensqualität sowie auch die Arbeitseffizienz der Betroffenen erheblich beeinträchtigen können. So klagen 60 % der Patienten mit trockenem Auge über eine herabgesetzte Lebensqualität – das entspricht in etwa der Lebensqualitätsminderung bei Angina pectoris. Auch Leistung und Einsatzfähigkeit im Berufsalltag lassen bei 38 % der Betroffenen durch die Augenbeschwerden nach. Da das Trockene Auge mit verzerrtem Sehen und herabgesetztem funktionellen Sehvermögen einhergehen kann, können auch Lesegeschwindigkeit, das Arbeiten am Computer oder Autofahren durch die Erkrankung beeinträchtigt werden. Als besonders belastend empfinden viele Patienten und auch Ärzte den – meist über viele Jahre – immer wiederkehrenden Kreislauf aus Kurzzeitbehandlung, Besserung und Rückfall.
Multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche
Das Trockene Auge, für das oftmals auch die Synonyme „Keratokonjunctivitis sicca” oder „Sicca-Syndrom” verwendet werden, stellt eine ernst zu nehmende, entzündliche Erkrankung dar, die unterschiedliche Strukturen der Tränenfunktionseinheit betreffen kann. Während nach früherem Verständnis als vorrangige Ursache für die Schädigung der Augenoberfläche eine Tränenfilmstörung einhergehend mit stärkerer Verdunstung angesehen wurden, haben zahlreiche Forschungsarbeiten und Erkenntnisse ein komplexeres Bild der Erkrankung aufgezeigt. Gemäß der aktuellen Definition der Tear Film & Ocular Surface Society (Gesellschaft für Tränenfilm und Augenoberfläche), die auch in die aktuellen Leitlinien des BVA und der DOG eingeflossen ist, handelt es sich um eine multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, die mit einem Verlust der Homöostase des Tränenfilmes, mit Entzündungsprozessen, mit einer Schädigung der Augenoberfläche sowie mit neurosensorischen Anomalien einhergeht.
Aktuell gültige Definition des Trockenen Auges
Multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, die gekennzeichnet ist durch einen Verlust der Homöostase des Tränenfilmes und charakterisiert ist durch Tränenfilminstabilität und Hyperosmolarität, Entzündung, Schädigungen der Augenoberfläche und neurosensorische Anomalien.
Entzündung zentrale Komponente
Im Zentrum der Pathogenese des Trockenen Auges steht nach derzeitigem Verständnis ein sich selbst verstärkender Entzündungskreislauf: Auslöser ist häufig eine Instabilität des Tränenfilmes, die zur Hyperosmolarität (das heißt: hohe Elektrolytkonzentration) des Tränenfilmes führt. Dieser hyperosmolare Tränenfilm wiederum bedingt ein Austrocknen und in der Folge ein Absterben (Apoptose) der Epithelzellen von Hornhaut und Bindehaut. Zusätzlich induziert der durch die Austrocknung hervorgerufene Stress eine spezifische Immunantwort und Entzündungskaskade. Im Epithel kommt es zu Entzündungsprozessen und zur Aktivierung proinflammatorischer Zytokine wie z. B. Interleukin (IL)-1, IL-6 und Tumornekrosefaktoe (TNF)-α. Diese wiederum aktivieren unreife, antigenpräsentierende Zellen und schließlich deren Ausreifung. In der Folge werden T-Zellen im Lymphknoten gebildet, die schließlich in die Augenoberfläche einwandern und dort zur Produktion von proinflammatorischen Zytokinen, Chemokinen und Matrix-Metalloproteinasen führen. So kommt es zu einer weiteren Schädigung der Augenoberfläche einhergehend mit dem Absterben von Becherzellen. Da diese für die Muzinproduktion, einem wichtigen Bestandteil des Tränenfilmes, verantwortlich sind, führt dies zu einer weiteren Verstärkung der Tränenfilminstabilität. Der häufigste Risikofaktor für die Entstehung eines Trockenen Auges ist die Meibom-Drüsen-Dysfunktion. Meibom-Drüsen sind Talgdrüsen am Rand der Augenlider und produzieren eine ölige Flüssigkeit, die die Lipidschicht des Tränenfilmes bildet. Diese sorgt als äußerste, stabilisierende Schicht des Tränenfilmes dafür, dass die Tränenflüssigkeit nicht schnell verdunstet. Bei der Meibom-Drüsen-Dysfunktion handelt es sich um eine chronische Störung der Meibom-Drüsen, die durch eine Obstruktion der Ausführungsgänge bedingt sein kann und zu qualitativen und quantitativen Veränderung der Drüsensekretion führen kann. Dies wiederum kann Störungen des Tränenfilmes, Symptome einer okulären Reizung, eine klinisch sichtbare Entzündung und eine Erkrankung der Augenoberfläche zur Folge haben.
Vielfältige Risikofaktoren
Risikofaktoren, die ein Trockenes Auge hervorrufen oder verstärken können, sind sehr vielfältig. So sind ältere Menschen und Frauen prinzipiell häufiger betroffen. Darüber hinaus können auch Allgemeinerkrankungen oder Nebenwirkungen von Medikamenten sowie insbesondere Umwelteinflüsse ein trockenes Auge begünstigen. Eine Lebensweise mit langen Arbeitstagen und zahlreichen Stunden am Computer trägt dazu bei, dass immer mehr und teilweise auch schon junge Menschen unter Augenreizungen leiden („Office-Eye”-Syndrom). Auch Klimaanlagen, Rauch und trockene Luft können das Auge ebenfalls austrocknen. Ebenso kann nach chirurgischen Eingriffen an der Hornhaut, wie z. B. nach LASIK zur Korrektur von Sehfehlern, nach Kataraktoperationen transient oder auch dauerhaft ein trockenes Auge auftreten. Auch Medikamente wie u. a. Antihistaminika, Betablocker und Psychopharmaka begünstigen bei dauerhafter Gabe ebenfalls ein trockenes Auge. Und letztlich können auch andere Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Rosazea, rheumatische Erkrankungen oder Störungen der Schilddrüse mit einem erhöhten Risiko für ein trockenes Auge einhergehen.
Zwei ätiologische Haupttypen
Es werden zwei Haupttypen des Trockenen Auges unterschieden: das hyperevaporative Trockene Auge (EDE), das sich durch eine vermehrte Verdunstung des Tränenfilmes (z. B. durch eine unzureichende äußere Lipidschicht) auszeichnet, und das hyposekretorische Trockene Auge (ADDE), das durch einen Tränenmangel gekennzeichnet ist. Zwischen den beiden Formen gibt es Überschneidungen, viele Patienten leiden unter Symptomen, die auf beide Formen zutreffen. Wie eine retrospektive, multizentrische Studie zeigt, weist nur knapp jeder siebte Patient einen reinen Tränenmangel auf. Die meisten Patienten leiden an der hyperevaporativen Form oder weisen eine Mischform auf. Da die Behandlung je nach Form variieren kann, ist deren Identifizierung im Rahmen der Diagnosestellung ein wichtiger Aspekt für den Arzt.
Umfassende Anamnese – klinische Zeichen und Symptome
Die Diagnose des Trockenen Auges ist nicht immer einfach, denn oft korrelieren objektive klinische Zeichen nicht mit den subjektiven Beschwerden der Patienten. So gibt es Patienten mit erheblicher Symptomatik ohne wesentliche klinische Zeichen, aber umgekehrt auch Patienten mit schwerstem Trockenen Auge und visus-bedrohenden Komplikationen bei nur geringen Beschwerden. Häufig sind die Symptome eines Trockenen Auges sehr unspezifisch und reichen von trockenen bis hin zu tränenden Augen. Aber auch Brennen und Stechen, Juckreiz oder Sehstörungen sind häufig genannte Symptome des Trockenen Auges. Eine umfassende Anamnese ist unerlässlich für die Diagnosestellung und sollte auch die o. g. Risikofaktoren (Allgemeinerkrankungen, Medikamenteneinnahme, Lebensstil/Umwelteinflüsse, Zeitpunkt der Beschwerden) erfassen. Verschiedene Fragebögen können eine standardisierte Befragung zur Symptomatik erleichtern.
Entzündungsstatus erfassen
Eine Spaltlampenuntersuchung ermöglicht u. a. das Auftreten von lidkanten-parallelen konjunktivalen Falten (LIPKOF), die mit hoher Sensitivität und Spezifität einen Hinweis für ein Trockenes Auge darstellen, sowie die Beurteilung der Lidkante. Deren detaillierte Untersuchung gibt Aufschluss über deren Entzündungsstatus oder eine Meibom-Drüsen-Dysfunktion. Weitere wichtige Anzeichen für eine Entzündung sind die Hornhautanfärbbarkeit, die Bindehauthyperämie und eine verminderte Tränenproduktion. Bei Vorliegen einer Hyperämie der Bindehaut und/oder der Lidkante ist eine Entzündung der Augenoberfläche wahrscheinlich, die auch antientzündlich therapiert werden sollte (zusätzlich zu Tränenersatzmitteln). Wichtig ist allerdings zu beachten, dass ein nicht hyperämisches Auge die entzündliche Komponente nicht ausschließt. Die Anfärbbarkeit von Hornhaut oder Bindehaut als Ausmaß der Schädigung der Augenoberfläche korreliert gut mit der Expression proinflammatorischer Zytokine, lässt sich mit Vitalfarbstoffen darstellen und kann mithilfe standardisierter Schemata beurteilt werden. Liegt eine signifikante Binde- und Hornhautstippung vor, ist daher eine antientzündliche Therapie ebenfalls notwendig. Auch der Tränenfilm kann an der Spaltlampe beurteilt werden: Neben der Höhe des Tränenfilmmeniskus (<0,2 mm gilt als pathologisch) kann auch die Tränenfilmaufrisszeit erfasst werden. Dazu wird nach Fluoreszein-Färbung mit einem vorgeschalteten Kobaltblaufilter nach einem kompletten Lidschlag die Zeit bis zum ersten Aufreißen des Tränenfilmes gemessen. Werte < 10 Sekunden gelten als pathologisch und sind ein Indikator für eine Tränenfilminstabilität. Insgesamt ermöglichen diese Untersuchungen eine nicht invasive und schnelle Beurteilung des Entzündungsstatus und des Schweregrades des Trockenen Auges, auf denen wiederum eine stadiengerechte Behandlung basiert. Praxistipp: Wann eine antientzündliche Therapie beginnen?
- Bei Hyperämie der Bindehaut und/oder der Lidkante ist von einer Entzündung auszugehen: Es sollte antientzündlich therapiert werden.
- Bei signifikanter Bindehaut und Hornhautstippung nach Anfärbung: Eine antientzündliche Therapie ist notwendig.
- Tränenfilmaufrisszeit <10 Sekunden (Fluoreszein-Färbung/Kobaltfilter) ist pathologisch: Eine antientzündliche Therapie ist erforderlich.
Mehrstufiges Schema: ab Stufe 2 antientzündliche Therapie
Je nach Schweregrad und Befund des Trockenen Auges wird ein Therapieschema aus vier miteinander kombinierbaren Stufen vorgeschlagen, wobei Tränenersatzmittel – möglichst unkonserviert – bei allen Stufen als grundlegende Basistherapie einzusetzen sind. Reichen allerdings Tränenersatzmittel als Basistherapie nicht mehr aus, ist zusätzlich eine langfristige entzündungshemmende Therapie erforderlich, um den Teufelskreis von Oberflächenschädigung und Entzündung zu durchbrechen und das Voranschreiten des Trockenen Auges zu verhindern. Bereits ab Stufe 2 des Therapieschemas zum Trockenen Auge sowie im Falle von deutlicher Hornhaut-/Bindehautanfärbbarkeit oder anderen Risikofaktoren für eine Entzündung (z. B. immunbezogene systemische Erkrankung) empfehlen der DEWS-II-Report sowie ein europäischer Expertenkonsens den Einsatz von Ciclosporin-A-Präparaten zur antientzündlichen Langzeitbehandlung. Bei Patienten mit Risikofaktoren für ein schweres Trockenes Auge könnte diese noch frühzeitiger erwogen werden, um den selbstverstärkenden Entzündungskreislauf rechtzeitig zu unterbrechen.
Topische Kortikosteroide zur Kurzzeittherapie
Zwar haben randomisierte, kontrollierte klinische Studien gezeigt, dass unkonservierte Kortikosteroidaugentropfen, ausschleichend über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen appliziert, die Symptome und klinischen Zeichen des moderaten bis schweren Trockenen Auges verbessern. Allerdings kann es bei langfristiger Anwendung von topischen Kortikosteroiden zu Komplikationen wie einem erhöhten Augeninnendruck („Steroid-Glaukom”) oder Kataraktentwicklung kommen. Daher sollten diese immer nur zeitlich begrenzt (maximal für vier bis acht Wochen) eingesetzt werden – was allerdings wiederum mit dem Risiko einhergeht, dass die Symptomatik immer wieder neu aufflammt.
Ciclosporin A unterbricht entzündlichen Teufelskreis
Im Gegensatz zu Kortikosteroiden kann Ciclosporin A (CsA) über längere Zeiträume sicher verabreicht werden und hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer immer nützlicheren Behandlungsoption entwickelt. Denn CsA kann aufgrund seiner langfristigen Anwendbarkeit den pathophysiologischen Teufelskreis dauerhaft unterbrechen, um eine nachhaltige Entzündungskontrolle zu erzielen. Mehrere Studien und Metaanalysen haben gezeigt, dass CsA eine wirksame Therapie zur Behandlung von Trockenem Auge ist und ein verträgliches Sicherheitsprofil aufweist. CsA greift direkt zu Beginn der Entzündungskaskade ein und hemmt die Bildung von Interleukin-2 in aktivierten T-Zellen. Dadurch wird deren Differenzierung und Proliferation unterbunden und so die anschließende Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine verhindert – und damit die Entzündungskaskade unterbrochen. In der Folge können auf der Augenoberfläche eine Epithelzellschädigung reduziert, die Anlockung weiterer Entzündungszellen verhindert und klinische Zeichen und Symptome eines Trockenen Auges reduziert werden. Seine maximale Wirkstärke erzielt CsA, sobald alle aktivierten T-Zellen ihre Restlebensdauer von mindestens 120 Tagen überschritten haben. Dies erklärt neben der Verzögerung eines spürbaren Wirkeintrittes auch, warum eine konsequente und langfristige Anwendung entscheidend für den Therapieerfolg ist.
Kationische Emulsion für gezielten Wirkstofftransport
Gerade bei der Behandlung von multifaktoriellen Erkrankungen kann es sinnvoll sein, die verschiedenen ursächlichen Schlüsselfaktoren gleichzeitig zu modulieren. Dazu kann neben dem Wirkstoff auch dessen Formulierung einen wichtigen Beitrag leisten. Kationische Emulsionen wurden entwickelt, um die Homöostase des Tränenfilmes zu stabilisieren, die Wiederherstellung der Augenoberfläche zu unterstützen und gleichzeitig lipophile Wirkstoffe wie z. B. CsA gezielt an die Augenoberfläche zu transportieren. Dabei handelt es sich um unkonservierte Öl-in-Wasser-Formulierungen aus Nanotropfen mit positiv geladener Oberfläche emulgiert in einer wässrigen Phase. Diese enthalten einen öligen Kern, in dem lipophile Wirkstoffe gelöst werden können. Dank ihrer positiv geladenen Oberfläche gehen sie mit der negativ geladenen Muzinschicht des Tränenfilmes und den negativ geladenen Zellen der Augenoberfläche elektrostatische Wechselwirkungen ein. Dies fördert die Verteilung im Tränenfilm und unterstützt eine verlängerte Verweildauer an der Augenoberfläche. Zudem schützt das in der wässrigen Phase enthaltene Glyzerin die Epithelzellen der Augenoberfläche vor einer Hyperosmolarität des Tränenfilmes, während Inhaltsstoffe der öligen Phase die äußere Lipidschicht des Tränenfilmes verstärken und deren Grenzschicht zur wässrigen Phase des Tränenfilmes stabilisieren.
CsA in kationischer Emulsion: wirksame Langzeittherapie
Bislang liegt die umfangreichste Datenlage für CsA in kationischer Emulsion vor. Die Ergebnisse aus kontrollierten Studien sowie auch aus Real-World-Untersuchungen zeigen einheitlich, dass eine Langzeittherapie mit CsA in kationischer Emulsion sowohl die objektiv messbaren Anzeichen als auch die subjektiven Symptome eines Trockenen Auges nachhaltig verbessert. Die allgemeine Verträglichkeit war gut und eine systemische Absorption von CsA vernachlässigbar, wie u. a. eine gepoolte Analyse mit 734 Patienten aus zwei Studien ergab. Auch die europäische, Real-World-Studie PERSPECTIVE, an der 44 Zentren aus fünf Ländern teilnahmen, bestätigt die Wirksamkeit und Verträglichkeit einer antientzündlichen Behandlung mit CsA in kationischer Emulsion im Praxisalltag. In dieser Studie wurden 472 erwachsene Patienten mit Trockenem Auge und unzureichendem Ansprechen auf Tränenersatzmittel über zwölf Monate einmal täglich mit CsA in kationischer Emulsion behandelt. Zu Studienbeginn lag der „corneal fluorescein staining”-(CFS-)Grad (Fluoreszein-Anfärbbarkeit der Hornhaut), ein Standard zur objektiven Erfassung von Schäden der Hornhautoberfläche, bei zwei Drittel der Patienten bei II oder III. Bereits ab der vierten Woche traten signifikante Verbesserungen der Anzeichen und Symptome des Trockenen Auges ein und blieben über den gesamten zwölfmonatigen Studienzeitraum erhalten. So sank der mittlere CFS-Grad im Verlauf der Studie signifikant um 1,4 von durchschnittlich 2,56 ± 1,1 auf 1,1 ± 1,13 zu Monat 12 (p<0,0001) (primärer Endpunkt), was eine deutliche Verbesserung der Hornhautoberfläche darstellt. Auch Symptome wurden signifikant reduziert. Die häufigsten behandlungsbedingten Nebenwirkungen waren Augenschmerzen und -reizungen. Diese waren überwiegend leicht oder mäßig schwerwiegend und meist bis zum Studienende wieder abgeklungen. Allgemein wurde die Behandlung als gut bis sehr gut verträglich beurteilt. Zudem waren die meisten Ärzte der Ansicht, dass sich die klinischen Symptome unter CsA in kationischer Emulsion verbesserten und diese besser wirksam war als die vorherige Therapie.
Anwendung im Praxisalltag
Im Praxisalltag sollte eine antientzündliche Therapie nicht allein den schweren Fällen vorbehalten bleiben. Wie bereits beschrieben, sollte bereits ab Stufe 2 des Therapieschemas eine antientzündliche Behandlung erwogen werden. Dies kann auch Patienten mit milden bis moderaten Formen des Trockenen Auges einschließen, bei denen eine Oberflächenentzündung vorliegt und bei denen daher eine Behandlung mit Tränenersatzmitteln allein möglicherweise nicht mehr ausreicht. Wird eine antientzündliche Therapie mit CsA begonnen, so ist es sehr wichtig, die Patienten darüber zu informieren, dass ein spürbarer Effekt aufgrund des Wirkmechanismus von CsA verzögert auftritt, dieser sich aber bei zunehmender Therapiedauer kontinuierlich steigert und sich eine konsequente, langfristige Behandlung lohnt. Darüber hinaus hat es sich im Praxisalltag bewährt, Patienten darüber aufzuklären, dass Brennen und Stechen kurz nach Eintropfen von CsA typische Nebenwirkungen sind. Diese können möglicherweise auftreten, lassen aber in der Regel rasch wieder nach. Zudem lassen sie mit zunehmender Anwendungsdauer und einhergehender Verbesserung der Augenoberfläche meist nach. Die Behandlung mit CsA erfolgt einmal täglich, in der Regel abends vor dem Schlafengehen. Nach unseren Erfahrungen nehmen Patienten in der Regel bereits nach vier Wochen eine Besserung wahr, die sich im weiteren Verlauf bei andauernder Therapie fortsetzt und meist nach acht Wochen die maximale Wirkstärke erreicht. Zur Überprüfung des Wirkeintrittes empfehlen sich im ersten Quartal monatliche und anschließend vierteljährliche Kontrollen. Wesentlich ist, dass das Tränenersatzmittel zusätzlich weiter angewendet wird, wobei die Frequenz mit zunehmender Besserung angepasst werden kann.
„Bridging“ für leichteren Einstieg in CsA-Langzeittherapie
Für Patienten, bei denen ein rascherer Wirkeintritt gewünscht ist, kann das sogenannte „Bridging” angewendet werden, das in zwei Konsensusartikeln vorgeschlagen wurde. Dazu wird die antientzündliche Therapie mit konservierungsmittelfreien, topischen Kortikosteroiden initiiert. Zeitgleich oder um etwa eine Woche verzögert wird eine zusätzliche Therapie mit CsA eingeleitet. Diese wird mit regelmäßigen Kontrollen langfristig fortgesetzt, während die Kortikosteroidtherapie über einen Zeitraum von etwa vier Wochen ausgeschlichen wird. Zusätzlich werden Tränenersatzmittel nach Bedarf angewendet. So können im Praxisalltag die Stärken beider Therapieansätze miteinander kombiniert werden: Während durch die nur kurzzeitige Kortikosteroidtherapie mögliche Komplikationen vermieden und eine rasch spürbare Symptomlinderung erreicht wird, lässt sich mit der CsA-Langzeittherapie eine nachhaltige Entzündungskontrolle, Symptomlinderung und Verbesserung der Hornhautoberfläche erreichen. Medizinisch ist ein „Bridging” zwar nicht erforderlich, es kann Patienten aber den Einstieg in die CsA-Langzeittherapie erleichtern.
Fazit
- Das Trockene Auge ist eine häufige, multifaktorielle Erkrankung, der ein sich selbst verstärkender Entzündungsmechanismus zugrunde liegt.
- Ziele der Behandlung sind die Wiederherstellung der Homöostase des Tränenfilmes und die dauerhafte Unterbrechung der Entzündungsprozesse.
- Eine antientzündliche Behandlung sollte ab Stufe 2 des mehrstufigen Therapieschemas erfolgen, d. h. dann, wenn Tränenersatzmittel nicht ausreichen. Dies kann bereits bei mildem bis moderatem Trockenen Auge der Fall sein.
- Kortikosteroide bringen eine rasche Linderung, sind allerdings nur als Kurzzeittherapie geeignet (wegen Katarakt/Augeninnendruckanstieg); bei Absetzen droht ein Rebound-Effekt.
- Eine antientzündliche Langzeittherapie mit Ciclosporin A kann den entzündlichen Teufelskreis bei Trockenem Auge durchbrechen und eine deutliche Verbesserung der klinischen Anzeichen und Symptome erreichen.
Bildnachweis
Nadzeya Haroshka – istockphoto.com
Referenten
Prof. Dr. med. Ines Lanzl Chiemsee Augen Tagesklinik Geigelsteinstr. 26 83209 Prien Dr. med. Stefan Pfennigsdorf Marktplatz 13 56751 PolchInteressenkonflikte
Sponsoring
Diese Fortbildung wurde für den aktuellen Zertifizierungszeitraum mit EURO 16.900,- durch die Santen GmbH unterstützt.
Über uns
cme-kurs.de ist eine Initiative des CME-Verlags und seiner Partner. Die Website bietet kostenlos CME-Fortbildungen für Ärzte und Apotheker sowie deren Mitarbeiter vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und gültiger Leitlinien. Interaktive, eTutorials, videogestützte Folienvorträge, Audio-Podcast und elektronische Kurzfortbildungen machen das Lernen und erwerben von CME-Punkten interessant und kurzweilig.
Rechtliches
Verlagsadresse
Siebengebirgsstr. 15
53572 Bruchhausen, Rheinland Pfalz
Tel: +49 2224 - 82561 05
Fax: +49 2224 - 82561 13
Mail: info(at)cme-verlag.de
Kontakt